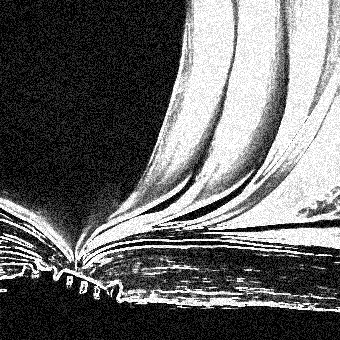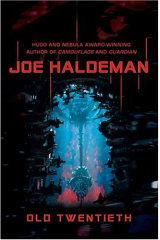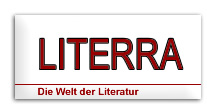
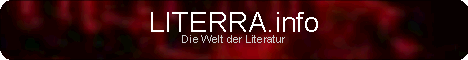
|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > TRASH & TREASURY > Space and Haldeman |
Space and Haldeman
„Coyote“ – der Name des ersten von Menschen außerhalb des Sonnensystems besiedelten großen Mond mit einer erdähnlichen Atmosphäre – ist der Auftaktband einer der am längsten laufenden Serien im Schaffen des amerikanischen Science Fiction Autoren Allen Steele. Seit 2002 mit „Coyote: A Novel of Space Exploration“ sind insgesamt sieben Fugenromane bestehend aus einzelnen Episoden und eine längere Novelle veröffentlicht worden. Schon mit dem ersten Buch setzt Allen Steele eine genretechnisch fast in Vergessenheit geratene Tradition fort: die einzelnen Texte dieser Mosaikromane erschienen im Jahre 2001 und 2002 in „Issac Asimov´s Science Fiction Magazine“ und sind vom Autor für die Buchveröffentlichung mehr oder minder bearbeitet worden. Zu den berühmtesten Fix- Up Werken gehören sicherlich Isaac Asmiov´s „Foundation“ wie auch Walter Millers „Lobgesang auf Leibowitz“. Das Durchbrechen der klassischen Romanstruktur ermöglicht es dem Autoren, nicht nur auf sehr viel mehr unterschiedliche Charaktere zurückzugreifen, sowohl die Berichtsform als auch die direkte Erzählung zu wählen und ein Epos zu gestalten, sondern er kann die Texte sehr viel konzentrierter und pointierter schreiben als es die klassisch strukturierten Trilogien mit ihren lang gezogenen Erzählungen ermöglichen. Unabhängig von dieser Stärke beinhaltet diese Vorgehensweise aber auch die Schwäche, dass die einzelnen ursprünglich unabhängig voneinander veröffentlichten Geschichten stärker sind als das Gesamtprodukt. Im vorliegenden Auftaktband hat sich Allen Steele insbesondere in einem Klima der sozialen Radikalisierung der Vereinigten Staaten das Ziel gesetzt, neben einer klassischen Space Opera den Mythos des amerikanischen Pioniergeistes, des Traums der grenzenlosen Freiheit und natürlich der so einzigartigen Frontiermentalität zu untersuchen. Im Gleichklang mit der irdischen Geschichte, in welcher die ersten „Amerikaner“ der politischen Verfolgung und der Armut im alten Europa in die neue Welt zu entfliehen suchten, greift die Besatzung des ersten interplanetaren Raumschiffes – die „Alabama“ – nach der einzigartigen Chance, das Schiff zu stehlen und auf eigene Faust auf dem einzigen bewohnbaren Mond eines mehr als vierzig Lichtjahre entfernten Systems neu und in Freiheit anzufangen. Amerika ist inzwischen eine erzkonservative Republik geworden, in der viele Menschen im Elend leben müssen, ein diktatorisches Überwachungssystem in der Tradition George Orwells „1984“ etabliert worden ist und die Machthaber nur noch die eigenen Taschen füllen. Kommandant Robert Lee – genau wie der Präsident in einer der unglaubwürdigen Konstellationen des Buches ein Nachfahre der Gründungsväter der USA – ergreift mit einer Handvoll Vertrauter die Chance, die ihm anvertraute „Alabama“ entgegen des ursprünglichen Auftrags zu einem klassischen Kolonistenschiff „umzugestalten“ und nicht dem Auftrag zu folgen, die fremde Welt für die amerikanische Republik in Besitz zu nehmen. In der für den HUGO Award nominierten Novelle „Stealing Alabama“ stellt der Autor nicht nur geschickt, aber ausgesprochen komprimiert die wichtigsten Mitglieder der interstellaren Expedition vor, mit einfachen, fast kargen zu nennenden Szenen entlarvt er die gegenwärtig politische Fehlentwicklung der USA schon im Vorfeld des 11. Septembers als Heuchelei und Selbstbeweihräucherung und entlässt seine nach klassischen Heldengesichtszügen gemeißelten Protagonisten mit dieser neuen Chance in eine urwüchsige, aber auch für die Menschen gefährliche Landschaft. In der Nach „Avatar“ Ära erinnert vieles von Allen Steele Jahre vorher publiziertem Werk an James Camerrons Film. Nur die Außerirdischen bleiben sehr lange in ihren Verstecken. Schon in der ersten Novelle beschreibt Allen Steele sowohl einzelne Protagonisten wie Wendy Gunther – eine Jugendliche, die viele Jahre in Erziehungsheimen gelebt hat, jetzt mit ihrem ihr fremden Vater zu den Sternen fliegen soll, dort die erste Mutter eines auf Coyote geborenen Babys wird und später die sozialpolitische Entwicklung der Kolonie mit viel Langmut mitformen soll – oder Mitglieder der beiden sich in den folgenden Romanen zum Teil bis aufs Blut bekämpfenden Familien Monteros oder Levins, die aus unterschiedlichen Gründen auf der Erde verfolgt worden sind. Über allen steht insbesondere in den ersten Geschichten Kommandant Robert Lee, der Kapitän der Mission und das erste politische Schwergewicht auf „Coyote“, obwohl er relativ schnell zumindest eine rudimentäre frei gewählte Gemeindevertretung einsetzt. „Coyoto“ lässt sich gut in die Anreise – die ersten drei längeren Geschichten – und die ersten Schritte auf dem Planeten selbst unterteilen. Was hinsichtlich der Jahrhunderte langen Flugdauer auf den ersten Blick als langweilig nach dem spektakulären Anflug erscheinen könnte, entpuppt sich rückblickend als emotionaler Höhepunkt des ganzen Fugenromans: „The Days between“. Der Kommunikationsoffizier Leslie Gilis wird in einem frühen Stadion des über zweihundert Jahre dauernden Fluges geweckt. Die künstliche Intelligenz hat mit einem logistischen „Fehler“ den falschen Mann in der richtigen Kapsel geweckt. Dadurch wird verhindert, das ein eingeschleuster Saboteur das Raumschiff sprengen kann. Für Gilis bedeutet es allerdings auch, bis ans Ende seiner Tage - immerhin zweiunddreißig Jahre - alleine im Raumschiff zu leben, während die anderen Besatzungsmitglieder und Siedler weiterhin im Hyperschlag sind. Gilis entschließt sich schließlich, eine moderne Fantasy Geschichte aus einer fremden Welt angesiedelt zu schreiben, um bei Verstand zu bleiben und die kahlen Wände des Raumschiffs innen mit Bildern seiner Phantasie zu verzieren. Gilis literarische Arbeit wird sich wie ein roter Faden durch die folgenden „Coyote“ Bände ziehen, immerhin berichtet er von einer Welt, die er nicht mehr erblicken durfte. Die Episode ist emotional packend ohne ins Kitschige abzudriften geschrieben. Stelle gelingt es anfänglich ausgezeichnet, Gilis einsam provozierende Exzesse - wie gut, das jemand Alkohol an Bord geschmuggelt hat - zu beschreiben. Fokussiert auf einen einzigen, im Grunde tragischen Antihelden handelt es sich bei „The Days between“ um ein klassisches Kammerspiel, das die Einsamkeit Dantes - Alexandre Dumas Grafen von Montechristo - extrapoliert und trotz einer im Grunde rudimentären Grundhandlung unglaublich überzeugend geschrieben worden ist. Obwohl sowohl der Leser als auch Gilis wissen, das es keine Rettung geben wird, gelingt es ihm schließlich zur Freude der Leser, seine endlosen und immer im gleichen Rhythmus ablaufenden Tage auf dem im Grunde für ihn unendlichen Flug mit sinnvollen Tätigkeiten zu füllen.
Das zweite große Kapitel unter dem Sammeltitel „Shores of the Unknown“ vereinigt eine klassische Jugendgeschichte in der Tradition Mark Twains - mit einem überdimensional langen Fluss auf „Coyote“, den die jugendlichen zusammen mit der Ärztin in einer selbst organisierten Expedition erforschen - mit dem frühen Pioniergeist. Die Charaktere sind überzeugend, sehr nuanciert mit allen Stärken und Schwächen beschrieben worden. Dabei bemüht sich Alan Steele, gegenwärtige Strömungen in eine archaisch urzeitliche Umwelt zu versetzen und zu zeigen, das in den Jugendlichen teilweise mehr Willensstärke und Entschlossenheit steckt, als ihnen die Erwachsenen auf den ersten Blick zutrauen. Obwohl im Verhältnis zu anderen Texten der Sammlung etwas zu lang geraten und aufgrund der Ich- Erzählerperspektive in Kombination mit dem Aufbau als Bericht die eigentliche Spannung stellenweise negierend, liest sich „Across the Eastern Divide“ ausgesprochen flüssig und packend.
Wie geschickt Allen Steele den Fugenroman nicht nur aufgebaut, sondern im Vorwege geplant hat, zeigt sich im letzten beiden Kapitel „Glorious Destiny“, in dem nicht nur auf eine Randnotiz aus „The Days between“ Bezug genommen wird, sondern in welchem Allen Steele in der Tradition früherer Murray Leinster Texten die Erwartungshaltung der Leser komplett auf den Kopf stellt. Fast zynisch zeigt Allen Steele den Siedlern auf, das sie dem totalitären politischen System der amerikanischen Republik entkommen sind, um schließlich von einer neuen, im Grunde nicht weniger schrecklichen bis verlogenen Regierungsform aus der tiefsten Vergangenheit eingeholt zu werden. Im Falle des vorliegenden ersten Fugenromans schließt Allen Steele seine Geschichte nicht nur auf einer optimistischen Note, es gelingt ihm ausgesprochen überzeugend, den Anfang des Buches mit dem hoffnungsvollen Ende zu verbinden. Der schlimmste Feind des Menschen bleibt immer noch der Mensch.
Im Vergleich zu seiner fünfbändigen „Near Earth“ Serie, die aus lose miteinander verbundenen Romanen besteht, von denen die ersten Bücher auch auf Deutsch im Bastei Verlag erschienen sind, wirkt „Coyote“ hoffnungsvoller und zynischer zu gleich. Voller Intensität geht Allen Steele auf die Suche nach dem amerikanischen Traum. Es ist sicherlich kein Zufall, das seine aufrechten Protagonisten aus dem Trauma einer Diktatur heraus in die Unendlichkeit des Alls - im übertragenen Sinne über den Atlantik - jeweils in eine neue Welt fliehen, die herausfordernd wie auch wunderschön ist. Im Gegensatz zu den Pilgern, die sich mit den Ureinwohnern auseinandersetzen mussten, greift Allen Steele insbesondere im zweiten Band der Serie spannungstechnisch ausgesprochen geschickt auf eine zweite zahlenmäßig überlegene Welle von Siedlern zurück. Im Verlaufe der insgesamt acht einzelnen Kurzgeschichten und Novellen, die hier zu einem Fugenroman verbunden worden sind, spricht der Autor manchmal ein wenig pathetisch, aber viel öfter effektiv melancholisch die wichtigsten positiven Grundlagen der amerikanischen Siedler und Frontiermentalität an. Dabei gelingt es dem Autoren ausgezeichnet, die im vorliegenden Roman nur wenig extrapolierte technische Entwicklung in keinem zu starken Kontrast mit der degenerierenden Politik zu zeigen. Kombiniert ergibt sich ein einzigartiger, lesenswerter und mit viel Herzblut, aber auch menschlicher Erfahrung geschriebener Roman, welcher den Leser von den ersten Worten „This is a Story of a new World“ in seinen Bann schlägt.
Seit vielen Jahren gilt der Engländer Eric Brown als solider Geheimtipp unter den britischen Science Fiction Autoren. Seine Romane sind solide und geradlinig, seine Charaktere sorgsam ausgearbeitet. Die Technik wird in die Handlung nachvollziehbar integriert und auf esoterische Phantasien verzichtet er. Die ersten Romane aus seiner Feder sind noch im Heyne- Verlag erschienen, auf den ersten großen Roman aus Eric Browns Feder muss der Leser allerdings auch noch warten. Das sollte sich mit „Helix“ ändern. Zumindest in der Vorstellung des Verlages und des Autoren. Dabei ist „Helix“ im Grunde eine Art Retroroman, eine Rückbesinnung auf die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, in denen die Science Fiction im Grunde zwei Wege ging. Auf der einen Seite die New Wave, welche das Genre von außen zu erneuern begann und auf der anderen Seite eine Sucht nach Größe. Gigantische künstliche Gebilde irgendwie in den Tiefen des Weltalls, vor vielen Millionen Jahren erbaut von Wesen, welche die Menschen nicht mehr kennen konnten und deren Motive im Dunklen des Alls verloren gegangen sind. Einige dieser Auswirkungen lassen sich noch heute erkennen: so schreibt Larry Niven immer noch in seinem „Ringwelt“ Universum, Clarke und Lee bauten eine ganze Reihe von Romanen um „Rama“ und Bob Shaw entwickelte seine „Orbitsville“. Charles Sheffield sowie Jack McDevitt griffen die Ideen in die Galaxis umfassenden Transportsystemen auf einer für den Menschen griffigeren Ebene wieder auf.
In „Helix“ begegnet der Autor wie der Originaltitel schon sagt einer Helix, die anscheinend aus Tausenden von unterschiedlichen miteinander verbundenen Welten mit erdähnlicher Atmosphäre besteht. Diese Welten sind um einen einzigen Stern herum angeordnet. In der Polarregion dieser Helix landet das menschliche Kolonistenraumschiff Lovelock, dessen Aufgabe gewesen ist, den insgesamt dreitausend tief gefrorenen Menschen eine neue Heimat zu suchen. Natürlich muss die Besatzung relativ schnell die Helix erkunden, um den ihnen anvertrauten Menschen auf dieser gigantischen Welt eine neue Heimat zu suchen. Dabei geraten die Menschen schnell in den Konflikt mit den verschiedenen Bewohnern dieser Welt. Aus ihnen ragen die Mitglieder einer den irdischen Primaten vergleichbaren Rasse heraus, die auf ihrer stetig von tief stehenden Wolken verhüllten Ebene von einer orthodoxen Kirche tyrannisiert werden. Jede Art von intellektueller Weiterbildung ist verboten, sie leugnen die Helix als Ganzes und sehen sich natürlich als Höhepunkt der Schöpfung. Nur ein Mitglied dieser Rasse nimmt trotz des Verbotes durch die Kirche Kontakt mit den Menschen auf. Dass sie dabei auch ihrem eigenen Volk helfen wird, ahnt Ehrin noch nicht.
Sicherlich nicht absichtlich so komponiert wirkt „Helix“ wie ein Überbleibsel aus den schon angesprochenen späten siebziger Jahren. Das große unbekannte und natürlich eindrucksvolle Objekt ist einfach da. Über die Erbauer gibt es keine Informationen. Sie sind im vorliegenden Band auch nicht geplant. Die Menschen sollen sich unbedeutend fühlen. In einem starken Kontrast dazu beschreibt Brown eine Rasse von Außerirdischen, welche den Menschen zur Zeit der Inquisition entsprechen. Die Unterschiede sind marginal. Während sich diese Wesen als Höhepunkt der Schöpfung sehen und ihre kirchlichen Vertreter als Stellvertreters Gottes, sind die Menschen von der Erde zumindest intellektuell einen Schritt weiter. Beide Rassen stehen aber dieser grandiosen Schöpfung staunend gegenüber. Auf den ersten Seiten des Romans beschreibt Eric Brown sehr eindrucksvoll, dass trotz allen Fortschritts und aller Technik der Mensch immer noch im Mittelpunkt stehen sollte. Der Auftakt ist sehr solide, die Zeichnung der Figuren – von denen nicht alle die Reise überleben werden – pointiert, aber überzeugend. Gegen Ende des Buches nimmt der Autor diesen menschlichen Handlungsbogen noch einmal auf und lässt zu, das sich Fremde wie Menschen noch einmal intellektuell weiterentwickeln. Zwischen diesen beiden gut, aber auch sehr berechnend geschriebenen Eckpunkten des Buches steht die klassische “Quest“.
Obwohl die Menschen durch oder über eine grandiose künstliche Welt stolpern und der Autor eine Reihe von sehr spannenden und auch dramatisch geschriebenen Situationen entwirft, verwehrt Brown sehr konsequent den Blick auf das Ganze. „Helix“ fehlt die grandiose Weitsicht, der Blick auf das unfassbar Ganze. Und unter dieser Schwäche leidet der Roman. Selbst in dem Augenblick, in dem die Menschen erkennen, wo sie gelandet wird, reduziert Brown diese für den Roman wichtige Situation auf das Rudimentärste. Der Leser hat stellenweise das Gefühl, als schäme sich der Autor für seine künstliche Schöpfung. Insbesondere im Vergleich zu Nivens, Clarkes und Shaws ebenso spektakulären künstlichen Gebilden wirkt „Helix“ distanziert und emotionslos trocken. Weiterhin verzichtet Brown auf jegliche Physikalische Spekulation. Larry Niven hat sich zumindest bemüht, eine theoretische Basis für die Ringwelt zu entwickeln, die wissenschaftlich betrachtet nicht überzeugend ist. Aber Larry Niven hat seinen Lesern zumindest das Gefühl vermittelt, das er sich als Autor Gedanken über die Möglichkeit eines solchen Gebildes gemacht hat. Kaum hat Eric Brown seinen Charakteren den Blick aufs Ganze stellvertretend für den Leser gegönnt, zieht er auch den Vorhang wieder zu und konzentriert sich auf die nicht uninteressante menschliche bzw. außerirdische Handlungsebene. Der sich aufgrund von diversen Missverständnissen und Vorurteilen anbahnende Konflikt zwischen Menschen und Fremden ist für den Leser nicht ohne Interesse, aber hätte auch auf einem „normalen“ Sauerstoffplaneten spielen können.
Vor allem weil Brown die verschiedenen Welten – Eis, Wasser und Dschungel seien hier stellvertretend genannt – nicht miteinander verbindet, sondern auf der Helix unüberzeugend voneinander trennt. Alle Welten haben eine erdähnliche Atmosphäre und die jeweiligen außerirdischen Rassen haben zu wenige Unterschiede zu den Menschen bzw. Tieren der Erde. In dieser Hinsicht ist „Helix“ eine der schwächsten von Eric Brown bislang geschriebenen Romane.
Obwohl viele von den Nebencharakteren eher eindimensional bis klischeehaft entwickelt worden sind, gelingt es Brown hervorragend, das Geschehen aus der unterschiedlichen Perspektive der Fremden Ehrin und dem Menschen Henry – einem im Grunde alten Mann, der in letzter Sekunde aus der Rente heraus für diese Mission rekrutiert worden ist – zu beschreiben. Sehr geschickt hält der Autor teilweise wichtige Informationen zurück oder verschiebt an wichtigen Stellen die Perspektive nur ein wenig, um das Interesse des Lesers hochzuhalten. Trotz der großartigen Idee und des insbesondere auf der humanistischen Ebene viel zu ambitionierten Vorsatzes ist „Helix“ ein klassischer Pulp SF Roman. Die Versatzstücke – eine großartige künstliche Schöpfung ; eine verzweifelte Mission, die Menschheit zu retten; eine First Contact Geschichte und schließlich das Erwachen aller Protagonisten – sind im Übermaß vorhanden und teilweise auch interessant beschrieben, aber sie wirken eher mechanisch distanziert zu diesem rasant zu lesenden, aber intellektuell zu wenig zufrieden stellenden Roman zusammengesetzt.
Generationenraumschiffe, Unsterbliche, Zeitreisen in virtuelle Realitäten und eine Mysterygeschichte. Und das alles wird auf nicht einmal dreihundert Seiten erzählt. Bis auf die unnötige Fortsetzung zu „Der ewige Krieg“ hat sich Joe Haldeman in seinen mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten neusten Romanen als Meister der Kompression erwiesen. Dabei sind seine Romane nicht nur kompakt, ihm gelingt es, „alten“ Ideen neues Leben einzuhauchen. Ähnlich wie bei „The Guardian“ trickst Joe Haldeman allerdings hinsichtlich des Endes des hier vorzustellenden Werkes „Old Twentieh“ und bemüht sich, die zahlreichen roten Fäden für den Leser zufriedenstellend, aber nicht befriedigend zusammenzufassen. Für das Bemühen sollte dem Autoren zumindest eine Fleißnote im Vergleich zu manchem Kollegen vergeben werden. Auf der anderen Seite handelt es sich bei „Old Twentieth“ um einen intelligenten und sehr unterhaltsamen Roman. Obwohl es bei dem Roman in erster Linie um Unsterblichkeit und die aufkommende Langeweile nach einer bestimmten Lebenszeit geht, finden sich auch autobiographische Passagen in dem Buch. So endet der Roman im Jahre „1968“, in welchem auch Haldeman in Vietnam gedient hat. Das Trauma des Krieges hat der Amerikaner ja nicht nur in „Der ewige Krieg“, sondern auch in „1968“ zu verarbeiten gesucht. Er beginnt auf den Schlachtfeldern Gallipolis, einer der grausamsten und blutigsten Auseinandersetzungen des Ersten Weltkriegs. Nach den intensiven Kampfbeschreibungen wachen Protagonist und Leser quasi im Gleichschritt auf. Es handelt sich nur um eine virtuelle Illusion. Jacob Brewer verbringt sehr viel Zeit in seinem geliebten zwanzigsten Jahrhundert. Dabei hat Brewer nicht nur Zugang zu den verschiedenen Illusionen aus der Konserve einer künstlichen Intelligenz, er hat im 20. Jahrhundert gelebt. Reich genug, sich frühzeitig die Unsterblichkeit zu kaufen hat er den letzten Bürgerkrieg der Menschen – zwischen Sterblichen und Unsterblichen – überlebt. Inzwischen befindet er sich an Bord eines Raumschiffes, das Menschen im künstlichen Koma zu neuen Welten bringen soll. Kaum an Bord des Schiffes gibt es Probleme mit der „Traummaschine“. Ein Mensch stirbt während der Illusion und Jacob Brewer als Aufseher der VR – Maschinen muss feststellen, ob diese Illusionen eine Gefahr für die Menschen/ Unsterblichen darstellen oder nicht. Bei seinen zahlreichen Kontrollbesuchen in unterschiedlichen Zeiten stellt er leichte Veränderungen und Fehler fest. So gibt es in den vierziger Jahren keine Gerüche oder wichtige historische Fakten werden variiert. Unter dem Druck seiner ständigen Inspektionszeitreisen zerbricht seine Ehe. Das Phänomen ist inzwischen auch auf die Erde übersprungen. Prozentuell immer mehr Unsterbliche sterben in den VR- Zeitmaschinen, ohne das sich die Regierung wirklich zu einem Abschalten entschließen kann. Jacov Brewer stellt fest, dass die künstlichen Intelligenzen, welche die Maschinen steuern, in der Zwischenzeit ein Eigenleben entwickelt haben.
Auf den ersten Blick wirkt das hier zusammengefasste Plotszenario vertraut. Haldeman ist ein Autor, der seine Ideen in bekannte Schemata einfließen lässt und eher impliziert die Ideen extrapoliert. Die Zukunftsebene ist mit einem melancholisch– pathetischen Grundton geschrieben worden. Den Figuren fehlen Emotionen, ihr Leben ist steril geworden und die Reise in die virtuelle Realität wird mehr und mehr zu einer Droge. Diesen Drang beschreibt der Autor sehr überzeugend. Der Roman lebt aber in erster Linie von den Reisen in das verrückte und gefährliche zwanzigste Jahrhundert. Die Beschreibungen von militärischen Auseinandersetzungen beherrscht Haldeman sicherlich auch aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen wie kein zweiter Autor. Dazu kommt die spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkriegs, die große Depression, der erste Golfkrieg und als Abschluss die Illusion der goldenen zwanziger Jahre. Gestreift wird das verrückte Jahre 1968 – der „Summer of Love“ – als Kontrast zu den Vietnamszenarien. Jacob Brewer dominiert im positiven wie negativen Sinne den Roman. Die Nebenfiguren sind eher oberflächlich beschrieben und führen eher überzeugende Fremdleben in den VR Szenarien als an Bord des Raumschiffes. Selbst die nächsten Verwandten beschreibt der Autor ausschließlich aus der Perspektive des Protagonisten, was das Buch positiv ungewöhnlich fokussiert macht, negativ aber auch eine überdurchschnittliche Identifikation mit dem Protagonisten verlangt. An Bord des Raumschiffs flechtet der Autor Haldeman eine zum Scheitern verurteilte Beziehungsgeschichte in den laufenden Plot mit ein, die aufgrund der Vernachlässigung der Nebenfiguren oberflächlicher und die Handlung dehnender erscheint als sie wahrscheinlich beabsichtigt gewesen ist. Im Vergleich zu „The Guardian“ und dem beeindruckenden Portrait einer zu sich selbst findenden Frau sind im vorliegenden Buch alle Figuren zweidimensional und enttäuschend. Nur die teilweise ironisch unterlegten Monologe Brewers, der einem unbekannten Publikum seine Lebensgeschichte in Kombination mit der Historie des 20. und 21. Jahrhunderts erzählt, überdecken einen Teil der Charakterisierungsschwächen. Aber Haldeman bleibt auch ein hoffnungslos romantischer Optimist. Und das gehört zu den Stärken seines inzwischen sehr relevanten und wichtigen SF Werkes. Obwohl Jacob Brewer in seinem langen Leben mehr Leid und Tod gesehen hat als es vielleicht ein einziger Mensch ertragen kann, gelingt es Haldeman, eine Balance zwischen den Schrecken des Krieges und dem zarten hoffnungsvollen Optimismus der jeweils Überlebenden aufrechtzuerhalten. Es ist diese auf den ersten Blick verrückte Mischung, die Konzentration auf das Wesentliche in einer geradlinigen, solide geschriebenen, aber wie schon eingangs erwähnt hinsichtlich des Endes einige Kompromisse fordernden Story, die aus „Old Twentieth“ einen überraschend guten, intellektuell stimulierenden, ohne alles zu erklärenden Roman macht.
Es ist im Grunde tragisch, dass das bislang hervorragende Gesamtwerk Haldemans in erster Linie vom erdrückenden Erfolg einer seiner ersten Geschichten - „The Forever War“ - überschattet wird. Vielleicht wirft die Hollywoodverfilmung auch ein Licht auf seine anderen, mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Romane. Auffällig ist, das Haldeman in einem Zeitalter der Übertreibung, der Trilogien und endlosen Serien seine Geschichten karg, ohne großartiges Beiwerk, als reine Ideenketten präsentiert. Kaum einer seiner letzten Romane ist im englischen Original länger als dreihundert Seiten. Keiner seiner Romane walzt die oft verblüffend simple, aber geschickt extrapolierte Idee über Gebühr aus. Haldeman ist ein Schriftsteller, der sich dank seiner pointierten, nicht selten ironisch entlarvenden Dialoge, seinen präzisen Beschreibungen und vor allem seinen bis zum nicht immer positiven Ende hin stringenten Plots aufs Wesentliche konzentriert. Mit „The Accidental Time Machine“ aus dem Jahre 2007 schlägt der Amerikaner im Grunde einen gewaltigen Bogen über das Thema Zeitmaschinen und Parallelwelten zurück zu H.G. Wells „Die Zeitmaschine“.
Im Gegensatz zu Wells unbekanntem Reisenden erfindet Haldeman Protagonist Matt Fuller, ein Student an der MIT eher durch einen Zufall eine Zeitmaschine. Sie kann aber nur vorwärts in der Zeit reisen. Und zwar mit einer exponentialen Reisedauer. Zuerst Sekunden, dann Minuten, schließlich Tage, Monate und Jahre. Matt Fuller weiß ganz genau, in welches Jahr ihn der Sprung bringen wird. Anfänglich bleibt nur auszurechnen, wie weit sich die Erde in dieser Zeit weiterbewegt. Bei den kürzeren Intervallen kein Problem, nicht hinsichtlich der späteren Sprünge über mehrere Jahrhunderte bzw. Jahrtausende sollte Fuller sich für jeden Zufall rüsten. Gerade hat sich seine Freundin von ihm getrennt, als er nicht nur seine Entdeckung macht, sondern sie bei Heimexperimenten perfektioniert. Während der ersten Reise kommt es in seiner Abwesenheit zu einem Todesfall. Ein unbekannter Mann – aus der Zukunft – hinterlässt für ihn eine Kaution von eine Millionen Dollar. Für Fuller das letzte Argument, sich in der Zeit vorwärts zu bewegen und quasi die alten Sorgen hinter sich zu lassen. Wie in Wells berühmten Klassiker begegnet Fuller futuristischen, aber niemals wirklich unbekannten Variation menschlicher Zivilisation. Von Kultur kann nicht in jedem Fall gesprochen werden. Nach der ersten längeren Reise wird Fuller zu einem Objekt der wissenschaftlichen Begierde. Seine Erfindung wird bejubelt, er scheint ein gemachter Mann zu sein in einer Gesellschaft, in welcher alle Menschen, die ihn kennen, deutlich älter sind. Selbst seine ehemalige Freundin hat inzwischen einen neunjährigen Sohn, mit dem sich Fuller besser versteht als mit seiner Ehemaligen bzw. deren Mann. Haldeman beschreibt sehr gut, wie wenig sich Fuller gegen die Versuchung der Zeitmaschine, des absoluten Neubeginns wehren kann. Immer wenn ihm in einer Gesellschaft unwohl wird, drückt er den Knopf und ist mehrere Jahrzehnte in der Zukunft. Dabei landet er in einer technologiefeindlichen und religiösen Kultur – hier nimmt er sich aus Versehen eines Reisebegleiterin mit - genauso wie in einer seltsamen Zivilisation, bei der High Tech und einfachste Maschinen Hand in Hand zusammenarbeiten. Jede Landung ist für Fuller und seine Begleiterin ein kompletter Anpassungsprozess, dem sie sich immer widerwilliger unterwerfen. Kurz bevor die Sprungweite die Tausendjahregrenze überschritten hat, landet Fuller zumindest für einen Augenblick in einer paradiesischen Utopie. Haldeman hat sehr viel Spaß, H.G. Wells Geschichte auf den Kopf zu stellen. Der aufmerksame Leser braucht nur die Morlocks durch künstliche Intelligenzen ersetzen, welche zwar die Menschen nicht verspeisen, aber auf allen Sinnesebenen manipulieren. Der scheinbar „letzte“ Sprung führt Fuller und Martha nicht zu einer Art ultimativen Zukunft, aus welcher zum ersten Mal die Zeitreisenden auch rückwärts reisen können, sondern leicht vorhersehbar in eine Situation, in welcher sich Geschichte an sich und diese Geschichte per se mit einem sehr langen Anlauf wiederholen wird.
Betrachtet der Leser Haldeman “The Accidental Time- Machine” von seinem die eigentliche Pointe vorbereitenden Ende ausgehend leider der Roman an der Deus Ex Machina Prämisse, die auch in „Forever Free“ nicht wirklich funktioniert hat. Auch „Old Twentieth“ – ein Roman, in welchem Haldeman virtuelle Realität und passive Zeitreise mit einer Outer Space Saga verbindet – litt unter dem eher statisch und leider nicht befriedigenden Ende. Weder Fuller noch der Leser werden im Grunde mit befriedigenden Antworten konfrontiert und eine Reihe von Fragen, die Haldemans Protagonist im Verlaufe seiner zahlreichen Zeitsprünge aufgesammelt hat, bleiben frustrierend offen. Die Idee der Möbiusschleife ist folgerichtig, aber hinsichtlich der Komposition von fast achtzig Prozent des Romans wäre eine Hommage an Richard Mathesons „Die Geschichte des Mr. C“ mit einem ambitionierten und vor allem intellektuell provozierenden Ende sinnvoller gewesen.
Die verschiedenen Epochen, die Fuller besucht, sind im Grunde ein Schmelztiegel und Mikrokosmos der menschlichen Entwicklung. Insbesondere Haldeman kritische Auseinandersetzung mit jeglicher das Denken des Menschen behindernder Religion gipfelt schließlich in einer herrlichen Begegnung zwischen dem wieder auferstandenem Jesus – dessen erster Weg führte in der Legende nach ins Weiße Haus zum amtierenden Präsidenten – und Fuller. Da Haldeman ein sehr zeitkritischer Autor ist, impliziert er anscheinend, das es sich bei Fuller um eine Mischung aus Benjamin Button und Forrest Gump handelt. Nur beobachtet Fuller im Gegensatz zu den beiden sehr unterschiedlichen modernen Hollywood Ikonen nicht das Geschehen. Er wird immer wieder gegen den eigenen Willen zum Eingreifen gezwungen. Das beginnt mit einer grandios geschriebenen und an die Screwballkomödien insbesondere der dreißiger Jahre erinnernden Sequenz bei der Polizei und schließlich auch im Gefängnis und endet kurz vor der Gründung der M.I.T. Je mehr sich Fuller in den verschiedenen Zeiten zu integrieren sucht, um so deutlicher stößt ihn die jeweilige Epoche wie einen Fremdkörper wieder ab. Dabei reicht das Spektrum von klassischer Sozialkritik über die schon angesprochenen Exzesse bis zu einer autarken Kommunengesellschaft, deren Tauschprinzipien an eine Art futuristisches Ebay erinnern. Die Kürze des Romans lässt Fuller in verschiedenen Epochen viel zu kurz verweilen. Haldeman etabliert die wichtigsten Aspekte dieser Zeit, lässt Fuller in Schwierigkeiten geraten, aus denen nur der Knopfdruck und damit die Aktivierung der Zeitmaschine ihn retten können. Diese Vorgehensweise wirkt insbesondere im Mittelabschnitt unnötig schematisch, zumal sich die Menschen in den nächsten Jahrtausenden kaum von Fullers gegenwärtigen Mitmenschen wirklich unterscheiden. Der Hinweis, bei einer Reise in die Vergangenheit wäre die Verständigung unmöglich, ist eher Phrasendrescherei als eine wirklich überzeugende Argumentationsebene. Dabei unterscheiden sich die Kulturen durchaus beträchtlich, es sind die Nebenfiguren, die eher schematisch und teilweise mit zu wenig notwendiger Liebe zum Detail gezeichnet worden sind. Zu einem laufenden Gag wird die Tatsache, dass Fuller mit jedem Sprung mehr Ballast mitnimmt. Erst schickt er eine Schuldkröte auf Reisen, dann steigt er selbst in einen geliehenen Wagen mit einer Taucherausrüstung bekleidet, in einer Zeit gewinnt er eine treue Gefährtin und vor einem der letzten Sprünge nimmt seine Zeitmaschine etwas mit, was in der folgenden Sequenz a Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“ Serie erinnert. Stilistisch sehr ernst erzählt beschränkt sich der Humor ausschließlich auf die Dialoge.
Insbesondere der geborene Verlierer Matt Fuller entwickelt sich im Verlaufe der komplexen Reise eher rudimentär weiter. Im Grunde ein lebensuntüchtiger Theoretiker kann er sich zwar durch Glück und Verstand aus einigen schwierigen Situationen retten. Er lernt – schnell für den Leser, aber nicht den Charakter selbst erkennbar – die Liebe seines zukünftig vergangenen Lebens kennen. Die Chemie zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Menschen muss Haldeman ein schwer zu schwerfällig und emotional nicht immer überzeugend erschaffen. Fuller ist ein Charakter, der im Verlaufe der Geschichte seine inneren Widerstände erweitern, aber nicht wirklich überwinden kann. Als passive Hauptfigur ist er in dieser eher intellektuell- kritischen Stilübung genau richtig, als reiner Handlungsträger ist er zu schwach und eindimensional entwickelt. Der Leser hat bei der Aneinanderreihung seiner privaten Katastrophen kein echtes Mitleid. Haldeman bewegt sich zu Nahe am Rand des Klischees. Bis auf seine zukünftige Gefährtin Martha, die unscheinbar wie ihr bisheriges Leben entwickelt worden ist, ragt keine weitere Figur aus dem Plot heraus. Die Charakterisierung seiner handelnden Protagonisten gehört seit vielen Jahren zu Haldemans Schwächen, wobei er in „The Coming“ ausgezeichnet seine Fähigkeit unterstrichen hat, überzeugende und wirklich die Handlung tragende weibliche Figuren zu entwickeln und authentisch agieren zu lassen. Auf der anderen Seite hat er in "Camouflage" eine uralte Geschichte auf "Predator" Niveau nur etwas politisch aufgepeppt präsentiert. Wenn Haldeman wirklich an einen Stoff oder nur eine kleine Idee glaubt, ist er zu wirklich herausragenden Leistungen fähig.
Zusammengefasst ist „The Accidental Time- Machine“ sicherlich nicht Haldemans bester neuer Romane. Viele Schwächen aus dem überschätzten „Forever Free“ spiegeln sich auch im vorliegenden Band wieder. Auf der anderen Seite ist seit vielen Jahren niemand so überzeugend und frech zu gleich mit der Idee der Zeitreise und ihrer unmöglichen Gesetzlichkeiten umgegangen. Der Autor hat zielstrebig und hinsichtlich der theoretisch physikalischen Grundlagen überzeugend ein trotzdem amüsantes, lesenswertes und vielschichtig kritisches Werk geschrieben, das gesellschaftlich soziale Missstände in verschiedene Epochen der Zukunft intelligent, aber niemals belehrend extrapoliert.
TRASH & TREASURY
Beitrag Space and Haldeman von Thomas Harbach
vom 26. Mar. 2010
Weitere Beiträge
|
|
Eine kleine Welt neben der Eigenen
Thomas Harbach |
|
|
Meine Nachbarn, die Nazis
Thomas Harbach |
|
|
Space and Haldeman
Thomas Harbach |
|
|
Brian W. Aldiss- Leben eines schreibenden Engländers
Thomas Harbach |
|
|
Green for Science Fiction
Thomas Harbach |
| [Seite 1] [Seite 2] [Seite 3] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info