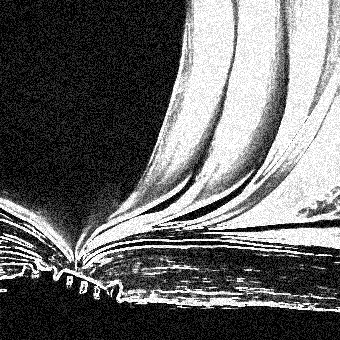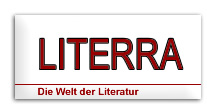
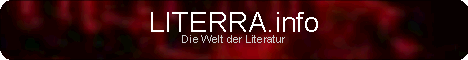
|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > TRASH & TREASURY > Green for Science Fiction |
Green for Science Fiction
Wie schnelllebig die Realität im Vergleich zur Science Fiction sein kann, demonstriert Ben Bovas Thriller “The Green Trap”. Der 2006 veröffentlichte Roman prognostiziert einen Ölpreis von USD 110 mit spürbaren Folgen für den privaten und industriellen Verbrauch, ein Aufflackern des Interesses für Alternativen Energien, zusätzlich das bekannte Szenario, das China und Indien immer mehr Energie verbrauchen und mächtige, sich freuende Ölkonzerne. In der Zwischenzeit hat der Ölpreis einen Rekordpreis von fast USD 160,– erreicht, um in der weltweiten Rezession auf unter USD50,– zusammenzubrechen. Zynisch gesprochen, ist Ben Bovas Vorhersage eingetroffen und wieder im literarischen Nebel verschwunden. Ähnlich ergeht es dem Leser beim vorliegenden Roman, der zwar geradlinig geschrieben worden ist und über einen stringenten, jedes Klischee mitnehmenden Plot verfügt, der aber vor allem unter den eindimensionalen und nicht überzeugend herausgearbeiteten Charakteren leidet.
College Professor Paul Cochrane erhält einen Anruf von seinem Bruder Mike, der behauptet, eine Erfindung gemacht zu haben, die ihm Millionen einbringen wird. Er bietet seinen Bruder, am Wochenende zu ihm zu reisen. Kaum ist Cochrane angekommen, wird die Leiche Mikes gefunden. Sein Computer ist gestohlen worden. Cochcrane ist schockiert, aber bereit, mit einer Agentin der Homsecurity zu schauen, ob er noch Unterlagen dieser weltbewegenden Forschung finden kann. Schnell stellt sich heraus, dass die attraktive Elena Sandoval eine Industriespionin ist, die sich natürlich in den älteren Forscher verliebt und das die Ölindustrie mit ihren schmutzigen Pranken alle Mittel in Bewegung setzt, um die Erfindung in den übergroßen Schubladen verschwinden zu lassen. Sie bedroht natürlich deren Existenz.
Wie konstruiert der Roman wirklich ist, lässt sich an verschiedenen Schwachpunkten leicht ablesen. Ben Bova stand in seinen Science Fiction Romanen immer für eine bodenständige und realistische Technik. Das er hier extrapoliert, das Wasserstoff die Energie der Zukunft sein könnte, wirkt unglaubwürdig. Um Wasserstoff zu trennen, ist mehr Energie notwendig als er erzeugen kann. Somit greift Bova auf Bakterien zurück, welche die Arbeit übernehmen könnten. Diese werden im Labor durch einen Zufall entdeckt, ohne das der Leser wirklich weiß, in welche Richtung Mike geforscht hat. Das es ausreichend Bakterien auf der Welt gibt, um das Erdöl zu ersetzen, erscheint zweifelhaft. Andere alternative Energiequellen erscheinen in dieser Hinsicht plausibler. Um seine These zu unterstützen, hat Ben Bova seinem an Kapitel nicht armen Roman authentische Artikel verschiedener Magazine hinzugefügt. Der Autor geht weder auf die Gefahren einer außer Kontrolle geratenen Bakterienkultur - siehe “Ill Winds” in dieser Kolumne - ein, noch wirkt seine Auflösung wirklich überzeugend. Selbst frei zugängliche Informationen im Internet könnten erstens patentiert werden, wenn wie in diesem Fall die Firma gekauft wird, in welchen Räumen die Erfindung gemacht worden ist und zweitens wäre Cochcrane insbesondere für Teile der Regierung ein wichtiges Druckmittel. Die grundlegende Idee, die Großindustrie als Hüter des kommerziellen Status Quo zu entlarven, ist solide, wird aber durch einen überdrehten Antagonisten - den Industriellen Gould -, der fast aus einem James Bond Film gesprungen sein könnte, negiert. Auch das Verhältnis zwischen Cochcrane und der attraktiven Elena wirkt zu keiner Zeit wirklich überzeugend. Nicht selten sind die Dialoge gestelzt und erscheinen unecht. Der Leser muss sich nur Paul Cochcranes Schicksal im vorliegenden Roman vorstellen: er verliert seinen Bruder, verliebt sich in eine attraktive Frau, lässt sich zehn Millionen Dollar entgehen, sucht den Mörder seines Bruders und ergibt sich schließlich fatalistisch seinem Schicksal. In Hinblick auf Elenas Situation ist es noch komplizierter. Im Nachhinein erfährt der Leser, dass der Roman im Grunde nach wenigen Seiten zu Ende sein könnte. Die Suche nach dem Mörder seines Bruders führt Paul erst zu dessen Forschung. Eine Spur, die er ohne Elenas nicht selbstlose Hilfe niemals gefunden hätte. Auf der anderen Seite hätten sich die potentiellen Antagonisten einfach auf Paul Cochcrans Spur setzen müssen, um die fehlende Kopie dieser Unterlagen zu erhalten. Wenn sich am Ende des Buches der Kreis schließt, negiert Bova die wenigen sympathischen Züge seiner Charaktere. Unabhängig davon wirkt die Liebesbeziehung zwischen den beiden Protagonisten nicht nur aufgesetzt, sondern klischeehaft unecht. Das Ende ist vorhersehbar, da Bova jedes potentiellen Verdächtigen teilweise ohne plottechnische Not ausschaltet und sich dank des Ausschlussprinzips der Mörder von selbst ergibt. Und darüber hinaus dauert es nicht nur einmal einige Seiten, bis Paul Cochcrane gedanklich wieder auf Augenhöhe der Leser ist.
Als Thriller ist “The Green Trap” ebenso eine Enttäuschung wie als Verschwörungsstudie. Bova arbeitet zwar die vermeintlich egoistischen Ziele insbesondere der Ölkonzerne heraus, vergisst allerdings zu erwähnen, das zum Beispiel die Araber seit vielen Jahren Gelder für die Entwicklung alternativer Energien ausgeben, um nach Versiegen des Öls weiterhin Geld zu verdienen, das in diesem Jahr große neue Ölfelder vor den Küsten Brasiliens gefunden worden sind, das eine globale Rezession die bisherigen Trendrechnungen ad absurdum führt und das globale Player schon nicht mehr alleine von eitlen Psychopathen geführt werden, die sich in entscheidenden Augenblick so dumm anstellen. Das hübsche Industriespione in erster Linie ihren Körper einsetzen und sich trotzdem gegen den Begriff der Hure wehren, ist die Wunschvorstellung eines alten Mannes, dessen letzte Romane leider allzu deutlich zeigen, das Ben Bova augenscheinlich seinen Zenit als Schriftsteller überschritten hat. Zurück bleibt leider nach der Lektüre dieses Torsos nur noch das Gespür für Themen, welche auf der Höhe der Zeit sind.
In „Illwinds“ gehen die beiden Autoren Kevin J. Anderson und Doug Beason einen Schritt weiter als Ben Bovas Kritik an der allmächtigen, aber auf einen größenwahnsinnigen Despoten klassischen Energieindustrie. Es ist ein Unfall, der die auf Öl und deren Verarbeitung basierende Zivilisation zumindest in den USA zerstört. Mit ihrer insgesamt dritten Kooperation weisen die Autoren auf einige Fehler im System hin, auch wenn insbesondere der Anfang des Buches sehr melodramatisch ist. Ein egoistischer Kleinkrimineller sorgt für einen GAU in der Bucht von San Franzisko. Ein Supertanker kollidiert mit den Fundamenten der Golden Gate Bridge und versinkt schließlich in der Bucht. Millionen von Litern Rohöl strömen in die Bucht.
Sehr viel effektiver wäre es gewesen, den Supertanker aufgrund eines Computerfehlers oder eines anders artig gestalteten Unfalls stranden zu lassen. Der Schurke taucht im Verlaufe des Buches mehrmals als Opportunist auf. Begegnet noch einmal in einer gut geschriebenen Szene dem Kapitän des Tankers und wird am Ende des Romans natürlich auf barbarisch primitive Weise für seine Untaten bestraft. Unmittelbar nach dem Tankerunfall kann er sich von Bord absetzen und hinterlässt eine verseuchte Bucht. Mittels eines bislang nur in den Laboratorien getesteten Bakteriums soll dieser Seuche Einhalt geboten werden. Allerdings fangen plötzlich in der Umgebung auch Automotoren an zu streiken. Anscheinend greift das Bakterium alle Polymere an, die im Entferntesten mit Öl in einem Zusammenhang stehen. Von dieser durchaus glaubwürdigen Prämisse ausgehend beschreiben die Autoren eine Großmacht, die sich wieder auf den Pioniergeist seiner Mitbürger verlassen muss, während die Versuche der Politiker und Militärs von Beginn an zum Scheitern verurteilt sind und das Land nicht zusammenhalten können. Anderson und Beason verzichten auf eine Beschreibung der Folgen für die Weltwirtschaft. Es gibt zwar einigen Hinweise, dass zum Beispiel der amtierende amerikanische Präsident im Nahen Osten ermordet wird und das amerikanische Militär aus nicht näher definierten Gründen zuschaut. Das war´s. Immerhin dauert es seine Zeit, bis das Bakterium durch die Laufübertragung sich mehr und mehr gen Osten ausbreitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest verschiedene Waffensysteme auf den Basen in Übersee noch funktionieren, ist relativ groß. Allerdings wird diese Karte nicht gespielt. In erster Linie beschreiben sie die Folgen dieser ökologischen Doppelkatastrophe – erst die Verseuchung und dann das bakteriologische Desaster – aus der Perspektive sehr unterschiedlicher Charaktere. Dabei reicht das Spektrum vom Klischee bis zu dreidimensionalen Protagonisten. Zu den überzeugendsten Figuren gehört der Wissenschaftler Alex Kramer, welcher im Auftrag der Ölfirma Oilstar das Virus erfunden hat, um die Welt vor den Auswirkungen von Ölverschmutzungen zu schützen. Sein Sohn ist in einem der Ölkriege – der einzige Hinweis, das der Roman nicht hier und heute spielen könnte, ums Leben gekommen, seine Frau und Tochter bei einem Verkehrsunfall. Kramer erscheint als seriöser Forscher, der von dem Schmerz um seine Familie wie betäubt ist. In keiner Szene macht er einen psychopathischen Eindruck und doch handelt es sich bei den Mikroben, die schließlich gegen das kurz zuvor erlassene Verbot gesprüht werden, um bösartige Verwandte des eigentlich unschädlichen Virus. Und deren Verbreitung ist Teil eines minutiös vorbereiteten Plans.
Todd Severyn ist ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen, der den Auftrag erhält, nach dem Sinken des Tankers aufzuräumen. Er ist auf der einen Seite ein moderner Cowboy, der immer für die Ölindustrie gearbeitet hat, auf der anderen Seite ein schüchterner Pragmatiker, der sich zum ersten Mal in die Mikrobiologin und Chemikerin Iris Shikozu verliebt, die das verfälschte Virus aufgrund der gefälschten Voraussetzungen freigegeben hat. Im Verlaufe des Buches sind es die Prototypen der amerikanischen Pioniere, die positiv aus dem Roman herausragen. Dagegen sind insbesondere die gewichtigen Antagonisten eher eindimensional und farblos gezeichnet. Da ist der Regierungssprecher, der sein Amt als Lobbyist missbraucht und am liebsten die Journalistinnen erst ins Bett zerrt, bevor er Interviews gibt. Er wird – weil niemand anders da ist – Präsident der USA und scheitert schließlich überfordert an seinen Beratern, die davor zurückschrecken, das eigene Land mit Atombomben zu überziehen, um den Mob unter Kontrolle zu bringen. Air Force General Ed Bayclock – ein Schreibtischoffizier – dagegen ist ein Patriot, der mit einem Schreckensregime, dem Kriegsrecht und Hinrichtungen als Abschreckungen das Land wieder unter Kontrolle zu bringen sucht. In der entscheidenden Konfrontation mit den Kräften des Guten unterliegt er schließlich wie es sich gehört im Duell Mann gegen Mann. Obwohl Anderson und Beason in ihrer Geschichte vom rasanten Zerfall einer industriellen Wirtschaftsmacht und dem nachfolgenden Wiederaufbau auf sehr primitiven Niveau manches Klischee in den Plot einfließen lassen, spielen sie fair mit dem Leser. Trotz der patriotischen Obertöne wird der Plot nicht pathetisch oder kitschig. Unabhängig von den marodierenden Banden und den mit aller Brutalität regierenden Militärs fordern die beiden Autoren die Leser immer wieder zum Nachdenken und vor allem auch Überdenken des Status Quo auf. Eine Alternative wären kleine Sonnenkollektoren, um die schließlich der Kampf entbrennt. Es spricht für die beiden Autoren, das sie diese Technik nicht als Deus Ex Machina missbrauchen. Interessant ist vielmehr, wie sich sehr unterschiedliche Charaktere wie der mitverantwortliche Kapitän des Öltankers oder ein auf den Boden verbannter Air Force Pilot in dieser Extremsituation verhalten und mit der Aufgabe wachsen. Trotz einer Reihe von Schwächen –insbesondere der Mittelteil ist ein wenig zu statisch und zu unentschlossen – handelt es sich bei „Ill Winds“ um eine der besseren Post Doomsday Geschichten. Sie ist zehn Jahre nach ihrem Erscheinen eine Wiederentdeckung wert.
Ob es Zufall oder Absicht ist, lässt sich wahrscheinlich nicht eruieren. Auf jeden Fall positioniert sich Kim Stanley Robinson mit seiner Trilogie um einen drastischen Klimawandel als Anti Michael Crichton. Crichton argumentiert in seinem auch auf Deutsch veröffentlichten Roman „State of Fear“, dass der Klimawandel unter anderem auch aus kommerziellen Gründen ganz bewusst medientechnisch ausgeschlachtet wird, während Crichton hinsichtlich der Änderungen der Großwetterlagen von einem „natürlichen“ Kreislauf spricht. Auch Kim Stanley Robinson konzentriert sich in seiner Trilogie von Büchern auf Lobbyisten, Opportunisten und Warner. Er zeigt insbesondere im ersten Roman „Forty Days of Rain“ seiner Trilogie auf, wie die gegenwärtige Politik argumentiert und funktioniert. Und wie Wissenschaftler mit beschränkten Budgets und ängstlichen Vorgesetzten im Grunde gar nicht frei in alle Richtungen forschen können. Frank Vanderwal – einer der wichtigsten Charaktere der ganzen Trilogie – bringt diese unbequeme, von Robinson aber nicht durch Alternativvorschläge unterlegte Wahrheit ans Tageslicht. Er kündigt seine hohe Position bei der National Science Foundation in Washington, weil er der Ansicht ist, dass die Wissenschaftler ihre Budgets bestimmen sollen, um entsprechende Forschungsergebnisse erzielen zu können. Sie sollten nicht auf Vorschläge reagieren bzw. in die Tat umzusetzen suchen. Die ganze Wissenschaft besteht nur aus Lobbying, während die eigentliche Aufgabe einer Regierung, Forschungen in bestimmte Richtungen zu fordern und dementsprechend auch zu unterstützen auf der Strecke bleibt. Im übertragenen Sinne ist das Problem der globalen Erwärmung und eines möglichen Klimawandels für viele Forscher zu abstrakt. Sie kommunizieren nicht untereinander, sondern befinden sich wie die kapitalistische Wirtschaft in einem nicht immer fairen Wettbewerb um ein sehr begrenztes Gut: die Förderung. Der Mann zwischen allen Stühlen Frank Vanderwal wird teilweise von Robinson als Charakter zu überzogen dargestellt. Seine inneren Monologe, die verschiedene Positionen für den Leser gut nachvollziehbar gegenüberstellen, wirken zu breit. Das Spektrum reicht von den Affen, die gerade den Baum verlassen haben und das Nest rücksichtslos verschmutzen über die Spieltheorien bis zu rein grünem Gedankengut. Der Leser darf allerdings nicht den Fehler machen, in Vanderwal den klassischen Protagonisten, den „Helden“ der Geschichte zu sehen. Er ist eine ambivalente Persönlichkeit, die plötzlich aus ihrem bisher sicheren und gut bezahlten Umfeld gerissen wird. Plötzlich fühlt er sich von Geheimdiensten verfolgt und beginnt die Kontrolle über sein persönliches Leben schneller zu verlieren als es ihm lieb ist. Im Verlaufe des Plots begegnet Vanderwal einer geheimnisvollen Frau, die viel mehr von der geheimnisvollen und geheimen politischen Bühne hinter den Kulissen weiß als es Vanderwal und einigen anderen Politikern lieb ist. Natürlich verliebt sich Vanderwal in die Frau. Die Romanze gehört vielleicht zu den sperrigsten Passagen des Romans, sie wirkt aufgesetzt und wird halbherzig beschrieben. Viel interessanter ist der Hintergrund des Buches. Immer mehr zeichnet sich ab, das das Klima einen „Point of No Return“ erreicht, an dem die Veränderungen vom Menschen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Um dieses Argument bildlich herauszustellen, endet der Roman tätlich mit einem vierzig Tagen andauernden Regen, der ausgerechnet die Hauptstadt Amerikas unterspült und im Chaos zurücklässt. Dieses Bild ist wahrscheinlich ein wenig zu kräftig, zu pathetisch gezeichnet, aber hinsichtlich der Botschaft Robinsons ungewöhnlich effektiv. Immerhin ist Washington nur zehn Fuß über dem Meeresniveau auf einem Sumpf aufgebaut worden. Im Vergleich zu anderen beiden Romanen der Trilogie beginnt das Buch ein wenig schwerfällig. Die verschiedenen Argumente müssen gegenüber gestellt werden. Beispielhaft unterstreicht der Autor die irrationale Verteilung der Fördergelder. Ein Mathematiker könnte mit seinen Theorien auf dem Gebiet der Genforschung für entscheidende Durchbrüche sorgen. Anstatt ihn weiter zu fördern will Vanderwal ihn in die Hände der privaten Biotechnologiefirmen treiben, die zum Nutzen des eigenen Aktienkurses und auf längere Sicht der eigenen Brieftasche dessen Forschungen unter den Tisch fallen lassen. Diese Menschenverachtende Macht- und Geldverteilung entlarvt Robinson, um im letzten Band der Trilogie einen Präsidenten zu etablieren, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit Präsident Obama besitzt. Das Etablieren von Robinsons Prämissen braucht trotz des über der Menschheit hängenden Damoklesschwertes der globalen Klimakatastrophe sehr viel Raum. Wer sich für Politthriller interessiert, wird diese Ränkespiele sehr faszinierend finden. Wer die politischen Zwischentöne gerne mit Handlung unterlegt goutiert, wird sich im vorliegenden ersten Band in Geduld fassen müssen. Das letzte Drittel des geradlinig geschriebenen und von realistischen, aber nicht sympathischen Charakteren bestimmten Romans gehört allerdings zum Besten, was Kim Stanley Robinson in den letzten Jahren geschrieben hat. Die Atmosphäre ist nihilistisch, der Spannungsbogen gewinnt plötzlich an Format und Beschreibung der Sinnflutartigen, der an ein Gottes Gericht erinnernden Regenfälle ist ungewöhnlich packend. Zum Wohle des Buches verzichtet Robinson auf das große Moralisieren. Vanderwal ist ein zu opportunistischer Charakter, der eher durch Tatsachen als eigene Überzeugung bekehrt wird. Geschickt versucht der Autor diese innere Wandlung auf den Leser zu übertragen. Dieser einfache literarische Trick funktioniert rückblickend erstaunlich gut. Alle Gegenvorschläge bzw. Versuche, den drohenden Klimaumsturz zu verhindern, sollen aus den Budgets der Militärs bezahlt werden. Dass diese Vorstellungen einigen erzkonservativen politischen Kräften mehr als graue Haare bereiten, versteht sich von selbst. In den nächsten beiden Bänden der Trilogie schreitet nicht nur die Klimaveränderung teilweise sehr drastisch voran, sondern ein neues politisches Gewissen wendet sich den nicht mehr zu leugnenden ökologischen Problemen aktiv zu.
Obwohl der erste Band der Serie mit seinem dunklen Ende schon die Grundlage für die beiden weiteren Bücher der Trilogie gelegt hat, gibt sich Kim Stanley Robinson in der sehr langen, von der Erklärungsseite gut verständlichen, aber hinsichtlich ihrer plottechnischen Strukturierung Geduld vom Leser erfordernden Exposition her sehr viel Mühe, die wissenschaftlichen Grundlagen für die „Tipping Points“ noch einmal zu definieren. Diese Tipping Points sind die schmalen Grade, nach deren Erreichen der Klimahaushalt der Erde unumkehrbar mit fatalen Folgen für Flora, Fauna und den Menschen kippt. Im ersten Band der Serie konnten sich die Menschen einen ersten Eindruck von diesen Punkten machen, als ein gewaltiger Regen schließlich große Teile der USA überflutete und das geordnete Leben in der Hauptstadt Washington unmöglich machte. Ein weiterer Punkt dieser folgenschweren Kette ist der Golfstrom. Nur eine Verlagerung um wenige Grade würde es unmöglich machen, das Europa sich noch selbst versorgt bzw. Menschen in weiteren Teilen des Kontinents leben und überleben können. Zu viel polares Wasser mit seinem geringeren Salzgehalt könnte schon ausreichen. Polarwasser, das aufgrund der schmelzenden Pole mehr und mehr nach Süden dringt. Frank Vanderwal ist freier, aber wichtiger Zuarbeiter der National Science Foundation und untersucht dieses Phänomen. Als dieser Strom das letzte Mal gen Süden abgedrängt worden ist, versank die nördliche Halbkugel unter der letzten Eiszeit.
Im zweiten Band der Serie dreht Kim Stanley Robinson sehr effektiv weiter an der Schraube von möglichen Klimakatastrophen. Alleine die Spekulationen um die fatalen Folgen eines derartigen Wetterumschwungs sorgen normalerweise für ausreichend spannende Elemente in einem Roman. Im ersten Band hat Kim Stanley Robinson erstaunlich effektiv mit dreidimensionalen Figuren bewiesen, wie spannend das Wetter an sich sein kann. Im vorliegenden Band versucht er im Grunde ohne Not diesen Handlungsbogen noch um einen politischen Thriller zu erweitern. Trotz aller politischen Ränkespiele und Intrigen wirkt diese Idee im Vergleich zu ganzen Roman wenig effektiv und stellenweise sogar klischeehaft aufgesetzt. Auf der politischen Ebene ist sehr interessant, wie Frank Boss Diane - eine attraktive Frau in einer unglücklichen Ehe - mit dem Kongress streitet, um weitere Mittel zur Untersuchung des Phänomens zu erhalten. Sehr nah am augenblicklichen Zahn der Zeit stellt Robinson nicht polemisch, aber doch parteiisch die beiden Positionen der Großindustrie/ Politik und der bodenständig vernünftigen Naturschützer gegenüber. Viel interessanter und spannender ist allerdings die Handlungsebene, in welcher der Leser mit Frank zusammen in der von der Regenflut gezeichneten Natur um Washington herum Tiere untersucht und im Naturpark zu leben versucht. Kim Stanley Robinsons Protagonisten gehören sicherlich zu den freiwillig oder unfreiwillig sportlichsten Akteuren eines Genreautors. Nur selten bewegen sie sich nicht. Mit leichter Ironie parodiert Robinson das typische Verhalten der Menschen im Fitnessstudie und stellt es in einen schockierend krassen Kontrast zum Überleben in der Wildnis. Diese kleinen Nuancen bilden die erste Hälfte des Romans und trotz der verschiedenen Handlungsebenen hat der Leser ausreichend Zeit, um sich ein Bild von ihnen zu machen. Bis zur Mitte des Buches deutet Robinson die aufziehende Katastrophe nur an, um dann wie im ersten Band der Serie sehr authentisch und vor allem realistisch die einzelnen Veränderungen Schlag auf Schlag aufzuzeigen. Über Franks persönliche Story bis zur vorläufigen, wenn auch akzeptablen Lösung wird der Zuschauer in die Katastrophe mit einbezogen und verfolgt die Entwicklung im Grunde aus der ersten Reihe. Dabei liegt es Robinson nicht, Millionen von Opfer zu entwürdigen, sondern an einzelnen, persönlichen Beispielen zeigt er die fatalen Folgen dieser Entwicklung auf. Der Zuschauer hat die Möglichkeit, die einzelnen „Wegweiser“ dieser Todesstrecke in der Gegenwart schon zu erkennen. Wie so oft erkennen es die einzelnen Forscher im Gegensatz zum Protagonisten zu spät, im Gegensatz allerdings zu Emmerichs populistischem „Day after Tomorrow“ bemüht sich Robinson immer, möglichst nahe an den wettertechnischen Extrapolationen zu bleiben und nicht plötzlich einen Abenteuerroman zu schreiben. Darum ist „Fifty Degrees below“ kein zufrieden stellender Thriller, sondern wirkt eher wie eine These, die mit vielen Forschungsergebnissen untermauert den Leser in seinen Grundfesten erschüttern soll. Im Vergleich zum ersten Band ist der vorliegende Roman literaturtechnisch ein wenig zu glatt, zu solide konstruiert. Ihm fehlt die raue provozierende Energie der zweiten Hälfte des ersten Buches, dafür kann er seine Grundlage besser in Worte statt in bittere Bilder packen. Unabhängig davon werden viele Ansätze aus dem ersten Band sehr gut weiter extrapoliert und sollten eigentlich im letzten Band der Trilogie kumulieren.
In „Sixty Days and counting“ sind die aus den ersten Büchern bekannten Figuren nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl in Schlüsselpositionen der Macht alter sowie neuer Prägung angekommen. Robinson kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen, in dem er in seinem Buch einen ökologisch engagierten Mann Phil Chase dank einer kleinen Wahlmanipulation ins mächtigste Amt des Planeten wählen lässt. Mit Phil Chase greift Robinson einer Persönlichkeit wie Obamha ein wenig voraus. Chase erscheint ehrlich und offen, ist ein dynamischer Entscheider, der unabhängig von wirtschaftlichen Interessen den Erwärmungsprozess unseres Planeten stoppen möchte. Im Mittelteil der Trilogie konnte zumindest eine ökologische Katastrophe abgewandt werden, aber die Uhr tickt natürlich weiter auf den Point of No Return zu. Immer wieder werden Referenzen zu den amerikanischen Verteidigungsbudgets gemacht. Wie viele andere Menschen unterschätzt Robinson die Wandlungsfähigkeit der Politik, wenn ein Notstand ausgebrochen ist. Siehe die Schäden von Katrina, siehe auch die unglaublichen Summen, welche zur Zeit den Banken zur Verfügung gestellt werden. In einer weiteren ironischen Bemerkung vergleicht der Autor als übergeordneter Erzähler die Welt nach einem Attentat auf den Präsidenten als Mischung aus “West Wing” und “E.R.” Mit dieser Bemerkung liegt der Autor unbewußt nicht verkehrt. Anstatt sich alleine auf die Kraft seiner ökologischen Thesen und dem frustrierenden Ringen um eine einvernehmliche Lösung gegen die Betonklötze der Welt zu konzentrieren, integriert Robinson noch eine Verschwörungstheorie, in welche ausgerechnet der schwerkranke und ein wenig naive Präsidentenberater Frank Vanderwal stolpert. Sehr viel ansprechender ist der Zwiespalt in Charlie Quibler dargestellt, der zusammen mit seinem kleinen Sohn nach Washington zieht, um ganztägig für den Präsidenten zu arbeiten. Im Gegensatz zur Actionstory verzichtet der Autor hier auf kitschige Szenen und beschreibt einen Mann, der sich der Größe seiner Aufgabe bewusst ist und trotzdem seinen Sohn als sehr wichtig betrachtet. Je weiter die Geschichte voranschreitet, wird es unabhängig von den zu wälzenden ökologischen Problemen - andere kommen erstaunlicherweise nicht vor - zur Geschichte einer Handvoll Männer und Frauen. Zu den Stärken des Buches., im Grunde der ganzen Trilogie gehört Robinsons Fähigkeit, diese Politiker sehr sympathisch, sehr menschlich zu beschreiben. Er kritisiert nicht das fiktive Vorgehen seiner Protagonisten oder schlägt ausschließlich kritische Bögen zu den aus seiner Sicht versagenden realen Politikern. Seine drei Romane bestehen aus einer Aneinanderreihung von teilweise sehr spektakulären Alternativen. Das beginnt insbesondere im letzten Band der Trilogie mit dem “Volllaufen” von brachliegenden Wüsten, in welche das immer weiter steigende Meerwasser umgeleitet werden soll. Und es endet mit der positiven Nutzung atomarer Reaktoren der amerikanischen Marine. Aber erstaunlich pragmatisch geht der Autor mit einigen seiner Ideen einen konsequenten, wenn auch unbequemen Schritt weiter. Das zeichnet diesen dritten Band im Vergleich zu den ersten beiden Büchern der Trilogie aus. Beispielhaft werden viele grüne Leser die Hände über den Köpfen zusammenschlagen, wenn Robinson ernsthaft vorschlägt, kurzzeitig sollen die amerikanischen Militärs Atomreaktoren bauen und betreiben, da sie es erstens effektiver als die Privatwirtschaft können und zweitens besser auf ihre Anlagen aufpassen. Aber mit solchen Ideen will der Autor zum Nachdenken provozieren. Nicht umsonst finden sich immer wieder Hinweise auf den buddhistischen Glauben, dessen Stellvertreter auf Erden das aus ihrer Sicht absurde Treiben der zivilisierten Menschen mit einem spöttischen Lächeln begleiten. Weiterhin bietet Robinson seinen Lesern keine endgültigen Lösungen, keine Heilsbringer und vor allem keine Erlösung von der Umweltverschmutzung an. Der Roman endet zwar auf einer vorläufig optimistischen Note und einem teilweise doch ein wenig bemühten Happy End, aber der Autor lässt keine Zweifel aufkommen, dass der Weg noch deutlich steiniger werden wird. “Sixty days and counting” ist in mehrfacher Hinsicht ein ungewöhnliches Buch: es ist kein Thriller im klassischen Sinne. Es ist die Entwicklungsgeschichte einer Handvoll Männer, die sich nach langen mehr oder minder erfolgreichen Kämpfen in den Positionen befinden, um etwas zu ändern. Wie sie mit dieser Verantwortung umgehen, wie es sie selbst verändert und welche Konsequenzen sie aus den Herausforderungen ziehen bildet den Kern des lesenswerten Buches. Der zweite Band “Fifty Degrees Below” ist sicherlich hinsichtlich der Plots der griffigste, klassische Roman, der Auftaktband “ Forty Signs Of Rain” insbesondere augrund seiner dunklen, prophetischen Atmosphäre der am ehesten packende Text, aber aufgrund seiner Charaktertiefe und vor allem seiner Ideenvielfalt ist “Sixty Days and counting” intelligent wie auch vielschichtig. Robinson hat in Interviews diese Capital Code Trilogie als komisch bezeichnet. Die Inhalte der einzelnen Bücher stecken voll schwarzem, subversivem Humor. Am Ende erkennt der Leser, dass er sich aufgrund der Art, wie er sein Leben insbesondere in Hinblick auf das Ganze lebt, den grundlegenden ökologischen wie wirtschaftlichen Fragen selbst stellen muss. Zumindest zwischen den Zeilen fordert Robinson seine Leser auf, nicht auf so gute Politiker und wissenschaftliche Berater zu hoffen, wie er sie für seine noch utopischen Bücher erschaffen hat.
TRASH & TREASURY
Beitrag Green for Science Fiction von Thomas Harbach
vom 06. Feb. 2009
Weitere Beiträge
|
|
Eine kleine Welt neben der Eigenen
Thomas Harbach |
|
|
Meine Nachbarn, die Nazis
Thomas Harbach |
|
|
Space and Haldeman
Thomas Harbach |
|
|
Brian W. Aldiss- Leben eines schreibenden Engländers
Thomas Harbach |
|
|
Green for Science Fiction
Thomas Harbach |
| [Seite 1] [Seite 2] [Seite 3] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info