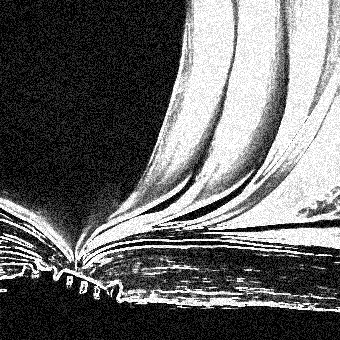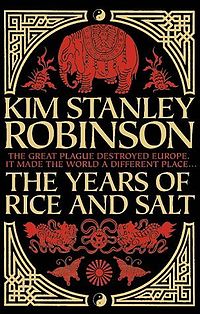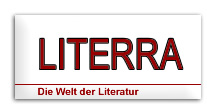
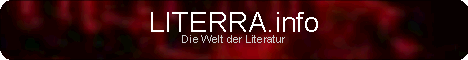
|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > TRASH & TREASURY > Eine kleine Welt neben der Eigenen |
Eine kleine Welt neben der Eigenen
Adam Roberts “Yellow Blue Tibia”
Schon mit seinem ersten Science Fiction Roman “Salt” hat der 1965 in London geborene Adam Roberts unterstrichen, das es ihm gelingt, die bekannten Space Opera Konzepte sowohl auf einer emotionalen wie auch auf der intellektuellen Ebene aufzufrischen und kompakte, intelligente und mehrschichtige Romane zu präsentieren. Dabei spielt es im Grunde keine Rolle, ob seine Protagonisten Massenmörder sind, die besiedelten Planeten sich als unwirtliche Welten präsentieren oder die bekannte Welt einfach an einer im übertragenen Sinne gigantischen „Wand“ hängt. Neben diesen markanten Hard Science Fiction Romanen hat sich Adam Roberts als Parodist etabliert, der neben den üblichen Zielen wie „Star Wars“ oder den verschiedenen Tolkienwerken auch Dan Browns „Da Vinchi Code“ oder den britischen Fernsehdauerbrenner „Doctor Who“ aufs Korn genommen hat. Mit seinem im Jahre 2009 veröffentlichten Roman „Yellow Blue Tibia“ versucht Adam Roberts gleich verschiedene Subgenres – Alternativwelten, Außerirdische Bedrohungen und den klassischen Kalten-Krieg-Thriller – in einen mit einem ironischen Unterton sowie in der plottechnisch ausgesprochen ungewöhnlichen Ich- Perspektive geschriebenen Roman zu verpacken. Dabei verbindet der Autor am Rande des guten Geschmacks angesichts der realen Opfer zwei technische Tragödien – die „Challenger“ Katastrophe wie auch den Unfall im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl –mit einer phantastischen Geschichte von außerirdischen Invasoren und vor allem der Paranoia der kommunistischen Führung nach dem Zweiten Weltkrieg, die als Ersatz für die besiegten Nazis ein neues Feindbild brauchten, um die mögliche Unzufriedenheit der eigenen Bevölkerung angesichts der wirtschaftlich katastrophalen Verhältnisse im Zaum zu halten.
Im Mittelpunkt des Romans – dessen eigentlichen Ende nach zweihundert Seiten zu finden sein sollte, wobei der rettende ärztliche Engel erst zwanzig Seiten später auftritt, wie Roberts Alter Ego den Leser an die Struktur einer fiktiven Geschichte erinnernd aufmerksam macht – steht Konstantin Skvorecky, der im großen vaterländischen Krieg sich durch Tapferkeit vor dem Feind ausgezeichnet hat. Die Berichte der Kämpfe an der Front bleiben dem Leser länger im Gedächtnis als andere Plotelemente des Buches. Zusammen mit fünf anderen russischen Science Fiction Autoren wird er 1946 in eine abgelegene Datscha eingeladen, wo sie Joseph Stalin persönlich begegnen. Unter größter Geheimhaltung sollen sie eine außerirdische Bedrohung „erfinden“, welche das russische Volk gegen den imaginären Feind zusammenschweißt. Stalin sieht nicht im dekadenten Amerika – das wird es in fünf Jahren seiner Ansicht nicht mehr geben – den größten Feind des Kommunismus und vor allem ist Amerika für den einfachen russischen Bauern zu weit weg, um eine ähnliche Bedrohung wie die Nazis darzustellen. Die fünf Autoren entwickeln die Idee einer auf Radioaktivität basierenden Rasse, die erst eine amerikanische Rakete zerstören und dann die Ukraine mit einer modernen Atombombe attackieren. Bevor sie ihren fiktiven Berichtsroman beenden können, wird die Gruppe aufgelöst, die einzelnen Mitglieder zum Schweigen unter Androhung der Todesstrafe eingeschworen und ihre Arbeit bei einer geheimen Behörde archiviert. In den nächsten vierzig Jahren sterben einige Mitglieder der Gruppe eines natürlichen Todes, während sich Konstantin Skvorecky als Gelegenheitsübersetzer für diverse Behörden über Wasser hält. Er ist inzwischen ein hoffnungsloser Alkoholiker geworden. Kurz nach der Challengerkatastrophe – in Adam Roberts Roman bezeichnen die Russen den Raumgleiter weiterhin und anachronistisch als Rakete – übersetzt Skvorecky das Einreisevisum für zwei Mitglieder der Scientology Kirche. Der eine Amerikaner James Tilly Coyne scheint ein größeres Interesse an Nukleartechnologie zu haben. Vor allem an der Atomanlage Tschernobyl in der Ukraine. Noch unwissend trifft Skvorecky auf einen seiner ehemaligen Schriftstellerkollegen aus der Gruppe – der einzige Nichtrusse Frenkel -, der für eine geheime Behörde arbeitet. Er behauptet, das ihre damaliger Fiktion inzwischen Realität geworden ist und Außerirdische den amerikanischen Raumgleiter abgeschossen haben. Als Nächstes stünde ein Anschlag auf den vierten Reaktor Tschernobyls auf der Agenda. Skvorecky hält Frenkel für verrückt, aber als vor seinen Augen der Amerikaner Coyne von Geisterhand in die Luft gehoben und aus großer Höhe fallen gelassen wird, mehren sich die Zweifel. Anscheinend muss er zusammen mit einem unter einem schweren Asperger Syndrom leidenden Taxifahrer/ Nuklearwissenschaftler und der zweiten Amerikanerin selbst in Tschernobyl nach dem Rechten sehen, während der KGB die Fahndung nach ihm ausgeschrieben hat.
Im Gegensatz zu seinen sehr dunklen, fast nihilistischen Hard Science Fiction Romanen ist „Yellow Blue Tibia“ von einem feinen, ironischen Humor durchdrungen, der abgeschwächter als in seinen Parodien, weniger an die Plattitüden einer Sergej Lukianenko, sondern an der russischen Meister der Phantastik Bulgakov erinnert. Sowohl Roberts wie auch Bulgakov haben in den Auftaktkapiteln ihrer Werke die jeweilige russische Gegenwart aus der Perspektive ihrer Charaktere verfremdet und grotesk übertrieben dargestellt. Während Lukianenko seine „Wächter“ Tetralogie nutzte, um seinen Landsleuten ihre konsequente und wenig durchdachte Anpassung an die westliche Exzesse unter die Nase zu reiben, macht Adam Roberts sehr schnell klar, das weder der Kapitalismus als System der jungen, hungrigen Männer noch der Kommunismus als Regierungsform der Alten wirklich ideal sind. Sie werden beide von menschlichen Schwächen beherrscht. Im Gegensatz zu Bulgakov oder Lukianenko ist dem Leser aber in den ersten Kapiteln des vorliegenden Buches nicht klar, ob die „normale“ Realität – die der westlich erzogene Leser ja nicht kennt – wirklich vom Einfluss unsichtbarer, radioaktiver, außerirdischer Invasoren impliziert manipuliert worden ist, wie der Ich- Erzähler suggeriert oder ob es um die ersten Spuren einer aufkommenden Demenz, eines Altersstarrsinn oder Halluzinationen eines Gewohnheitstrinkers handelt. Diese Ambivalenz durchzieht weite Teile des Romans, in denen die einzelnen Facetten für sich isoliert betrachtet überraschen, schockieren oder gut unterhalten. Sie bilden aber ein homogenes Gesamtbild, was sicherlich irgendwie im Sinne des Autoren gewesen ist, alleine ihm fehlen die schriftstellerischen Ausdrucksmittel. Als reine Satire auf die immer noch gegenwärtige polizeistaatliche Gewalt, die Korruption und den rücklichtslosen Opportunismus durch den möglichen Einfluss außerirdischer Mächte verzerrt funktioniert das mit viel Liebe zum Detail gezeichnete Bild eines sterbenden Väterchens Russland – von der eigenen Bevölkerung mehr geliebt als den Politikern – ausgesprochen gut. Die eindrucksvolle Warnung vor dem falschen Bild Russlands findet sich in einer kurzen, endrucksvollen Dialogpassage gleich zu Beginn des Buches, in der einer der Science Fiction Autoren von der harten Strafe berichtet, die er erhalten halt, weil er in seiner Kurzgeschichte den Familienzusammenhalt über kapitalistische Verführungen gestellt hat.
Ob es der Tatsache entspricht, kann leider nicht überprüft werden, aber mit einem interessanten Vergleich leitet Adam Roberts die zweite, sehr viel griffigere Handlungsebene des Romans ein. Im Gegensatz zu europäischen bzw. amerikanischen Science Fiction gibt es in der russischen SF keine Alternativweltgeschichten, keine Texte, welche den Kommunismus per se als Institution in Frage stellen oder Alternativen anbieten. Schnell stellt sich heraus, das es vielleicht keine geschriebene russische Alternativwelt Science Fiction gibt, aber der Ironiker Skvorecky das Musterbeispiel des geistigen Literaten ist, der nach jeder mehr oder weniger freiwilligen Begegnung mit der Miliz, dem KGB, den Mitgliedern der Scientology Sekte und/oder vielleicht Vertretern der Außerirdischen das Gesamtgebilde zu hinterfragen beginnt und kleine alternative Lebensraumblasen gedanklich entwickelt. In diesen kleinen Blasen vermischt Adam Roberts so geschickt Fakten und Fiction – das UFO Phänomen, der Hinweis auf die Wurzeln Scientologies in den kommerziellen Überlegungen des SF- Autoren L. Ron Hubbard, die Challenger und Tschernobyl- Katastrophen, die politischen Veränderungen von Stalin bis Gorbatschow und schließlich die fast staatsfeindlich zu nennenden Aktivitäten des russischen Geheimdienstes. Als wichtigste Botschaft des Romans erinnert Adam Roberts seine Leser immer wieder, das sowohl die Revolutionäre als auch die Science Fiction Autoren im Grunde ihre bestehende Welt verändern wollen und müssen, um in den Äonen der Geschichte einen Fußabdruck zu hinterlassen. Obwohl es laut Adam Roberts weniger die Aufgabe der Science Fiction ist, eine vage Zukunft vorherzusagen als auf gegenwärtige Missstände extrapoliert hinzuweisen, erweist sich sein literarisches Alter Ego Skvorecky als das genaue Gegenteil. Ihm sind die Schwächen der gegenwärtigen Gesellschaft derartig bewusst, das er seine Karriere als SF Autor im wahrsten Sinne des Wortes begraben hat. Er beobachtet voller Faszination, wie ein aus seiner Sicht unwahrscheinliches Phänomen – im vorliegenden Fall die UFO Sichtungen – in breiten, gesellschaftlich sehr unterschiedlichen Massen manifestiert und förmlich ein Eigenleben beginnt. Schnell wird nicht mehr die Frage diskutiert, ob es wirklich Außerirdische gibt oder nicht, sondern ob es ausreicht, an die Möglichkeit ihrer Existenz zu glauben. So wird Skvorecky mehr und mehr zum Heiligen Narren, dessen plottechnisch unwahrscheinliche Abenteuer – er entkommt auf wenigen Seiten zwei jungen Killern des KGBs im Grunde mit an Baron Münchhausen erinnernden Geschichten und Ablenkungsmanövern – eher an eine bitterböse Farce denn ein ernstzunehmendes Abenteuer erinnern. Adam Roberts zeichnet alle Figuren bis an den Rand der Karikatur. Die kontinuierliche Liebeserklärung an das viele Fleisch der fetten Amerikanern wirkt so grotesk als stamme es aus dem italienischen Film „Fleisch“. Die Schurken werden eindimensional und im Grund militärisch dumm gehalten beschrieben, die Guten erinnern an Chiffren. Je absurder die beschriebene Handlung, desto überzogener wirken die Figuren ohne das sie ihren naiven, märchenhaft surrealistischen Charme in letzter Instanz verlieren.
Plottechnisch versucht Adam Roberts fast zu viel zu erreichen. Der ungewöhnliche Rahmen; die extrem offensive bis zur Provokation ausgenutzte Form der Ich- Erzählerperspektive und die zumindest auf einer oberflächlichen Ebene angerissene Diskussion um die Bedeutung der Science Fiction und die zahlreichen Miss- bzw. Überinterpretationen des Genres. Das Ende ist konsequent und zynisch, wenn es auch mehr den Paranoikern unter den Lesern/Politikern/Weltfremden Nahrung gibt. „Yellow Blue Tibia“ ist eine lesenswerte vielschichtige Geschichte und die interessanteste Variation der „Invasion aus dem All“ Thematik, die seit vielen Jahren erschienen ist.
Allan Steele „The Tranquillity Alternative“
Low Tech Alternative Welten Science Fiction ist ein Subgenre, das sich insbesondere im Vergleich zu den zahlreichen “Was wäre wenn?” Geschichten noch nicht richtig durchgesetzt hat. Allen Steele hat mit seiner locker verbundenen im BASTEI Verlag auch auf Deutsch veröffentlichten Debüttrilogie um die Eroberung des Sonnensystems im Grunde das Fundament für den vorliegenden Roman gelegt.
Schon in den beiden Kurzgeschichten “John Harper Wilson” - die erste Mondlandung ebenfalls im Jahre 1969 - und in “Goddard´s People” mit der Beschreibung des deutschen Angriffs auf dem Erdorbit - beide in der Collection “Rude Astronauts” veröffentlicht - hat Allen das Steele den Punkt markiert, an dem die Geschichte seiner Welt von unserer Historie abgewichen ist. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis mittels einer ihrer Wunderwaffen versucht, Amerika aus einem niedrigen Orbit anzugreifen. Nur das heldenhafte Eingreifen einer amerikanischen Elitetruppe mit ebenfalls rudimentären Weltraumfahrzeugen konnte den Angriff auf den amerikanischen Kontinent verhindern. Der Zweite Weltkrieg endete wie bekannt. Ein Teil der deutschen Wissenschaftler folgte dem Ruf in die Staaten, anderen Experten sind in den russischen Gefangenenlagern verschwunden. Der Wettlauf ins All setzte viel früher ein, wobei die erste Landung auf dem Mond gleichzeitig der Beginn einer Bewaffnung des Erdtrabanten durch die Amerikaner darstellte. Bevor die NASA wieder privatisiert worden ist, haben die Amerikaner Atomwaffen auf einer inzwischen verlassenen Basis auf dem Mond stationiert. Nach einer gemeinsamen Expedition zum roten Planeten haben die Russen den Wettlauf ins All nicht zuletzt aufgrund wirtschaftlicher Probleme aufgegeben. Die Amerikaner haben - angesichts des fehlenden Feindbildes - die weitere Weltraumforschung in engen, budgettechnisch stark eingeschränktem Maße fortgesetzt. Allen Steele bietet zu diesem Thema neben eingeschobenen Artikeln auch verschiedene Interviews sowie fiktive zeitkritische Analysen an. Erstaunlich ist, das insbesondere der technische Fortschritt sich immer wieder mit unserer tatsächlichen Geschichten überschneidet. So gibt es - am richtigen Tag - auf beiden Zeitebenen die Challengertragödie, die - ebenfalls wie in der Wirklichkeit - für die nächsten Jahre die Space Shuttle auf die Erde verbannte. Im Gegensatz allerdings zu unserer Realität stellten die Space Shuttle nur eine natürliche Weiterentwicklung eines alten Raumlastschiffes dar, das zumindest phasenweise den Betrieb weiter übernehmen konnte. JFK wird nicht ermordet, seine Politik wird bei seiner ersten Kandidatur schlicht und ergreifend vom Wähler abgelehnt. Die eigentliche Geschichte beginnt im Jahre 1995. Inzwischen sind die Deutschen - hier bleibt Allen Steele frustrierend vage, ob Deutschland im Zuge des zusammenbrechenden Ostblocks ebenfalls wiedervereint worden ist - zum wirtschaftlich stärksten Antagonisten der Amerikaner aufgestiegen. Privatwirtschaftlich organisiert kauft eines der weltweit operierenden Industriekonglomerate den Amerikanern die alte Mondbasis ab. Nur müssen die Amerikaner mit ihrer letzten Expedition zum Mond die Atomwaffen unschädlich machen, bevor sie die Station übergeben können. Sie ahnen nicht, das es inzwischen Kräfte gibt, deren Interesse an den immer noch funktionsfähigen Waffen deutlich größer ist als die Erde aus dem All mittels der Station mit Solarenergie aus dem All zu versorgen.
Allen Steeles Roman muss der aufmerksame Leser aus zwei Perspektiven betrachten. Zum einen der Hintergrund der Handlung und dann der eigentliche Plot, der etwas in die Zukunft verschoben auch in unserer Realität entsprechend gut funktioniert hätte. Unabhängig von den historischen veränderten Daten passt Allen Stelle im Grunde zu wenig an. Die erste Mondlandung ebenfalls im Jahre 1969 ist historisch im Angesichts der kurze Zeit darauf erfolgenden nächsten Schritte ins All zu “spät” angesiedelt und die Challengerkatastrophe im Vergleich zu einem ersten Flug zum Mars logischerweise zu spät. Es ist zwar amüsant, von einer “Star Trek” Serie zu lesen, die Lewis Allen produziert hat, während Gene Roddenberry nur für “Star Trek-TNG” verantwortlich gewesen ist, aber inklusiv der außerordentlich phantasievollen Schauspielerriege lenkt dieser Seitenhieb auf unsere Gegenwart ebenso ab wie Bill Clintons Präsidentschaft oder die Tatsache, das bekannte Gruppe auch in der Parallelwelt die gleichen Lieder geschrieben hat. Dabei wirken sowohl der Vietnamkrieg als auch der Sommer der Liebe wie Artefakte in einer leicht bizarren und doch zu vertrauten Geschichte. Auch die Computerindustrie wirkt wie ein Abziehbild unserer Gegenwart inklusiv der entsprechenden Befehlsmodule, auch wenn in Steele Parallelwelt insbesondere die Flug wie Raketentechnik im Grunde fast zwanzig Jahre vorher begonnen hat. Zynisch verweist der Autor auch in einem eher überlesbaren Seitenhieb darauf, das Morton Thiokal die Triebwerke für den verunglückten Raumshuttle gebaut hat, während die anderen Rüstungskonzerne immer noch von dem seltsamen amerikanischen Demokratieverständnis insbesondere außerhalb der USA profitieren. Bis auf die Deutschen, sowie einem Querverweis in bester “Mission Impossible” Manier hat sich in Steele erzkonservativem bis leicht paranoiden Amerika im Grunde nicht viel getan. Die wenigen Unterschiede sind solide herausgearbeitet, der Autor hätte sich aber ein wenig mehr Mühe geben können, um eine überzeugende und bis in kleinere Details besser durchdachte Parallelwelt zu inszenieren.
Während der Hintergrund der Geschichte insbesondere auch im Vergleich zu Steele späteren “Coyote” Romanen, in denen er einen gänzlich fremden, exotischen Hintergrund entworfen hat, nicht unbedingt überzeugen kann, ist der eigentliche Plot erstaunlich geradlinig und phasenweise packend spannend erzählt worden. Dabei bewegt sich Allen Steele aber auch immer am Rande des Klischees. Die Opposition – wie sich später herausstellt, Handlanger böser auch in unserer zu der Achse des Bösen gehörender Mächte – wird eher eindimensional bis klischeehaft dargestellt. Die Idee, einen Doppelgänger an Bord des Raumschiffs zu schmuggeln, fällt auf, da dieser nichts von den virtuellen Sexphantasien des Originals weiß. Die Anspielung auf „Manchurian Candidate“ wird von Steele konsequent, hinsichtlich der Prämisse seines Szenarios – ein Astronaut, ein Spezialist – aber unglaubwürdig umgesetzt. Zu viel wirkt insbesondere in der ersten Phase des Buches, in welchem Steele neben dem schon angesprochenen alternativen Hintergrund auch den Spannungsaspekt aufzubauen sucht, konstruiert bis schwerfällig. Die finale Konfrontation natürlich im Bunker mit den Zündmechanismen für die sechs Atomraketen wird dagegen vom Autor intensiv und dramatisch ohne in Brutalitäten auszuarten beschrieben. Im Nachhinein fragt sich der Leser allerdings, wie die Atomköpfe vom Mond schließlich in das sich selbst isolierende Land transportiert werden sollte.
Wie in seinen anderen in naher Zukunft spielenden Werken liegt Stelles Stärke in der authentischen Beschreibung und geschickt überzeugender Extrapolation gegenwärtiger Technik. Der Leser hat nicht nur das Gefühl, zusammen mit den Astronauten – dabei differenziert der Autor zwischen der Sehnsucht, ins All zu fliegen, und dem deprimierenden Gefühl, wieder auf längere Zeit die eigene Familie verlassen zu müssen – ins All zu fliegen, sondern angesichts der detaillierten Beschreibungen der Funktionsweise der Raumfahrtbehörden – NASA und ESA werden hier fiktiv abgehandelt – stimmt auch der politisch- wirtschaftliche Hintergrund. Der Leser verfolgt staunend die teilweise irrsinnigen Entscheidungen der Ausschüsse, die lieber ein Eisenbahnmuseum als einen Flug ins All finanzieren, die Einsparungen zu Lasten der Sicherheit vornehmen und sich nur bei Erfolg im Schatten des Ruhm sonnen, bei Misserfolgen schnell nach den üblichen Sündenböcken suchen. Sachlich nüchtern, nicht polemisch, sondern intelligent kritisch zeigt Allen Steele aus seiner Sicht die Missstände der gegenwärtigen – das Buch ist in den neunziger Jahren des letzten Jahrtausends geschrieben worden – amerikanischen Politik genauso auf wie den Aufstieg der europäischen bzw. in erster Linie deutschen Wirtschaftsmacht. Auf der einen Seite macht die Ambivalenz seiner Thesen den Plot deutlich glaubwürdiger als die eigentliche Handlung, auf der anderen Seite bewegt sich Steele immer stark am Rande des Geduld seiner Leser, wenn er sich in eine Art Techniklimbo zurückzieht und verliebt von den Raumschiffen/Raumstationen schreibt, die er teilweise indirekt mit konstruiert hat.
Einzig die Charakterisierung insbesondere auch der Protagonisten ist weiterhin die große Schwäche Allen Steeles. Sie bewegen sich ein wenig am Rande des Klischees. Die lesbische Austronautin wird gemoppt, droht aus der NASA ausgeschlossen zu werden. In einem ironischen Unterton wünscht sie sich an einer eher belanglosen Stelle, sie hätte auch einen heterosexuellen Partner. Der Chefastronaut im Grunde auf seiner letzten Mission versucht die vergangenen zwanzig Jahre zwischen der Mondlandung und dem Heute auszublenden und wünscht sich – wie vor jeder Mission – Sex am Strand. Die Schurken sind eindimensional gezeichnet und in der finalen Konfrontation bedauert der Leser ihr offensichtliches wie vorhersehbares Schicksal nicht. Die zwischenmenschlichen Beziehungen hätten aus einem solide Hard Science Fiction Roman mit einem Alternativwelthintergrund eine packende, auf mehreren Ebenen ansprechende Geschichte machen können. So wirkt manches auf der emotionalen Ebene eher rudimentär entwickelt und bildet leider kein ausreichendes Gegengewicht zu ebenfalls nicht immer konsequent extrapolierten Alternativwelthintergrund. Zusammengefasst ein solider, unterhaltsamer, aber keinesfalls herausragender Roman in Allen Steeles inzwischen umfangreichen und über zwanzig Jahre währenden Schaffen.
Stoney Compton „Russian Amerika“
“Russian Amerika” ist eine der für BAEN so typischen Science Fiction bzw. Alternativweltgeschichten. Eine Actionorientierte Grundhandlung mit einem in diesem Werk interessant, aber weder konsequent noch wirklich logisch aufgebauten Hintergrund sowie überdimensional erscheinenden Heldencharakteren inklusiv ein wenig pathetischer Tragik.
Die Handlung beginnt im Jahre 1987 in einem Alaska, das weder unabhängig noch Teil der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Es ist weiterhin russische Provinz des zaristischen Russlands. Die russische Revolution ist vom Zaren niedergeschlagen. Politisch wird nicht weiter argumentiert, warum auch die USA noch ein aus unabhängigen Staaten bestehender Verbund ist. Anscheinend hat der amerikanische Bürgerkrieg zu einer Session der Südstaaten geführt, die sich wiederum inzwischen untereinander zerstritten haben. Im hektischen wie überstürzten Finale sind es die Kalifornier, die mit ihrer Marine den letzt endlich die Vorherrschaft Russland beendenden Schlag ausführen. Compton ist sich hinsichtlich der politischen Entwicklung Alaska sehr unsicher. Stellenweise erinnert der Freiheitskampf der unterdrückten Bevölkerung an die Unabhängigkeitskriege der Amerikaner. Alleine es fehlt ein historischer Brückenschlag zu diesen Ereignissen. So fragt man sich unwillkürlich, wie die sich ungewöhnlich organisierenden Rebellenverbände gleich ein politisches Rätesystem geben können, das einen Vertreter aus jeder Gemeinde in die geheimen ersten Sitzungen entsendet. Zwar gibt es einen in den zersplitterten Staaten der USA aufgewachsenen latent politisch erfahrenen Helfer, aber die wie eine Lawine einsetzende Bewegung überrollt nicht nur die Protagonisten, sondern vor allem den Autoren, der eher rudimentär sein demokratisches System in Alaska zu entwickeln sucht. Vor allem leidet der Roman in diesem Punkt unter den einmalig klischeehaft gezeichneten Figuren. Es gibt strahlende Helden und abgrundtiefe böse opportunistische Schurken. Nur ganz selten skizziert Compton einen Offizier der Gegenseite mit etwas militärischem Respekt. Kaum ist die Beschreibung über das rudimentärste Maß hinaus abgeschlossen, weiß der Leser, das diese Figur sehr bald wieder sterben muss. Grigory Grigorievich dagegen wird dagegen vom ersten Augenblick an zu seinem Symbol der anstehenden Revolution. Als Mischling - seine Mutter stammt von der Urbevölkerung ab - hat er erst während seiner militärischen Dienstzeit unter anderem als Major bei einer russischen Elitetruppe schwer gehabt. Mit etwas Geld hat er sich ein eigenes Schiff gekauft und lebt zusammen mit seiner jungen Frau vom Fischfang und vom Schmuggeln. Seine Frau stirbt jung an Krebs. Eher fatalistisch eingestellt versucht er ein möglichst unauffälliges Profil sich zu geben. Er ahnt, das die Mitnahme eines arroganten Kosaken und einer jungen Frau ihn in Schwierigkeiten bringen wird. Grigorievich versucht einen Übergriff des Kosaken auf die Frau zu verhindern und tötet dabei seinen Widersacher. Kurze Zeit später findet er sich, nachdem sie ihn bewusstlos geschlagen hat, in russischen Gewahrsam wieder. Er wird wegen Mordes zu dreißig Jahren Zwangsarbeit an den Autobahnen verurteilt. Durch einen Zufall wird er während eines Überfalls der Ureinwohner Alaskas - hier erweckt Compton sicherlich als dichterische Freiheit den Eindruck, als handele es sich um Indianer - befreit und schließt sich der immer stärker werdenden Bewegung an, deren Ziel die Formung einer Dene Republik ist. Dank seiner militärischen Erfahrung und seiner taktisch geschickt geplanten Angriffe steigt Grigorievich schnell in den Rängen der kleinen Gruppe auf. Anfänglich nehmen die Generäle in Russland diesen aus ihrer Sicht vernachlässigbaren Aufstand nicht ernst und versuchen mit ihrer technologischen Überlegenheit, die Flammen der Revolution zu ersticken. Sie müssen schnell erkennen, das Freiheitsliebe und Patriotismus stärker sind als ihre unmotivierten, aber zahlenmäßig wie technisch überlegenen Soldaten.
Während Compton zu Beginn des Buches sich bemüht, die melancholische russische Seele, die auch im Halbblut Grigorievich schlummert, zu beschreiben und ihn als Helden wieder Willen zu etablieren, dominiert nach den sehr intensiv, sehr brutal beschriebenem Überlebenskampf im russischen GULAG in Alaska inklusiv der Folter und der Vergewaltigungen durch die gelangweilten Aufseher die militärische Auseinandersetzung. Dabei reiht sich eine Kampfszene an die nächste. Diese werden durchaus abwechselungsreich - soweit man von Schusswechseln und dem Niederstechen mit Bajonetten überhaupt davon sprechen kann - beschrieben. Dabei reicht das Spektrum von taktisch geschickt inszeniert Auseinandersetzungen bis zum Unglaubwürdigen. Die Freiheitskämpfer erhalten am Höhepunkt der Kämpfe Unterstützung unter anderem von einzelnen Staaten wie Kalifornien. So gelingt es mit Heldenmut einem Piloten, sein schwer beschädigtes und manövrierunfähiges Flugzeug eher unfreiwillig, aber effektiv an einem Berghang oberhalb der russischen Panzertruppen zerschellen zu lassen. Die ausgelöste Lawine vernichtet die sich bin dahin dank einer interessanten „Eingrabetaktik“ sich gut verteidigenden Panzer. Oder Grigorievich wird wegen angeblicher Kriegsverbrechen mitten aus dem Kampfgeschehen vor ein angeblich neutrales Tribunal in den USA gerufen, wo er eine Bekannte wieder trifft, welche die grausame Bestrafung durch die Rebellen “überlebt” hat. So effektiv und unter die Haut gehend diese Begegnung beschrieben worden ist, leidet die ganze Sequenz unter fehlender Logik. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum Grigorievich dem Wunsch des Tribunals folgen sollte. Erstens ist der Zeitpunkt denkbar unwahrscheinlich - siehe die Schwierigkeiten im jugoslawischen Bürgerkrieg, die wahren Kriegsverbrecher überhaupt zu stellen - und zweitens hätten die Rebellen überhaupt keinen Nachteil, wenn Grigorievich nicht teil genommen hätte. So haben zwar die Rebellen die russische Offizierin grausam zu einem langsamen Tode verurteilt, das Grigorievich nur am Ort des Geschehens und nicht direkt beteiligt gewesen ist, wird er freigesprochen. Grigorievich war übrigens für ein schnelles und sicheres Töten der Russin. Es reihen sich noch eine Reihe ähnlich unlogischer Sequenzen aneinander. Im rasanten Tempo und den wechselnden Schauplätzen gehen diese im Kern faulen Kompromisse, deren Ziel eher das Seitenschinden als den Plot wirklich noch vollziehbar voranzutreiben ist, fast unter. Erst nach Ende der Lektüre beginnt der Leser über die teilweise zu ambitionierte, dann wieder zu stark konstruierte Grundkonstellation der Geschichte nachzudenken, die als Epos nicht unbedingt vor einem Alternativwelthintergrund - wie schon angesprochen hätten die Kämpfe auch im 18. Jahrhundert unter George Washington so ablaufen können - hätten spielen müssen. Nicht selten zaubert der Autor ein eher überraschendes As wie die zahllosen Auslandskonten der Rebellen mit großen Vermögen in unterschiedlichsten Währungen aus dem Ärmel. Ein wenig mehr Sorgfalt hinsichtlich der Plotstruktur und der Extrapolation einer durchaus interessanten Prämisse hätten dem Buch sicherlich besser getan. So scheint die technologische Welt auf einem Niveau vergleichbar den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts förmlich stehen geblieben zu sein. Das wirkt hinsichtlich der Kämpfe authentisch, überzeugt aber hinsichtlich der Erklärung, das der Zar Alaska ganz bewusst entwicklungstechnisch benachteiligt hat, zu wenig, da auch die russischen Truppen über keine zu modernen Waffen verfügen. Zwar gibt es Atomwaffen, sie werden aber aus Arroganz und Selbstüberschätzung nicht eingesetzt. Auf den Einsatz von Hubschraubern antworten die Rebellen mit entsprechenden Raketen, die sie wie die afghanischen Freiheitskämpfer ebenfalls gegen die russische Armee auf dem freien Markt gekauft haben. Das Ende ist überstürzt und wirkt zu pathetisch patriotisch. Stilistisch leidet das Buch unter den teilweise noch sehr steif und umständlich geschriebenen Dialogen, während wie schon angesprochen der Hintergrund insbesondere des Lebens und Überlebens in dem unwirtlichen und harten Alaska gut bis sehr gut recherchiert worden ist. Hinsichtlich des Spannungsaufbaus insbesondere innerhalb einzelner Sequenzen fehlt Compton in seinem Erstlingsroman noch die Erfahrung, aber mutig, ambitioniert, nur stellenweise überfordert beschreibt er den Freiheitskampf der alaskaschen Urbevölkerung gegen einen erdrückenden Gegner. Mehr Military Science Fiction als vielschichtige Alternativweltgeschichte, aber phasenweise trotz der angesprochenen Schwächen interessant und herausfordernd, wenn auch als Gesamtwerk gewogen und zu leicht befunden.
Kim Stanley Robinson „The Years of Salt and Rice“
Mit dem Alternativweltepos „The Years of Salt and Rice“ legt Kim Stanley Robinson eine im Grunde über das Spektrum der „Was wäre wenn?“ Plots hinausgehende Episodensammlung vor, deren Kern keine zehn kurzen Episoden, sondern trotz der unterschiedlichen Längen zehn Lebensgeschichten sind. Für den Leser gewöhnungsbedürftig sicherlich gewöhnungsbedürftig nutzt Kim Stanley Robinson das Konzept der Inkarnation in allen Texten. Nur an den Anfangsbuchstaben K, B und I lässt sich – in der letzten Episode für die unaufmerksamen Betrachter noch einmal zusammengefasst – der roten Faden vom frühen Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert erkennen.
Die Auftaktepisode behandelt nicht nur den Ausgangspunkt der Divergenz – die Pest hat fast alle Menschen in Europa getötet und deren Kultur ausgelöscht -, sondern stellt die wichtigsten Protagonisten vor. Die Episode spielt am Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts und streift den Tod Tamerlans, des Begründers der Timuriden Dynastie in Vorderasien.
Robinson nutzt dieses Auftaktkapitel, um atmosphärisch ausgesprochen dicht, aber nicht nihilistisch auf der einen Seite den Untergang der bekannten europäischen Zivilisation zu beschreiben, auf der anderen Seite die Wurzeln seiner Figuren zu etablieren. „K“ ist der ungeduldige und aggressive, während „B“ mehr das ausgleichende Element ist. Stellvertretend für den Leser ist „I“ der Schüler. Die erste Zwischenepisode beschreibt die Reinkarnation „K“ s in einem Tier. Ansonsten wechselt Robinson in den einzelnen Episoden auch die Geschlechter der Reinkarnierten bzw. die Kontinente, auf denen sie wieder erwachen. Grundsätzlich ist die Idee der wechselnden Geschlechter sehr gut und ermöglicht eine interessante Erweiterung der erzählerischen Möglichkeiten. Da bis auf das letzte Kapitel – eine Art verspielte Zusammenfassung der meisten Episoden des Romans - aber die Figuren keine echte Erinnerung über die festgehaltenen historischen Ereignisse hinaus an ihre früheren Leben haben, verpufft stellenweise die beabsichtigte Intention des Autoren. Für den Leser ist es interessant, nicht die einzelnen Facetten einer abgerundet beschriebenen Persönlichkeit kennenzulernen, sondern im Grunde viele mögliche Variationen seiner überwiegend asiatischen bzw. indianischen Charaktere in einer Welt, die nicht von den Europäern mitgeprägt worden ist. Da insbesondere das Eingehen auf die asiatischen Kulturen sehr viel Hintergrundinformationen erfordert, greift Robinson nicht immer konsequent auf kleine Einschübe, in denen der Autor dem Leser einzelne Details insbesondere der buddhistischen Religion erläutert. Dabei durchbricht Robinson die Kontinuität der eigentlichen Erzählung nicht. Es ist aber nicht der einzige Punkt, in dem dieser über Jahrhunderte laufende Episodenroman einen belehrenden Grundton beinhaltet. Am Ende des Buches spielen einzelne Sequenzen im sogenannten „Bardo“, einer Art Nirvana, in dem die einzelnen Charaktere die überwiegenden Fehlschläge ihrer früheren Inkarnationen diskutierend. Wahrscheinlich wollte Kim Stanley Robinson einzelne Punkte noch einmal betonen und greift sie am Ende des langen Romans wieder auf. Aus einer anderen Perspektive betrachtet nimmt der Autor seinen Lesern die Möglichkeit, das Geschehen überwiegend wertfrei zu reflektieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Diese Vorgehensweise wirkt darüber hinaus überambitioniert und unnötig. Die grundlegende Möglichkeit einer Reinkarnation hätte als verbindendes Element ausgereicht. So bleibt das unbestimmte Gefühl, als wolle Robinson über den Glauben/ die Möglichkeit an die Wiederkehr der Seele hinaus den Leser von einer realen Tatsache überzeugen. Außerdem sind die Passagen im Nirvana dialogtechnisch sehr schwach geschrieben und ragen leider negativ aus dem ansonsten sehr komplex, absichtlich bis überambitioniert anspruchsvoll gestalteten Plot heraus.
Unabhängig von dieser glaubenstechnischen Indoktrinierung gibt die Idee der Reinkarnation über Jahrhunderte Robinson die Möglichkeit, seine Geschichte global zu erzählen und den Leser unterwegs nicht zu verlieren. So streift der Plot Eckpunkte auch unserer Geschichte. Nur aus einer asiatischen/ moslemischen Perspektive heraus erzählt. Robinson verzichtet überwiegend auf historische markante und bekannte Persönlichkeiten. Seine Ambition ist viel größer. Eine Reflektion über die Weiterentwicklung der islamischen wie buddhistischen Religion ohne Einfluss des Christentums und damit auch der aggressiven europäischen Eroberer zu schreiben. Anstatt in theologische Diskussionen zu verfallen, versucht Robinson seine Geschichten auf politischen wie sozialen Grundelementen aufzubauen. In Bezug auf die Politik inklusiv der diversen militärischen Auseinandersetzungen sind seine Figuren reine Erfüllungsgehilfen, die zwar an den historisch relevanten Ereignissen teilnehmen, aber keinen Einfluss auf ihren Verlauf haben. In Bezug auf die sozialen Komponenten versucht Robinson in einer der emotional interessanteren Geschichten die Grundlagen einer Frauenrechtsbewegung in einem spätkaiserlichen China zu entwickeln, bleibt aber teilweise frustrierend oberflächlich und verfällt im letzten Drittel dieses Abschnitts unnötigerweise in manches Klischee. Vor allem orientiert sich der Autor zu sehr an der insbesondere im Nahen wie Fernen Osten gerne herangezogenen Theorie des großen charismatischen Führers, der mit Gewalt und Tyrannei das Volk auf der einen Seite bei der Stange hält, auf der anderen Seite aber auch große kulturelle Verdienste verbuchen kann. Geschichtlich orientierte Leser werden in allen Herrschern – egal ob Mongole, Chinese, Japaner – Abbilder von Tamerlan wiedererkehren und diese fast stupide Vorgehensweise lässt die Antagonisten eindimensional bis klischeehaft erscheinen. Kim Stanley Robinson legt sich vom Auftaktkapital an eine übergeordnete geschichtliche Theorie für seine Alternativwelt zurecht, die er konsequent unabhängig von den soziologischen Strömungen bis zum Ende durchhält. So ist der technische Fortschritt ausgesprochen parallel der bekannten Geschichte beschrieben worden. An sich aufgrund der ökologischen Erfordernisse Asiens eine sehr gewagte Prämisse, die aber in den ersten Kapiteln funktioniert. In dem in Samarkand spielenden Kapitel versucht Robinson aus den Vorgaben, welche er sich selbst gestellt hat, auszubrechen, in dem er einen Alchimisten – der erste Versuch der Goldherstellung entpuppte sich als Betrug und kostete ihn statt des Lebens eine Hand – gegen jede Prämisse im Alleingang aus der Hütte heraus die Grundlagen der modernen Wissenschaft inklusiv einer Reihe grausamer Waffen wie Giftgasgranaten erfinden lässt. Später beschreibt Robinson einen fast hundertjährigen Religionskrieg, in dem – vergleichbar dem Ersten Weltkrieg unserer Realität – diese Waffen eingesetzt werden und grausames Leid sowohl unter den Militärs als auch der Zivilbevölkerung auslösen. Es sind die Facetten, welche den Reiz des Romans ausmachen. Der Unterschied zwischen dem chinesischen Kolonialismus und den bekannten Exzessen der europäischen Geschichten sowohl bei der Expansion gen Osten als auch in Richtung Neue Welt. Die Pervertierung der Grundidee des Islams zu einer extremen, gewalttätigen und die Rolle der Frau verachtenden Religion. Viele Argumente Robinsons bleiben trotz ihrer Schlüssigkeit theoretischer Natur und werden leider plottechnisch zu wenig unterstützt, um dem Roman eine notwendige politische Aktualität und vor allem eine philosophische Tiefe zu geben. Zu den stärksten Ideen gehört der positive Einfluss der weniger rudimentär nach der Eroberung durch die Chinesen verbliebenen indianischen Kultur. Erstaunlicherweise vollzieht sich die Entwicklung seiner asiatischen dominierten Parallelwelt ohne wirklich Bahn brechende individuelle oder wirtschaftliche Umwälzungen. Die Hintergründe sind eher rudimentär bzw. vage extrapoliert und wirken manchmal arg mit der heißen Nadel eher plottechnisch notwendig als logisch konstruiert.
Unabhängig von kleineren Schwächen in der Chronologie - das Buch wirkt eher wie eine Reihe von Novellen und Episoden, die zu einem längeren Text zusammengestellt, aber nicht kontinuierlich niedergeschrieben worden sind - ist „The Years of Salt and Rice“ eine interessante Parallelweltgeschichte. Weniger als Roman zu betrachten, sondern phasenweise als theoretisch und vor allem theoretisierendes Lehrstück. Kim Stanley Robinson erzählt nicht aus der Geschichte heraus, sondern lässt - auch hier ist es erstaunlich, wie oft er die Struktur des Berichtens zwischen den einzelnen Abschnitten wechselt - das aufeinander aufbauende Geschehen wie in einer Chronik „niederschreiben“. Hinzu kommt der manchmal zu belehrende Tonfall, der aus der eigenen Erzählung herausragt. Auf der anderen Seite sind die einzelnen Figuren - nachdem sich der Leser an ihre einzelnen Inkarnationsmöglichkeiten gewöhnt hat - solide bis inspiriert, exotisch und doch zugänglich gezeichnet. Immer wieder gelingt es Kim Stanley Robinson, in kleinen bis kleinsten Sequenzen direkt das Herz seiner Leser anzusprechen. Der Schicksal der Einzelnen - obwohl durch die Möglichkeit der Reinkarnation gegenüber dem Tod im zweiten Teil des Buches ein bisschen zu sehr abgestumpft - ist trotz der globalen Chaos insbesondere im Jahrhundertkrieg präsent, in dem die Szene mit der Hand und der Sakeschale die Sinnlosigkeit des Lebens genauso trifft wie die Hoffnung, den nächsten Schritt gehen zu können. Ein anspruchsvolles, nicht ganz befriedigendes Projekt, das in erster Linie aufgrund seiner wirklich eindrucksvollen und richtungweisenden Konzeption zum Lesen, manchmal aber auch zum Durcharbeiten anregt.
TRASH & TREASURY
Beitrag Eine kleine Welt neben der Eigenen von Thomas Harbach
vom 25. Nov. 2010
Weitere Beiträge
|
|
Eine kleine Welt neben der Eigenen
Thomas Harbach |
|
|
Meine Nachbarn, die Nazis
Thomas Harbach |
|
|
Space and Haldeman
Thomas Harbach |
|
|
Brian W. Aldiss- Leben eines schreibenden Engländers
Thomas Harbach |
|
|
Green for Science Fiction
Thomas Harbach |
| [Seite 1] [Seite 2] [Seite 3] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info