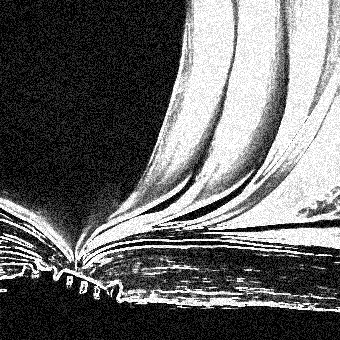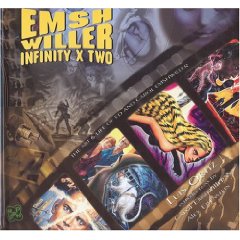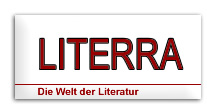
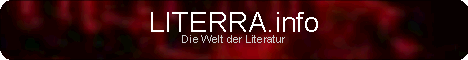
|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > TRASH & TREASURY > Biographien |
Biographien
Elmar Schenkel ist in seinem empfehlenswerten Essay „Der Mann im Labyrinth“ auf die Bedeutung von H.G. Wells Visionen eingegangen und hat insbesondere seine politischen und nicht utopischen Romane kritisch unter die Lupe genommen. Die wenigen Bezüge auf Wells Privatleben und seine erzkonservative politische Einstellung werden durch Michael Corens sehr empfehlenswerte und schon 1993 erschienene Biographie „The Invisible Man: Life and Liberties of H.G. Wells“ ergänzt. In Hinblick auf Wells literarisches Schaffen zählt Michael Coren eine Reihe von sehr unangenehmen Fakten auf, die aber in erster Linie nicht auf dem Abstand von mehr als sechzig Jahren betrachtet werden müssen, sondern in die damalige soziale und gesellschaftliche Situation integriert werden müssen. Wells wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter hat ihn so weit es irgendwie geht unterstützt, aber der ehrgeizige und autodidaktische Wells – ein Segen und ein Fluch zugleich – wollte zumindest in den Mittelstand aufsteigen. Er bildete sich selbst weiter und erlangte schließlich aufgrund seines Fleißes eine Stelle als Hilfslehrer. In dieser Zeit setzte er seine wenigen literarischen Ambitionen weiter fort. Während der kurzen Studienzeit musste er die Herausgabe und das Lektorat einer Studentenzeitung aufgeben, weil er neben dem Studium noch arbeiten musste. Nach einer Reihe politisch gefärbter Essay und ersten kurzen Romanen, in denen er begann, den für ihn typischen Protagonisten der Mittelschicht zu entwickeln, gelang ihm der Durchbruch mit „The Time Machine“. In schneller Folge verfasste er weitere utopische Romane, bevor er sich plötzlich seinen wahren Ambitionen zuwandte und mittels seiner literarischen Werke das Volk aufzuklären und sowohl politische als auch soziale Strömungen auf Schärfste dank der teilweise beißenden Ironie in seinen Büchern zu kritisieren. Der Erfolg seiner utopischen Stoffe hat Wells in die englische High Society aufsteigen lassen. Er war mit J. P. Priestley, mit George Bernhard Shaw oder G.K. Chesterton befreundet. Die Freundschaft und die Teile an deren Sitzungen stellten ihn nicht zufrieden. Wells fast krankhafter Ehrgeiz und seine offensichtlichen Minderwertigkeitskomplexe in Hinblick auf seine Herkunft sorgten für die ersten Probleme. Eine Palastrevolution in einer ehrenwerten Künstlerloge sorgte für den ersten Rückschlag seiner Ambitionen, der nur dank des Eingreifens seiner Freunde ein wenig gemindert werden konnte. Mit seiner „Geschichte der Welt“, die er nicht alleine verfasst hat, legte er sich schließlich mit der katholischen Kirche und Schriftstellern an, die ihm in Hinblick auf ihre Bildung und vor allem ihre Argumentationskraft deutlich überlegen gewesen sind. Inzwischen hatten sich auch einige seiner Freunde von ihm abgewandt. Coren zeichnet diesen schmalen Grad zwischen überdurchschnittlichem Literaten und egozentrischen und egoistischen Einzelgänger sehr gut nach. Er zitiert aus umfangreichen Quellen und versucht vor allem in Hinblick auf die verschiedenen Konflikte die Situation aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben. Schon in seinem Vorwort hat Michael Coren herausgestellt, dass ein Biograph sein „Opfer“ nicht lieben muss und eine kritische Distanz
wünschenswert ist. Coren ergänzt diese Punkte um die These, dass der Biograph nicht neutral sein muss.
Nicht nur in den Debatten mit seinen Freunden und Feinde zeigt Coren an verschiedenen Beispielen auf, das der Visionär Wells insbesondere im Vergleich zu seinen düsteren Visionen in Hinblick auf politische Entwicklungen sowie literarisch ethnische Debatten oft auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Dabei reicht das angesprochene Spektrum sicherlich von H.G. Wells teilweise sehr rassistischen Ansichten inklusiv einer auch vom Zeitgeist geprägten Auseinandersetzung mit den Juden über seine Ideen zur Euthanasie und dem wahren Leben – siehe vor allem auch „Menschen wie Götter“ oder natürlich „Die Insel des Dr. Moreau“ – bis zu den „Konzentrationslagern“, in denen Wells Menschen am liebsten Menschen gesehen hat, die nicht in Gesellschaft passen, deren Bild er zumindest vor seinem geistigen Auge gezeichnet hat. Insbesondere in seiner mittleren Schaffensperiode – die mit seiner Rückkehr zu phantastischen Texten wie „Shape of Things“ – sah sich Wells rückblickend im Grunde unerklärlich als sozialer Ingenieur. Obwohl Michael Coren insbesondere in Hinblick (aber nicht als Entschuldigung) auf den Zeitgeist einen kleinen Teil von Wells Antisemitismus relativiert, sind dessen Ansichten in ihrer Kompaktheit bestürzend und zeichnen ein negatives Bild des großartigen Visionärs. Schon in den ersten Kapiteln hat Coren die Wurzeln dieses Judenhasses auf Wells einfache und ärmliche Kindheit zurückgeführt. Viel interessanter ist Wells Verhältnis zu den Frauen. Seine Kindheit ist sicherlich von seiner Mutter dominiert worden und nach einer kurzen, gescheiterten Ehe diente seine zweite Frau im Grunde mehr als feste Säule und Mutterersatz in seinem Leben, während er ansonsten erfolgreich hinter jedem Frauenrock herjagte. Erstaunlich ist dabei die Tatsache, dass er sich in frei denkende Frauen wie die Schriftstellerin Rebecca West verliebte, mit welcher er nicht nur ein Kind hat, sondern eine langjährige Affäre. Er aber in seinen Beziehungen fast krankhaft eifersüchtig gewesen ist und sich als Kontrollfetischist erwiesen hat. Wie in einigen anderen Dingen passen Wells zweite, öffentliche Haut und sein eigenes Wesen schwer zueinander und hinterlassen in dem immer mehr selbst zweifelnden Mann tiefe Spuren. Diese innere Zerrissenheit versucht Michael Coren in seiner lesbaren Biographie genauso darzustellen wie Wells durchaus vorhandene politische Instinkte aber auch seine Taktlosigkeiten, seine Arroganz und seinen Narzissmus. Immerhin gehörte Wells zu den wenigen Menschen, die sich sowohl mit Roosevelt als auch Stalin getroffen haben. Insbesondere in Hinblick auf Stalin hat sich Wells blenden lassen und seine Kommentare über den Besuch in der UdSSR zeigen, wie naiv und stellenweise weltfremd der Autor in Wirklichkeit gewesen ist. „The Invisible Man“ ist die Biographie des einfachen, niemals wirklich mit sich zufriedenen Mannes hinter seinen Büchern. Sehr geschickt arbeitet Coren die Widersprüche in seinem Leben und teilweise in seinem Werk heraus. Der Biograph tritt hier aus der stillen Beobachterrolle heraus und kritisiert zum Teil sehr direkt und sehr zu Recht. Stellenweise hat der Leser allerdings auch das Gefühl, als suche Coren selbst den Menschen Wells, den er eigentlich beschreiben möchte. Der Text liest sich sehr kurzweilig und bildet eine empfehlenswerte Ergänzung zum Eingangs des Artikels angesprochenen Essay, das im DTV Verlag erschienen ist. Beide Bücher zusammen bilden einen idealen Hintergrund, um sich mit Wells facettenreichen, aber niemals gedanklich armen Werk gebührend und ausführlich auseinanderzusetzen.
Im Jahre 2009 jährt sich das 25. Spieljubiläum von George Orwells Bahn brechendem Roman „1984“. Auch wenn immer wieder Big Brother in Hinblick auf totalitäre Strömungen zitiert wird, scheint die warnende Wirkung dieser Anti- Utopie verklungen zu sein. Spätestens, als Anfang des 21. Jahrhundert bekannt geworden ist, dass Orwell mit Big Brother zusammengearbeitet hat, während er literarisch diese Strömungen verdammte. Scott Lucas Biographie nutzt diesen thematisch brisanten Aufhänger, um sich mit dem schwierigen Menschen und unentschlossenen Literaten – in Hinblick auf sein Gesamtwerk – auseinanderzusetzen. Die Biographie ist schon vor sechs Jahren erschienen, gehört aber aufgrund der schwierigen Position des Biographen zu seinem Sujet zu den lesenswerten Stoffen. Natürlich ist der Aufhänger die Liste von knapp drei Dutzend Namen, welche Orwell nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs seinem Freund Celia Kirwan anvertraute. Laut Orwell sollte diese Freunde/Bekannte/Kollegen/Künstler aufgrund ihrer Sympathien für den Kommunismus und Stalins Terrorregime nicht vom Staat angestellt werden. Dabei rückt Scott Lucas einige der von der Öffentlichkeit insbesondere in Großbritannien geführten Diskussion zurecht: Zum einen ist die britische Labourregierung sicherlich nicht mit Big Brother zu vergleichen. Zweitens ging es dabei eher um Staatsaufträge als um die Tatsache, dass diese Menschen nachts aus ihren Betten geholt, gefoltert und schließlich hingerichtet werden sollten. Wie es im stalinistischen System Gang und Gäbe gewesen ist. Orwell ging es bei seiner Listung weniger um die Menschen an sich, sondern um die Gefahr, das eine all zu kommunistische Meinung über Staatskanäle geäußert wird. Zeit seines Lebens hat sich Orwell gegen die kommunistische Partei und ihre Publikationen gewandt und mit manch pointierter bis bissiger Kolumne während des Zweiten Weltkriegs ihre Fürsprecher verbal ausgetanzt. Drittens stellt sich die Frage, ob die „denunzierten“ Menschen überhaupt für eine kapitalistische Regierung gearbeitet hätten. Im Verlaufe seiner mit knapp einhundertsechzig Seiten extrem kurzen, aber inhaltsschweren Biographie versucht Scott Lucas George Orwells Position nicht nur in diesem Punkt zu hinterfragen. Dabei wird schnell deutlich, dass Lucas dem Menschen Orwell nicht nur mit Misstrauen, sondern auch Antipathie gegenüber steht. Immer am Rande der Polemik versucht Lucas die flexible politische Einstellung Orwells kontinuierlich zu hinterfragen und stellt insbesondere sein frühes literarisches Schaffen in einen starken, manchmal zu einseitigen Kontrast gegenüber den späteren Klassikern. Lucas macht den Fehler, in Orwell einen Menschen zu sehen, der durchaus mit der linken, aber nicht unbedingt kommunistischen Bewegung sympathisierte und versucht die heutige Lesergeneration vor einem Menschen, vor einem Idol zu warnen. Dabei unterscheidet der Autor insbesondere in Hinblick auf „1984“ viel zu wenig zwischen Autor und Werk. Ihm gelingt es nicht, verschiedene rote Fäden sowohl in Orwells Leben als auch seinem literarischen Werk entsprechend zu extrapolieren und in einen engen Zusammenhang mit seiner berühmten Anti- Utopie zu stellen. Die Ansätze sind alle vorhanden: George Orwell erlebte Haut nah die Denunziation von Bekannten und Freunden im spanischen Bürgerkrieg, an welchem er aktiv teilgenommen hat. Viele Geschichtsbücher berichten von einer aktiven Teilnahme der britischen Kommunisten, die mittels geschickter Informationspolitik dem KGB eine Reihe von Schlüsselfiguren zuspielten. In Lucas Biographie hat der Leser den Eindruck, als handele es sich um Regierungsaktionen, die von der kommunistischen Partei erduldet worden sind. Das die Kommunisten mit den eigenen Glaubensbrüdern in Spanien brutaler umgegangen sind als mit den Faschisten hat Orwells späteres Werk geprägt. Orwell hat im spanischen Bürgerkrieg im Kleinen die Vernichtungsmaschine persönlich kennen gelernt, welche Stalin im Großen in der Sowjetunion betrieben hat. In dem Lucas Orwell angreift, vernachlässigt er die historischen Fakten. Für jeden Biographen ist es schwer, die Handlungen des Sujets zu erklären. Sie sind oft emotional und situationsbedingt, während der allwissende Biograph sowohl aus der zeitlichen und oft räumlichen Distanz am Schreibtisch ganz anders urteilt. In seinem ganzen Werk hat Orwell versucht, den Stab für einen menschlichen, demokratischen und vor allem politisch korrekten Sozialismus zu brechen. Scott Lucas sieht diese Bemühungen alleine aufgrund des literarischen Unvermögens in seinem frühen Werk eher skeptisch und untersucht jeden seiner Romane nach diesen Verfehlungen. Im Gegensatz dazu geht er nicht sonderlich auf die unzähligen Essays und Kolumnen ein, die Orwell immer wieder zwischen seinen längeren fiktiven Werken veröffentlicht hat und in denen er – auf den ersten Blick ein Widerspruch – versuchte, den Konservatismus Großbritanniens mit dem neuen Geist Europas zu verbinden. Scott Lucas kritisiert Orwell alleine für den Versuch, in dem er immer wieder darauf hinweist, dass Orwells Geist zwar willig erscheint, das Fleisch aber schwach ist. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist Scott Lucas „Orwell“ eine interessante, das Thema verfehlende Biographie, die in erster Linie das Interesse weckt, sich mit George Orwells Werk und seinem Leben intensiver zu beschäftigen. In den letzten Jahren sind weitere Bücher zu diesem Thema erschienen, welche die Diskussionen um den Autor und den potentiellen „Kollaborateur“ Orwell sehr viel nuancierter und sachlicher führen. Als Extremposition mit teilweise nachvollziehbaren, dann wieder polemischen Angriffen ist Lucas schmales Bändchen sicherlich geeignet, wenn auch nicht als Ganzes empfehlenswert. Lucas geht im Vergleich zum Gesamtinhalt sehr ausführlich auf Orwells nicht immer einfache Jugend ein, sowie seine eher unbekannten frühen Romane. Die Inhaltsangaben sind ausführlich, lassen aber Platz, um die Bücher selbst zu lesen. Auf tiefer greifende Analysen verzichtet der Biograph. Ihm geht es vor allem darum, die Widersprüche in den einzelnen Romanen an Hand der Fakten aus Orwells Leben herauszuarbeiten. Dabei sucht der Autor immer wieder den revolutionären, aber scheinheiligen Kritiker des Status Quo und ist überrascht, einen in seinem Herzen einsamen, erzkonservativen Briten zu finden. Wenn er das Bild nicht in seinem Sujet findet, wirkt Lucas teilweise fast beleidigt und verletzt. Als Einführung in das Thema George Orwell stellt Scott Lucas Bändchen eine politisch hinterfragungswürdige, aber zumindest gut recherchierte – wenn auch die Interpretationen stellenweise zu emotionale sind – und stilistisch ansprechende Studie da.
Mit “Emshwiller Infinity X two” legt die Nonstop Press einen Prachtband vor. Bevor der Leser überhaupt in den gut zu lesenden Text von Luis Ortiz und Alex Eisenstein - für die zahlreichen zum Teil sehr ausführlichen Unterschriften verantwortlicht - einsteigt, bleibt sein Auge an der Reproduktion von hunderten von Titelbildern der wichtigsten SF Magazine der fünfziger und sechziger Jahre hängen. Das Themenspektrum ist genauso spektakulär wie die einzelnen angewandten Techniken. Im Verlaufe des Blättern beginnt der Fokus sich zu verändern. Avantgardefilmtechniken werden in den Mittelpunkt des Buches gerückt. Zahlreiche schwarzweiße Abbildungen begleiten den Text. Dazwischen finden sich eine Reihe von oft aus privaten Sammlungen stammende Fotos und schließlich die Coverabbildungen zweier Kurzgeschichtensammlungen. Das sind im Grunde die visuellen Fakten des Lebens eines einzigartigen Künstlerehepaars. Ed und Carol Emshwiller werden im vorliegenden großformatigen Hardcoverband vorgestellt. Wer nicht gleich etwas insbesondere mit Ed Emshwillers Namen verbindet, braucht nur die ersten amerikanischen Taschenbücher eines Philip K. Dick betrachten, die späten Robert A. Heinleinbücher der sechziger Jahre und die unzähligen Taschenbucherstauflagen populärer SF Pulp Autoren wie A.E. van Vogt oder Isaac Asimov. Sie alle zieren die eigenwilligen, aber technisch insbesondere im Vergleich zu vielen anderen Zeichnern hervorragenden Bilder eines gewissen EMSH oder manchmal Ed Emsh. Obwohl Ed Emsh teilweise nur zwei oder drei Tage - bei einigen Techniken kann auch von Stunden gesprochen werden - für ein neues Titelbild benötigte und auf dem Höhepunkt seines Ruhm das viele Geld in seine neue alte Leidenschaft - das Filmemachen - investierte, kann bei ihm von einem Künstler und keinem Handwerker gesprochen werden. Nach einer kurzen militärischen Laufbahn, wo er auch seine Frau Carol Semshwiller kennen gelernt hat, studierte er Kunst an einer amerikanischen Universität. Sein Stil ist stark von Surrealismus beeinflusst, aber Emshwiller suchte für die von ihm illustrierte Science Fiction, welche er im Gegensatz zu seiner Frau weniger las als visualisierte, neue Stilrichtungen. Es finden sich Spuren von Dali, Tanguy oder Ernst in seinem Werk. Im Gegensatz allerdings zu vielen seiner Kollegen hat sich Emshwiller weniger um das Ganze gekümmert, sondern versucht, den Augenblick festzuhalten. Seine Bilder wirken unabhängig von der progressiven Lichtgestaltung und den überzeugenden technischen Hintergründen wie Momentaufnahmen einer Zukunft, welche dem Betrachter entweder das Fürchten lernt oder in ihm Sehnsüchte weckt - wenn es sich um schöne Frauen handelt. Dabei ist Emshwiller immer ein Detailjunkie gewesen, dessen Bilder nur selten in der ihnen zustehenden Qualität auf dem billigen Papier der Pulps abgedruckt worden sind. Auf Kunstdruckpapier in satten Farben - wie in diesem Bildband - wenn auch teilweise zu stark verkleinert kommen seine künstlerischen Visionen nicht zuletzt dank der ausführlichen Kommentare Eisensteins deutlich besser zur Geltung. In einer sehr guten Abstimmung mit Luis Ortiz erläutert Alex Eisenstein an den hier reproduzierten Bildern Emshwillers Techniken, weist auf Besonderheiten insbesondere im Hintergrund hin und gibt sehr viele Querverweise auf damals gegenwärtige Künstler bzw. Stilrichtungen, die Emshwiller beeinflusst haben. Obwohl Ed Emshwiller insbesondere als er eine Familie ernähern musste, eine unglaubliche Produktivität an den Tag gelegt hat, kann der Betrachter sowohl die künstlerische Weiterentwicklung mehr und mehr in Richtung Avantgardefilm verfolgen als auch Emshwillers Fähigkeit, die von ihm illustrierten Geschichten auf einen visuellen Punkt zu bringen. Noch interessanter ist das umgekehrte Beispiel: viele Magazine kauften erst die Cover für ihre Ausgaben und ließen dann nach diesen Bildern Geschichten von unbekannten wie auch namhaften Autoren schreiben. Es ist faszinierend und wird von Luis Ortiz auch solide herausgearbeitet, welch unterschiedliche wie auch bekannte Kurzgeschichten nach Emshwillers Zeichnungen entstanden sind. Im letzten Teil des Buches setzt sich Ortiz deutlich schwieriger mit Emshwillers preisgekrönten Avantgarde und Amateurfilmwerk auseinander. Ebenfalls reichlich bebildert - teilweise sind die Streifen in Bildsequenzen herunter gebrochen, welche mehrere großformatige Seiten umfassen - gelingt es dem Autoren weniger, das Werk zu loben oder zu kritisieren. Mehr und mehr greift Ortiz auf Kommentare von außerhalb zurück und der Leser hat den Eindruck, als könne sich der Autor nicht mit dem Filmemacher Emshwiller identifizieren. Es ist interessant zu lesen, dass dieser Künstler aus Angst vor seiner Unabhängigkeit zum Beispiel die Mitarbeit an Kubricks “2001” abgelehnt hat.
Viel schwieriger fällt es Ortiz, das literarische Schaffen Carol Emshwillers wirklich adäquat zu loben. Nach dem frühen Tod ihres Mannes hat sie noch zwei Romane geschrieben, die zwar pflichtschuldig erwähnt, aber nicht umfangreich kritisiert werden. Um sich ein wenig von der Hausfrauenarbeiten und der erdrückenden künstlerischen Präsenz ihres Mannes zu befreien, hat Carol Emshwiller in den fünfziger Jahren mit dem Schreiben von Kurzgeschichten begonnen. Im Gegensatz zu ihrem Mann Ed hat sie immer Science Fiction Geschichten geliebt und so war es ein natürlicher Prozess, das ihre ersten Texte zumindest phantastische Inhalte umfassten. Ortiz fasst einige ihrer wichtigsten Geschichten inhaltlich zusammen und stellt sie berechtigterweise auf die gleiche Stufe wie zum Beispiel Judith Merrill. In Ansätzen geht Ortiz auf die humanistische Komponente ihres Werkes vor allem im Vergleich zu der technikdominierten Science Fiction, die Campbell immer noch im zukünftigen “Analog” veröffentlichen sollte. Auch Ed Emshwiller konnte nur wenige seiner Werke in Campbells Magazinen platzieren. Oritz versucht Zusammenhänge zwischen Carol Emshwillers Ehe und ihrem literarischen Schaffen herzustellen. Als sie nach dem Tod Ihres Mannes versuchte, den Verlust in Worte bzw. einen Roman zu fassen, fällt dieser sicherlich interessante Vergleich. Insbesondere das Verhältnis zwischen Ed Emshwillers sehr visuellem Werk und dem literarischen Schaffen seiner Frau im vorliegenden Band ist zu Gunsten des Künstlers unausgewogen. Wie Carol Emshwiller in ihrem sehr ergreifenden Vorwort erwähnt, hat sich Ortiz sehr viel Mühe gegeben, eine Unzahl von Fakten in dieser Biographie zusammenfassen. Dabei bemüht er sich, Ed Emshwillers sicherlich nicht immer einfache Persönlichkeit an einigen Stellen unglücklich zu begradigen. Der Übergang vom isoliert arbeitenden Künstler - sowohl mit der Staffelei als auch der Filmkamera - zum Dozenten unter anderem an der School of Visual Arts wird nicht weiter hinterfragt, sondern akzeptiert. Ortiz versucht aber, Emshwillers aufregende, visuell herausfordernde und seltsame Experimentalfilme in Worte zu fassen und dem Leser einen Eindruck dieses Kurzfilm Davide Lynchs zu geben. Um Computer effektiv und vor allem kostengünstig zu nutzen, ist er eine Dekade zu früh geboren worden. Ein Bedauern, das nicht nur Emshwiller, sondern auch der Autor des Bandes an mehr als einer Stelle ausdrückt. Das Emshwiller mit dem Malen von Titelbildern trotz aller künstlerischen Brillanz zu Tode gelangweilt worden ist, nimmt ihm der Leser dieses unglaublich schönen Buches sofort ab. Das Emshwiller ein Künstler gewesen ist, der sich weniger um das Materielle als das Ideale gekümmert hat, wird sowohl vom Autoren des vorliegenden Buches als auch Carol Emshwiller bestätigt. In soweit ist “Emshwiller : Infinity X 2” ein nicht unbedingt radikales, aber uneingeschränkt empfehlens- und lesenswertes Künstlerportrait. Was den Band aber zu einem visuellen Ereignis macht, ist der Nachdruck von hunderten seiner Bilder. Nur selten hat man die Titelbilder der populären Science Fiction Magazine wie “If” oder “The Magazine of Fantasy and Science” in dieser Qualität betrachten können. Die meisten Abbildungen sind im Vergleich zu den Originalformaten der Magazine leicht bis mittel verkleinert, die Details sind aber immer noch gut zu erkennen und wie schon angesprochen führen Eisensteins Anmerkungen den Leser sicher durch Emshwillers Werk. Es sind Sendboten einer der vielen Übergangszeiten der Science Fiction, in welcher die reine Technik und das Pulpabenteuer zu Gunsten der ersten Vorläufer der New Wave - siehe Philip K. Dick - wichen. In den vielen Bildern kann sich der Leser//Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes verlieren. Ein interessanter Band, ein nuanciertes und über weite Teile vielschichtiges Portrait einer Künstlerfamilie. Mit den Zitaten der eigenen Kinder über den etwas exzentrischen, Hippie Vater schließt der Band auf einer treffenden Note. Insbesondere wer bislang den SF Magazinen nur einen flüchtigen Blick zugeworfen hat, wird sich nach der abgeschlossenen Lektüre mit ED EMSH intensiver auseinandersetzen und innerhalb seines Werkes etwas Zeitloses, Progressives und stetig Suchendes entdecken.
In den siebziger Jahren gehörte die Identität James Tiptree jr. zu den besten Geheimnissen der Science Fiction Literatur. Mit einer Handvoll ungewöhnlicher Geschichten und einem breiten Themenspektrum – auf gerade zu klassischen Genreregeln aufbauend – schrieb sich Tiptree an die Spitze der im Wandel zum New Wave befindlichen Science Fiction. Dabei wurde heftig sowohl über die Identität als auch das Geschlecht Tiptrees diskutiert. Wie Julia Phillips in ihrer atemberaubend zu lesenden Biographie darlegt, verlor James Tiptree und damit ihr Alter Ego Alice Sheldon an Faszination als ihre Identität gelüftet worden ist. Niemand hatte mit einer über sechzig Jahre alten Dame und ausgebildeten Psychologin gerechnet. Über vierhundert Seiten umfasst Julie Phillips „James Tiptree Jr.: The Double Life of Alice Sheldon“ Biographie. James Tiptree Jr. tritt erst nach über zweihundert Seiten auf die Bühne ihres Werkes. Bis dahin hat Julie Phillips genauestens analysiert, warum sich Alice Sheldon nicht nur ein männliches Pseudonym ausgesucht hat, sondern hinter der Fassade der Anonymität sowohl als Schriftstellerin als auch als Frau/ Mensch aufblühte. Die Wurzeln ihrer verschiedenen Identitäten – auch unter dem zweiten Pseudonym Racoona Sheldon hat sei eine Reihe von Kurzgeschichten veröffentlicht, von denen „The Screwfly Solution“ für die „Masters of Horror“ gerade von Joe Dante verfilmt worden ist – liegen in ihrer behüteten Jugend und vor allem ihrer Schüchternheit. Obwohl sie sich in ihren Geschichten immer wieder mit sexuellen Themen auseinandergesetzt hat, lebte sie nur einen kleinen Teil ihrer wilden Obsessionen in ihrer kurzen ersten Ehe aus. Obwohl sie sich allerdings Zeit ihres Lebens zu Frauen hingezogen gefühlt und ihre Prosa unter dem männlichen Pseudonym von Sympathien der Frauen- Bewegung durchsetzt sind, hat sie niemals mit einer Frau geschlafen. An dieser konträren Position zeigt sich die innere Zerrissenheit Sheldons. Kopf und Herz sind oft in ihrem Leben nicht um Einklang gewesen.
Als einziges Kind wohlhabender Eltern ist Alice Sheldon 1915 geboren worden. Ihre Eltern nahmen sie schon in jungen Jahren auf Expeditionen in das damals noch unerforschte Innere Afrikas mit. Sie illustrierte die Jugendbücher ihrer Mutter. Nach einem abgebrochenen Studium und einer wilden Ehe, in welcher sie durchaus als Alkoholikerin und Drogenabhängige bezeichnet werden kann, meldete sie sich im Zweiten Weltkrieg freiwillig in amerikanische Frauenkorps – ihre erste direkte Enttäuschung in Hinblick auf die Frauenbewegung – der Armee. Sie arbeitete in der Fototaufklärung und lernte hier ihren zweiten Ehemann kennen. Nach dem Krieg arbeiteten beide für das CIA, Sheldon beendete eher frustriert ihre Karriere bei der CIA, ihr Mann wurde ein hochrangiger Geheimnisträger.
Als ein lebenslanger Science Fiction Fan fühlte sie sich mit der New Wave berufen, einige Kurzgeschichten als Hobby zu verfassen. Julie Phillips zeigt sehr schön auf, wie das Genre und in diesem Fall dessen Leser quasi intellektuell zusammenwachsen, auch wenn Tiptree zumindest zu Beginn mit sehr viel bissiger Ironie mit den Frauenfeindlichen Versatzstücken der Pulpmagazine gespielt hat. Erst als ihre Kurzgeschichte auf Interesse bei verschiedenen Magazinen gestoßen und angekauft worden sind, baut sie dieses Hobby aus und macht aus Tiptree einen geheimnisvollen Unbekannten. Phillips beschreibt sehr intelligent und emotional packend, wie diese unscheinbare Frau auf der einen Seite als anonymer Schriftsteller eindrucksvolle Kurzgeschichten und Novellen – ihre beiden Romane gehörten zu ihren schwächeren Arbeiten – verfassen, auf der anderen Seite aber ihrem eigenen Leben gegenüber eine schwer verständliche ambivalente Haltung einnehmen konnte. Aus der unglaublich dicht recherchierten Biographie geht hervor, dass Alice Sheldon bis auf die kurze Zeit ihrer ersten wilden Ehe mit der Flucht in Betäubungsmittel immer unter dem direkten oder indirekten Einfluss ihrer sehr talentierten Mutter gestanden hat. Der frühe Tod ihres Vaters hat sie emotional betäubt, obwohl sie diese Tatsache erst sehr viel später auch durch die Wahl des Juniors in ihrem Pseudonym sich eingestanden hat. Mit ihrem zweiten, deutlich älteren Mann lebte sie sehr viel ruhiger, aber auch in Bezug auf ein soziales Umfeld sehr abgeschieden. Ihre zweite Ehe hat sie als Vernunftehe mit unbefriedigendem Sex akzeptiert. Erst im Alter hat sie nicht zuletzt aufgrund ihrer immer stärker werdenden Depressionen eine Ehe als solide Basis ihres Lebens gesehen. Mit der Maske des James Tiptree jr. konnte sie nicht nur ihre inneren widersprechenden Gefühle nicht nur in ihren Geschichten, sondern in ihren vielen Briefen und seltener ihren Essays ausdrücken. Für viele Leser stellte James Tiptree jr. eine Art lieber, aber unterkühlter Gentleman dar, welcher auf alle Fragen des Lebens eine Antwort wusste. Julie Phillips arbeitet auch psychologisch sehr intensiv heraus, dass nach einigen Jahren des Erfolges Alice Sheldon irgendwie auch ihr dominierendes Alter Ego James Tiptree jr. in die Schranken weisen wollte. Mit der Aufdeckung des Pseudonyms brach aber ihre literarisch geordnete Welt zusammen und für einige Jahre verstummte Tiptrees einzigartige Stimme. Obwohl sie später noch einige eindrucksvolle Geschichten geschrieben hat, ist der Bruch in ihrem Werk mit der Aufdeckung seines Geschlechts unverkennbar.
Julie Phillips macht den großen Fehler vieler Biographen, eine derartig vielschichtige, aber auch schwierige Persönlichkeit beurteilen zu wollen. Wie bei einer Zwiebel schält sie fundiert die einzelnen Schalen ab, enthüllt die Persönlichkeit und zeigt ihre Handlungen im Kontext ihres persönlichen Lebensabschnitts. Dabei nutzt sie in erster Linie Alice Sheldons eigene Aufzeichnungen und Briefe, sowie ihr literarisches Werk. Sie lässt viele Entwicklungen eher durch Dritte kommentieren, das macht die hier vorliegende Arbeit so lesenswert und vielschichtig.
Der Leser hat die Möglichkeit, über Alice Sheldons Persönlichkeit in das Werk James Tiptree jrs. einzusteigen. Obwohl es Alice Sheldon wahrscheinlich zu ihren Lebzeiten in Abrede gestellt hätte, agiert sie teilweise wie ein Mensch, der unter einer Multiplen -Persönlichkeitsstörung leidet. Das zeigt sich spätestens an der Tatsache, dass sie als Rancoon Sheldon eine andere Schreibmaschine und andere Farbbänder benutzt hat, sowie das Tiptree für die junge neue Autorin Empfehlungsbriefe geschrieben hat. Am Ende des Buches hat der Leser das Gefühl, nur die Oberfläche einer der faszinierendsten Figuren der modernen Science Fiction Literatur kennen gelernt zu haben. Julie Phillips lädt mit ihrer absolut lesenswerten Biographie den Leser ein, James Tiptree Jr.s Werk noch einmal aus einer gänzlich unbekannten Perspektive zu entdecken. Auch wenn es keine einfache Reise ist, betont sie die positiven Facetten Sheldons schwieriger Persönlichkeit, verschweigt aber nicht die krankhaften Abgründe wie den Mord an ihrem Ehemann und ihren Selbstmord.
TRASH & TREASURY
Beitrag Biographien von Thomas Harbach
vom 10. Okt. 2008
Weitere Beiträge
|
|
Eine kleine Welt neben der Eigenen
Thomas Harbach |
|
|
Meine Nachbarn, die Nazis
Thomas Harbach |
|
|
Space and Haldeman
Thomas Harbach |
|
|
Brian W. Aldiss- Leben eines schreibenden Engländers
Thomas Harbach |
|
|
Green for Science Fiction
Thomas Harbach |
| [Seite 1] [Seite 2] [Seite 3] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info