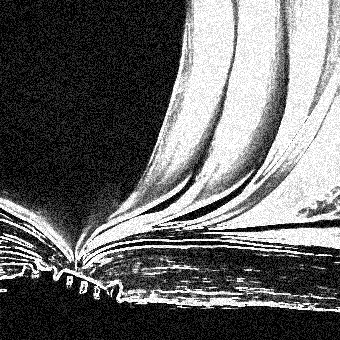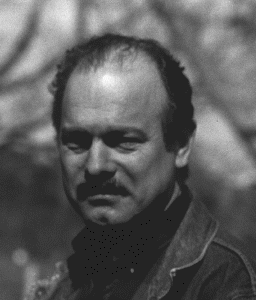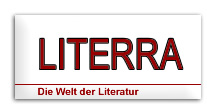
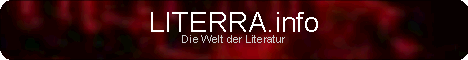
|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > TRASH & TREASURY > My Neighbour-the Alien |
My Neighbour-the Alien
1. Seite : First Contact gehören seit Beginn der Science Fiction zum Grundbestand des Genres. Viele Autoren haben ganze Karrieren auf diesem einzigartig faszinierenden Thema aufgebaut. Das es auch noch nach mehr als achtzig Jahre gelingt, originelle und interessante Aspekte dem Thema abzugewinnen, zeigen insbesondere die in den achtziger und neunziger Jahren erschienenen Romane von Stephen L. Burns und Octavia Butler. Mit Joe Haldeman und Alan Steele haben sich zwei sehr unterschiedliche Autoren in den letzten beiden Jahren mit der ersten Begegnung mit dem “Fremden” auseinandergesetzt.
Joe Haldeman hat in den letzten Jahren mit kurzweilig zu lesenden Romanen wie „the Guardian“ überrascht. Nachdem er sein Post „The Eternal War“ Trauma mit belanglosen und uninspirierten Fortsetzungen überwunden hat, konzentriert er sich auf das Geschichtenerzählen. Seine Romane sind immer erstaunlich kompakt im Vergleich zum überschaubaren Umfang, stilistisch ansprechend mit einer interessanten Mischung aus nicht gekünstelter Ironie und einem Glauben an das Gute im Menschen. Letzteres weder per se noch als Freibrief, aber insbesondere seine Frauencharakter überraschen in ihrer Dreidimensionalität. Mit „Camouflage“ wagt selbst der Ideenautor Joe Haldeman ein Experiment für seine Verhältnisse. Ein von der Prämisse und seinem Plot her unorigineller Roman: zwei Außerirdische sind seit vielen Jahrmillionen auf der Erde gestrandet. Sie wissen nichts voneinander. Erst als ihr Raumschiff von den Menschen geboren wird, zieht sie etwas wie magisch an die Fundstelle des Artefakts. Beide Außerirdische kommen offensichtlich von unterschiedlichen Welten und sind namenlos. Wie der Originaltitel “Camouflage” schon preis gibt, verstecken sich die beiden sehr unterschiedlichen Aliens auf ihre Art und Weise unter den Menschen. Der “Changeling” kommt von einer Welt mit einem erratischen Orbit, so dass er Klimata wie auf dem Merkur genauso gewohnt ist wie die harschen Bedingungen des Plutos. Es kann sich in jedes Wesen verwandeln, auch wenn diese körperliche Veränderung mit Schmerzen verbunden ist. Aber es ist sehr lernfähig, nicht nur was den alltäglichen Überlebenskampf angeht, sondern seine persönliche Neugierde macht es empfänglich auf die neue dominierende Spezies des Planeten Erde. Das “Chamäleon” besitzt menschliche Form, kann innerhalb eines Augenblicks jedes menschliche Wesen imitieren und ist ein unkontrollierbarer Killer- der instinktive Tötungsdrang geht über das simple Überleben hinaus und artet in Sadismus aus - , der nur für das eigene Vergnügen lebt. Unwillkürlich fällt dem Leser diese Beschreibung der unbesiegbare am Ende flüssige “Terminator” aus James Camerons Fortsetzung ein, während das andere Wesen direkt aus Jack Shoulders Low Budget Hit “The Hidden” entstiegen sein könnte. Von der ungezählten Zahl anderer literarischer Epigonen ganz zu schweigen. Die beiden Wesen begleiten die Menschheit und abwechselnd berichtet Haldeman mehr oder minder von ihrem Leben auf der Erde. Zum einen ist Haldemans Stil ungewöhnlich pointiert und knapp. Es gibt nur wenige längere Beschreibungen und hält sich der Leser vor Augen, wie viel Material in diese Abschnitte einfließt, wird er mehr an eine Sammlung sekundärliterarischer Artikel als einen Roman erinnert. Bei seiner Reise durch die menschliche Geschichte konzentriert sich Haldeman auf den “Changeling”, es gelingt ihm diesem Gestaltswandler tatsächlich eine wieder erkennbare und überzeugende Form von Persönlichkeit zu geben. Auch die Abstecher in die militärische Auseinandersetzung fehlen nicht. Zum einen beschreibt Haldeman die Qualen, unter denen die von den Japanern im Zweiten Weltkrieg gefangen genommen amerikanischen Soldaten zu leiden hatten, zum anderen die Experimentierfreude des “Chamäleons” unter Josef Mengele, den er schließlich in Argentinien aufspürt und - nur um das Kapital abzuschließen und nicht aus anderen emotionalen Motiven - umbringt. Wenn der “Changeling” Sex entdeckt, wird Joe Haldeman auf eine originelle Art und Weise unterhaltsam lustig und das Buch erinnert an eine erwachsene Version von John Carpenters “Starman”. Mit dem offensichtlichen Bösewicht kann Haldeman als Autor weniger anfangen. Es ist von Beginn an böse, weil es seine Lebensart vorschreibt. Obwohl es unter den Menschen seit vielen Jahrtausenden lebt, geht Haldeman auf seine Motive nicht ein und überlässt für beide Wesen ihre einzigartigen Fähigkeiten dem Reich der Fabel. Diese konsequente Weigerung, die Fremden näher zu sezieren und eigene Thesen aufzustellen, macht weite Strecken der Handlung zu einem eher inkonsequenten und unnötig distanzierten Lesevergnügen. Der menschliche Charakter - immerhin hat er die leidvolle Aufgabe, ein unbekanntes und natürlich unzerstörbares Artefakt aus einem gänzlich fremden Metall zu untersuchen - erinnert an die Wissenschaftler aus den vielen Kurzgeschichten der “Analog” Magazine. Ganz klar, für Haldeman haben die Aliens auf unserer Erde - auch wenn es nur zwei sind - das bessere Leben. Sie können stehlen und töten, sind überdurchschnittlich intelligent und gut aussehend - wenn sie es wollen - und außerdem haben sie Sex. Und verlieben sich auch noch in den frustrierten Forscher auf Samoa, der mit seinem Latein am Ende ist. Wenn Haldeman diesen Teil seines Romans als Satire auf die unzähligen Science Fiction Encounter Geschichten angelegt hat, ist ihm die Zusammenstellung des Plots nicht unbedingt gelungen und seine Intention hinter seinem sachlichen Stil verschwunden. Das er seinen Roman nicht ernst nimmt, lässt sich an mehreren Beschreibungen gut ablesen, alleine es fehlt der Bogen, der zu einer guten Satire und Aneinanderreihung von Klischees gehört. Irgendwie erinnert der Roman an einen Michael Crichton Thriller, packend und rasant geschrieben, doch das Hirn stimulierend wie Hamburger von McDonalds einen Gourmet zufrieden stellt. Außerdem hat sich Haldeman in erster Linie auf einen - den zwar interessanteren - Alien konzentriert, so dass die Balance im Aufbau stellenweise sehr unbefriedigend ist und die zu kurzen Kapitel eher an ein Expose als einen fertigen Roman erinnern. “Camouflage” ist ein nicht unbedingt zufrieden stellender Roman, eine Geschichte, die sich auf der Reise sehr gut lesen lässt, die aber ebenso schnell aus dem Gedächtnis wieder verschwindet und im Vergleich zu seinen letzten, sehr guten Büchern wie ein Scheckbuchkompromiss daherkommt.
Seit vielen Jahren gehört Alan Steele zu den Routiniers der Hard Fact Science Fiction. In seiner „Coyote“- Trilogie, welche das gleiche Universum und teilweise den gleichen Hintergrund mit dem zu besprechenden „Spindrift“ teilt, hat er die Besiedelung einer erdähnlichen Welt durch Menschen beschrieben, die Probleme zwischen Mutter Erde und der kleinen Kolonie und schließlich die Separation. Ganz in der Tradition der Eroberung des Wilden Westens. Sowohl die „Coyote“ als auch der „Spindrift“ Roman bestehen aus unterschiedlich langen Kurzgeschichten und Novellen, die in den gängigen amerikanischen Science Fiction Magazinen vorher veröffentlicht worden sind. Diese Vorgehensweise macht die angesprochenen Themen teilweise komplexer und pointierter – da Steele für jedes Kapitel/ für jede Novelle neu gefordert worden ist -, hemmt aber auch einen kontinuierlichen Lesefluss. In „Spindrift“ – im Grunde zwischen dem zweiten und dritten Band der „Coyote“ Trilogie angesiedelt – geht es um die erste Begegnung mit den Fremden. Im Fokus seines Buches steht das fremde Artefakt. Leider nimmt die wenig spannende Reise dahin die ersten beiden Novellen ein. Zu Beginn des Buches wird es als schwarzes Loch im All beschrieben. Später wird es zu einem Sternentor, das unbekannte außerirdische Intelligenzen vor Jahrtausenden gebaut haben. Weder die Struktur noch die Aufgabe werden im Verlaufe des Buches klar definiert. Das fremde Artefakt wird allerdings von einem Asteroiden begleitet, der sich später als Raumschiff entpuppt. Wie in vielen seiner Romane bemüht sich Alan Steele trotz der phantastischen Prämisse insbesondere in Hinblick auf die extrapolierte menschliche Technik so realistisch wie möglich vorzugehen. Die wissenschaftlichen Grundlagen teilen sich in soweit auf das fremde Artefakt und das eher bodenständig konzipierte Raumschiff Galileo auf. Steele nimmt sich sehr viel Zeit, seinen Lesern das Konzept und die Technik der Galileo zu erläutern. Hier liegt eine der Schwäche des vorliegenden Romans. Wenn der Autor schließlich versucht, auch die außerirdische Technik so detailliert wie irgend möglich zu beschreiben und zu entwickeln, ist der Leser durch die vorangegangenen Kapitel in den ersten Novellen abgestumpft und möchte mehr über die Mission des Artefakts als seine Bestandteile erfahren. In diesem Punkt arbeitet die Novellenstruktur sehr stark gegen einen stringenten Roman. Bei den ursprünglichen Veröffentlichungen liegen ja einige Monate zwischen den einzelnen Teilen und der Leser hat sich inzwischen von dem Ingenieursteil ein wenig erholt. Viele von Steeles frühen Büchern litten auch sehr unter seinem zu technischen Ansatz und seinen hölzernen Charakteren. Gegen dieses Manko kämpft er mit einer sehr interessanten Mischung aus unterschiedlichsten, teilweise allerdings auch klischeehaften Protagonisten an. Da der Leser im obligatorischen Rahmen erfährt, wer die Geschichte überlebt, stellt sich sehr schnell die Frage, unter welchen Umständen die anderen zu Beginn eingeführten Crewmitglieder ums Leben kommen. Das der erste Offizier nicht glücklich ist, einen unerfahrenen und unsicheren Kommandanten vor die Nase gesetzt zu bekommen, ist nicht unbedingt originell. Das einer der Wissenschaftler wegen Massenmord im Gefängnis gesessen hat, schon eher. In einer der am wenigsten überzeugenden Szenen wird dieser von einem Außerirdischen fast bekehrt und darauf hingewiesen, dass Einsicht der einzige Weg ist, mit den Fremden im Gespräch zu bleiben. Hier bemüht sich Alan Steele viel zu sehr um eine Art „2001“ im 21. Jahrhundert. Das die Galileo mit einem Nukleartorpedo an der Außenhaut für alle Fälle auf große Fahrt geht, erhöht zu Beginn des Romans die Spannung, führt allerdings auch am Ende zu einigen Klischees. Richtige Spannung kommt in „Spindrift“ nicht auf. Das Buch ist sehr routiniert und distanziert geschrieben worden. Im Verlaufe des langen Fluges kommt es zu einigen zwischenmenschlichen Beziehungen – homosexuell und heterosexuell. Die Emotionen zwischen den einzelnen Protagonisten flammen auf oder werden durch lange wissenschaftliche Exkurse wieder niedergeschlagen. Mit dem Auftauchen der Aliens erhofft sich der Leser einen Schwung für die Geschichte. Das aber das fremde Artefakt im Großen und Ganzen interessanter und geheimnisvoller ist, als die sie begleitenden Außerirdischen und insbesondere der Lügendetektor am Anfang ihrer Begegnung grotesk und unlogisch erscheint, zeigt, dass Alan Steele sich im metaphysischen Bereich alles andere als wohl fühlt. Konflikte zwischen Menschen zu beschreiben – wie in den „Coyote“ Bänden – und insbesondere auf der Tastatur des heroischen Patriotismus zu spielen, entspricht mehr seinem literarischen Wesen.
Was Steele nicht gelingt, ist das Interesse seiner Leser wirklich zu wecken. Wenn am Ende von „Spindrift“ erkennbar wird, dass es sich um den ersten Band einer neuen Trilogie handelt, ist die Enttäuschung groß. Im Vergleich zu den besser geschriebenen und handlungstechnisch zumindest originelleren, wenn auch nicht herausragenden „Coyote“ Bänden wirkt der vorliegende Roman wie eine Patch Work Arbeit, deren Plot gut in ein oder zwei kompakten Novellen gepasst hätte. Um sich ein endgültiges Bild machen zu können, wird der Leser sicherlich den Mittelband der Serie abwarten können und müssen, aber irgendwie erinnert der erste Band an eine bodenständige Interpretation der alten „Star Trek“ Romane mit der Technik aus „2010“. Und das ist für die gegenwärtige Science Fiction eindeutig zu wenig.
“Call from a distant shore” ist erst Stephen L. Burns zweiter und bislang leider letzter Roman, schon im Jahre 2000 veröffentlicht worden, aber heute noch gut zu lesen. Vorher hat er mehr als fünfzehn Jahre Kurzgeschichten insbesondere im „Analog“ Magazin unter der Ägide Stanley Schmidts veröffentlicht. Diese Schule lässt sich nicht leugnen, auch wenn die extrapolierte insbesondere außerirdische Technik extrem schwammig und eher wie ein MacGuffin als ein notwendiges Plotelement verwendet wird. In der nicht allzu fernen Zukunft haben die Vereinten Nationen ein bemannte Expedition zur Mars ausgeschickt. Das Raumschiff wirkt eher wie ein fliegendes Wrack als das High Tech Ergebnis der gemeinsam operierenden Menschheit. Die Medien nehmen den Bahnbrechenden Flug sehr gleichgültig auf. Aus dem Nichts heraus empfangen sechs unterschiedliche Menschen – darunter die Kommandantin des Raumschiffs – eine kraftvolle geistige Botschaft, in welcher sie aufgefordert werden, dem Absender zur Hilfe zu eilen. In der ersten Hälfte des Buches konzentriert sich Burns darauf, diese sehr verschiedenen Menschen zu charakterisieren. Neben der Kommandantin, die an ihre geistigen Fähigkeiten zweifelt, empfangen unter anderem ein geschiedener Wetteransager in ständigem Kampf mit seiner rücksichtslosen Ex- Ehefrau die Signale, die Leibwächterin und Gespielin eines einflussreichen UN Diplomanten, natürlich der obligatorische TV Priester und ein talentierter Medieningenieur die immer dringender werdenden Botschaften aus den Tiefen des Alls. Burns nimmt sich die Zeit und den Raum, die einzelnen Protagonisten in sehr unterschiedlichen Situationen und Lebensabschnitten zu charakterisieren. Die Figuren wirken dreidimensional und überzeugend. Da er zwischen den einzelnen Schauplätzen immer wieder hin und her springen muss, leidet der Lesefluss teilweise unter dem auf den ersten Blick zerrissenen Plot. Fast nebenbei erfahren die Leser, das auf dem Marsmond Phobos – welch ein Zufall, das die Menschheit ausgerechnet zum Mars strebt – zwei außerirdische Wesen über Jahrtausende Meteoriten abgelenkt haben, welche die Erde bedrohten. Eines dieser Wesen ist gestorben und der Überlebende kann alleine weder seine Aufgabe fortführen noch über längere Sicht auf dem unwirtlichen Mond bleiben. Die einzelnen zufällig ausgewählten Kontaktpersonen – auch wenn Burns einen anderen Eindruck zu hinterlassen sucht – erwartet auf der Erde und an Bord des Marsschiffes ein Hindernislauf zwischen primitiven Vorgesetzten, gnadenlosen Konkurrenten und den Militärs, welche das Geheimnis am liebsten für sich behalten. Um diese im Grunde unmöglichen Hindernisse zu überwinden, greift Burns noch auf einen allmächtigen Computerhacker zurück, der mittels seiner Geheimexistenzen ihren schließlich den Weg in das Kommandozentrum der Raumfahrtmission bahnt. Teilweise überspannt Burns allerdings den Bogen und stellt seinen gut gezeichneten Figuren blanke Klischees gegenüber. Insbesondere der Fernsehpriester, der natürlich gleich an eine Stimme Gottes glaubt und daraus Profit schlägt, wird teilweise zu einer überzogenen Karikatur. Damit nimmt er seinen ansonsten sehr sympathisch gezeichneten Figuren – herausragend die Leibwächterin, die sich nicht eingestehen will, das auch sie sich verlieben kann und der im Grunde harmlose Wetterfrosch, der von seiner karrieregeilen Exfrau nach Strich und Faden dominiert wird – einiges an Effektivität. Für den grundlegenden Plot wäre es allerdings wichtig, nicht nur das Zusammenspiel im Verlaufe des Romans zwischen den menschlichen Figuren zu forcieren, sondern eine Ebene zu dem außerirdischen Rufer zu finden. Dieser verschwindet teilweise über Dutzende von Seiten, um dann im entscheidenden Moment wieder aufzutauchen. Bevor der Roman im handlungstechnischen Niemandsland untergeht, kann der Fremde nicht nur auf Gedankenbotschaften der Menschen antworten – wahrscheinlich liest er deren Gehirne -, sondern in der Tradition „2001“ ein mächtiges Zeichen seiner Existenz von sich geben, das letzt endlich die Verantwortlichen überzeugt, das Marsraumschiff umzuleiten.
Die grundlegende Idee des Kontakt mit gutwilligen Außerirdischen auf einer hinterfragungswürdigen Mission geht in dem kurzweilig zu lesenden Roman fast unter. In der Mitte des Buches erfahren die Charaktere und die Leser von dessen Aufgabe, aber die eigentliche Begegnung findet auf den letzten Seiten ein wenig pathetisch beschrieben statt, ohne das weitere Informationen vermittelt werden. Die emotional menschlichen Geschichten sind zufrieden stellend beendet worden, die außerirdische Geschichte, der obligatorische nächste Schritt wird insbesondere für einen Science Fiction unzureichend abgehandelt. Burns scheut sich deutlich, zu viel Preis zu geben und die Phantasie seiner Leser einzuschränken. Ob er seinen beträchtlichen Fähigkeiten als Autor nicht getraut hat, lässt sich schwerlich sagen, aber dieses teilweise frustrierend offene Ende trotz einer nicht zu leugnenden Happy End Note deutet auf eine mögliche Fortsetzung hin, die bislang nicht erschienen ist. Wie Burns auf seiner Homepage selbst zugibt, haben sich die Verkaufszahlen deutlich hinter den Erwartungen entwickelt. Der Roman selbst ist für den Philip K. Dick Memoral Award nominiert worden, was in erster Linie auf die gute und souveräne Charakterführung sowie die teilweise emotional ergreifenden Elementen zurückzuführen ist. Trotz einiger plottechnischer Schwächen, die auf Übermotivation und nicht mangelnde Ideen zurückzuführen sind, ein interessanter und lesenswerter Roman, der allerdings nur noch antiquarisch zu erhalten ist.
Olivia R. Butler ist eine der wenigen farbigen Science Fiction Autoren gewesen, die nicht nur mehrmals mit dem NEBULA und HUGO Award ausgezeichnet worden ist - in dieser Hinsicht ist sie die einzige -, sondern sich sehr konsequent mit den Aspekten der Humanität in der Vergangenheit - sie hat eine aufrüttelnde Geschichte über die Sklaverei in den USA während des 19. Jahrhundert geschrieben, aus der Perspektive einer modernen Frau, welche in der Zeit versetzt worden ist -, der fiktiven Gegenwart - in ihren beiden Romanen um den Säer hat sie eine nihilistische Gegenwart entworfen - und der fernen Zukunft - ihre „Xenogenesis“ Trilogie ist nicht leicht nur lesen und stellt in Hinblick auf ihr Gesamtwerk eher einen publikumsfreundlichen Kompromiss dar, extrapoliert aber auf einzigartige Art und Weise ihre Ideen - auseinandergesetzt. Vor wenigen Jahren ist sie durch einen tragischen Unfall - einen Treppensturz - ums Leben gekommen und das Interesse an ihrem Werk droht zu versiegen. Von ihrem Dutzend Romanen ist nur „Clay´s Ark“ nicht auf Deutsch erschienen. Das Buch ist 1984 das erste Mal erschienen, 1996 folgte eine Neuauflage. Von der Ausrichtung her gehört es zu ihren frühen „Seeker“ Romanen, die alle im Bastei Verlag erschienen sind. In ihnen setzt sie sich vor einem utopischen Hintergrund mit verschiedenen außerirdischen Daseinsformen auseinander, welche unschwer als Parabeln auf die menschliche Existenz mit all ihren Vorurteilen und Scheuklappen zu erkennen sind. Das klassische Science Fiction Elemement ist im vorliegenden Buch unterentwickelt und diese nur als Katalysator der kommenden Ereignisse. Ein mit 14 Menschen bemannte Raumfahrtexpedition zu Proxi Centauri kehrt zur Erde zurück. Bis auf ein Mitglied sind alle Besatzungsmitglieder an einem fremdartigen Virus verstorben. Das Schiff landet in der Wüste, das einzige überlebende Besatzungsmitglied verschwindet, um bei einer sich selbst versorgenden Familie in der Wüste unterzukommen. Auf der zweiten Handlungsebene beginnt der Roman mit einer Reise durch die südkalifornische Wüste. Dr Blake Maslin und seine beide Zwillingstöchter werden von einer Bande brutal aussehender, aber sich anders verhaltender Autodiebe entführt. Schon bei der Entführung stellt Maslin fest, dass die Entführer übersensible Sinnesorgane haben und körperlich trotz ihrer schmuddeligen Kleidung in einem zwiegespaltenen Zustand sind. Sie sind nur bis auf die Knochen abgemagert, ihre Kräfte stehen aber in keinem Verhältnis zu ihrem Aussehen. Auf der Farm wird ihnen die auf den ersten Blick bizarre Geschichte von einem außerirdischen Virus erzählt, welchen der Astronaut unter seine Gastfamilie verbreitet hat. Anscheinend verstärkt das Virus bestimmte Fähigkeiten der Menschen zu Lasten anderer Aspekte. Der Anführer der Farmer Eli möchte Maslin und seine Töchter als neue Mitglieder der Familie begrüßen. Die jungen Frauen sollen sich entsprechende Männer aussuchen, um eine neue Generation der Virusträger zu gebären. Diese unterschieden sich inzwischen auch sehr stark körperlich von den Menschen. Voneinander isoliert müssen sich Maslin und die beiden Töchter entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Ganz bewusst erweitert Octavia Butler ihren Plot von der persönlichen Ebene im Verlaufe des Buches wieder zu einem klassischen Alien- Invasionsthriller. Ohne die humane Grundlage könnte diese Vorgehensweise nicht überzeugend funktionieren. Als Basis entwickelt sie eine Handvoll von interessanten, aber nicht unbedingt sympathischen Figuren. Das Zusammenspiel zwischen „Entführten“ und Tätern wird von ihr immer wieder unterbrochen, dem Leser unter anderem auch in der Form von Rückblenden weitere elementare Informationen zur Verfügung gestellt und schließlich aufgezeigt, das die Menschen in unmittelbarer Umgebung der Farm auf ein primitives Niveau auch ohne den Einfluss des Virus degeneriert sind. Außerhalb der Farm hat Octavia Butler ein Szenario auf der „Mad Max“ Filmebene entwickelt, mit einer seine Resourcen erschöpften Erde und einem stetigen Überlebenskampf. Diese kompetent geschriebene Handlungsebene nimmt nach dem Einführungskapitel im klassischen Showdown wieder ein stärkeres Gewicht ein. Das ihr diese Szene nicht unbedingt liegen, zeigt sie, in dem sie den ruhigen Auftakt überkompensiert und teilweise gruselig brutal den Zusammenprall zwischen Farmern und der Bande zeigt. Damit rückt sie ihre Mutanten natürlich automatisch auch in ein positiveres Licht und lässt den Lesern mit ihnen hoffen, das sie etwas Gutes für die zerrüttete Menschheit darstellen könnten. Treu nach dem Motto: und bist du nicht willig, dann brauch ich Gewalt. Zu den Stärken der Autorin gehört es, sehr komplex und gut strukturiert eine überraschend ansprechende Geschichte über die im Grunde wilde Natur des Menschen zu erzählen, ohne handlungstechnisch zu viele Klischee der First Contact Idee zu übernehmen und intellektuell zu polemisch zu argumentieren. Wie in vielen anderen ihrer frühen Romane will die Autoren keine Botschaft verschicken, sondern in wenigen Worten lässt sie ganze nicht immer leichte Leben entstehen. Ganz bewusst reduziert sie zu Gunsten ihrer Figuren die Umgebung. Karg und unwirtlich wie die Wüste ist das Leben der Charaktere. Und wenn man Ende eine Veränderung der ganzen Welt droht, handelt sie dieses Thema in nur wenigen beiläufigen Sätzen ab. Der Leser weiß inzwischen, das die anstehende Veränderung nicht automatisch negativ sein muss. Ihr Augenmerk in diesem kompakten Roman liegt auf dem Menschsein und welche positiven wie negativen Eigenschaften den Menschen leiten. Dabei sind Rassismus und Brutalität eine genauso starke Antriebsfeder wie Familie und grenzenloser Optimismus. In vielerlei Hinsicht hat Octavia Butler in ihrem Roman ein Spielbild des Schmelztiegels der amerikanischen Gesellschaft niedergeschrieben, in welche mit dem außerirdischen Virus eine positive, aber nicht umzukehrende Veränderung eindringt. Diese über die Science Fiction Ebene kommende Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen sozialen Problemen macht „Clay´s Ark“ zu einem heute noch interessanteren Buch als in den achtziger Jahren und lohnt eine Wiederentdeckung.
TRASH & TREASURY
Beitrag My Neighbour-the Alien von Thomas Harbach
vom 13. Jan. 2008
Weitere Beiträge
|
|
Eine kleine Welt neben der Eigenen
Thomas Harbach |
|
|
Meine Nachbarn, die Nazis
Thomas Harbach |
|
|
Space and Haldeman
Thomas Harbach |
|
|
Brian W. Aldiss- Leben eines schreibenden Engländers
Thomas Harbach |
|
|
Green for Science Fiction
Thomas Harbach |
| [Seite 1] [Seite 2] [Seite 3] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info