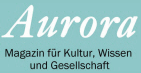|

...
Teresa Präauer: Aus: Drei
"Kopftuchköpfe". 40 x 40. Buntstift, Tusche, Aquarell/Papier. 2006
Wie man schwarze Augen trägt*
wenn die Klischees zu Bildern werden
Beim
Blättern durch alt gewordene rumänische Reiseliteratur entdecke ich sie
immer und immer wieder: beispielsweise die rosenrankenden Tuchmuster, die
die Frauenköpfe ummanteln. Die einen Rahmen bilden um ein Augenpaar, das
sich entdeckt fühlt, im Vorüberfahren noch einmal skeptisch blinzelt oder
aber bereitwillig grinst, sich zeigt und ausstellt: den Frauenkörper, in
Pose geworfen und ausgestattet mit einem Kopftuch als stereotyp gewordenes
Accessoire des Rückständigen, als unmodisches Attribut unserem Blick längst
lästig. Das Kopftuch steht nicht immer oder schon lang nicht mehr für
Schmuck, sondern für Arbeit und Zweckmäßigkeit, für unschicken Schutz vor
Wind und Wetter, auch: für das weibliche Sich-Verstecken, Sich-Anschmiegen,
Sich-Einpassen in eine Gesellschaft, in der der Mann das Lenkrad von
Fortschrittlichkeit und Mobilität in seiner Hand hält. Und
hier fällt mir eine zweite Abbildung ein, die für das Rumänien der
Reiseführer als Metapher gelten könnte: ein Pferdefuhrwerk, dessen klobige
Räder das Gehäuse, die Blech-Ummantelung eines Autos ohne Fahrgestell
tragen. Am Lenkrad sitzt ein frecher Kerl, der, von seinen Kumpanen
flankiert, die Straße einer Ortschaft entlang rattert, wie um sein Besitztum
öffentlich zu machen. Diese neue Hülle über altem Werkel könnte aber nicht
nur dazu dienen, politisch-wirtschaftlich-gesellschaftliche Bedingungen von
Fortschritt und Fortschreiten zu illustrieren, sondern ihre Frage an die
Bildhaftigkeit selbst zu stellen: Das Klischee hat als Werkzeug des
mechanischen Vervielfältigungsprozesses die Vormachtstellung über die Form
des gedruckten Abbilds. Es fragt, so scheint es mir in der beschriebenen
Abbildung, für welche neuen Bildvorlagen wir unsere alten entsorgen.

...
Teresa Präauer: Aus: Drei "Kopftuchköpfe". 40 x
40. Buntstift, Tusche, Aquarell/Papier. 2006
.....
Sodann:
In dem entsorgten Material der aus der Mode gekommenen Bilder kann nun die
mit einem Pinsel bewaffnete Hand fischen und finden. Dort, wo die Klischees
entsorgt sind, befriedet sind, sich nicht mehr als Hingucker andienen.
–
Aber hier ist noch etwas aufgeladen! Und da schlägt die fette Farbspur der
Erinnerung durch, und manchmal bemerkt man, dass das entsorgte Bild, wo es
als Paus-Papier über dem aktuellen, zeitgemäßen zu liegen kommt, noch
gemeinsame Konturen findet.
Einen Dienst an der Erinnerungsarbeit, die Denken ist, scheint auch die
Mode, prêt à porter et traduire, zu leisten,
wenngleich sie sich für den kuscheligen Teil der Arbeit entscheiden darf:
sie nimmt sich die Zeichen ohne Rücksicht auf deren Bedeutung. Im Winter
2006/07 führen bestickte Felljacken und Reiterstiefel vorindustriell
anmutenden Osteuropa-Schick in der Wiener Innenstadt spazieren.
Das Schönste bei der Weihnachtsmesse im ländlichen
Oberösterreich der 50er und 60er Jahre sei es gewesen, nach der Bescherung
alle Köpfchen durchzuzählen und dabei zu prüfen und zu entdecken, wie denn
das jeweils neue Tüchel der Freundin oder Nachbarin aussähe,
erzählt mir meine Mutter schmunzelnd. Ich stelle mir das als großes buntes
Ornament der floral-geometrischen Neuigkeiten vor, von oben gesehen ein
Teppich aus Locken, Tüchern, Mustern, Bändern über den kalten, steinernen
Boden der Landkirche gestreut.
Dort entsteht – bei mir, in meiner Arbeit –, ganz nostalgiefrei, eine Lust,
alles, was es gibt und was geboten wird, als Bild aus Struktur und Form zu
betrachten. Im neuen und alten Abbilder-Müll zu stöbern und herauszuziehen,
was noch leuchtet. Und dort hinzuhören, wo Sprache zischt und Rhythmus hat
und sich die Bilder zu den Worten gesellen und umgekehrt. Wo sie in der
Vorstellung tief farbig werden, satt an Farbe. Dort hinzuhören, wo das Bild
zu sprechen beginnt und beispielsweise etwas beschreibt vom Ausstaffieren
der menschlichen Figur, sodass der Körper wieder seinen Weg heraussuchen
muss aus dem Stoff und überall hervorbricht, wo eine Öffnung vom Spitzensaum
vorgegeben und eingefasst worden ist.

...
Teresa Präauer: Aus: Drei
"Kopftuchköpfe". 40 x 40. Buntstift, Tusche, Aquarell/Papier. 2006
...
Dass
die Menschen auf diesen Bildern wie Berge sind, Tuchhügel mit Gesichtswald
voller Lebensbäume und Lippen-Wall, rot gekennzeichnet. Hier ist es
vielleicht, das Gesicht, ganz "Wüstenhochebene, sehr
bewegt, pathetische schrundige Wirbel, Flammen, drinnen, vertufft",
wie der rumänische Dichter Caius Dobrescu schreibt. Es sind
Skulpturengesichter mit Turmfrisuren, von Blumentüchern umknotet, mit
Spangen am Haar gehalten. Es ist schwarzer Rock- und Kopftuchstoff mit
leuchtend pinken Rosen, die aus Frauen Kegelfiguren und aus ihren umrissenen
Köpfen Trapezformen machen, ein ganzes Schlemmer-Ballett der
Bindebänder und Wickelschürzen um Menschenmitten mit kostbaren
Seidenquasten. Auftritt der Filzhut als Kopfputz mit
Pfauenfederbuschschmuck, die Hemden, an Ärmeln gefaltet, der Brustpelz aus
Schafsfell zu Tuchhosen, Strümpfen, Schaftstiefeln. Das Tuch, das die
Trägerin selbst zum eckigen Zeugstück macht. Die erstarrte Pose fürs
Bildquadrat und ihre Sammlung der Farbigkeiten und Menschenblicke und
Tuchmuster. Aus all dem Abgelegten blickt eins aus dem Plissee der
Farbschichten: schöner ein Gesicht, wie Klopstock singt, und dies tut
es stets gegenwärtig.
Anmerkungen
...
Der Titel "Wie
man schwarze Augen trägt" verweist auf das
"Taschenpoem" von Filip
Brunea-Fox, übersetzt von Ernest Wichner in der Lyrik-Anthologie
"Auf der Karte Europas ein Fleck".
Zürich. 1991. (= Ammann) Einige
Gedichte von Caius Dobrescu sind nachzulesen in einem Buch über
"Poesie aus Rumänien":
"Ich ist ein andrer ist bang",
herausgegeben von Gregor Laschen. Der vorliegende Text "wie
echt" ist übersetzt von Werner Dürrson.
Bremerhaven. 2000. (= edition die horen)
*Buchtipp
Der obige Artikel ist auch erschienen in: Kristina Werndl
(Hg.).
Rumänien nach der Revolution. Eine
kulturelle Gegenwarts-
bestimmung. Braumüller, 2007, 210 S. ISBN:9783700316183
|