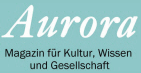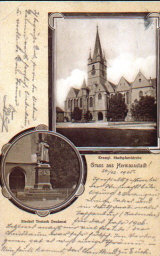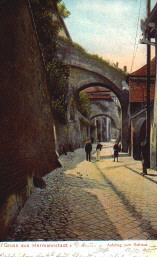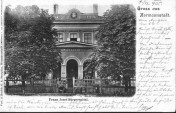|
...... |
|
... |
|
...
Historische
Postkarten
"Fanz-Josef-Bürgerspital"
"Ratturm" |
Um die Mitte des 12. Jahrhunderts rief der ungarische König Geisa deutsche SiedlerInnen nach "Transsylvanien" (in das Land "jenseits der Wälder"), das spärlich besiedelt und den Angriffen der Wandervölker (Kumanen, Petschenegen, Tataren) ausgesetzt war ("ad retinendam coronam"). Die SiedlerInnen stammten vom Niederrhein, aus dem Gebiet zwischen Trier und Luxemburg. Die Siebenbürger Sachsen, wie sie später genannt wurden (im Mittelalter wurden die Deutschen als "saxones" bezeichnet), sprachen und sprechen moselfränkische Mundarten, die für Sprachforscher interessant sind, weil sie den Sprachstand des 12. Jahrhunderts widerspiegeln. Die SiedlerInnen erhielten von der ungarischen Krone als Gegenleistung für die Verteidigung der Südgrenze entlang der Karpaten und für die Kolonisation des Landes verschiedene Vorrechte (Erhebung von Steuern für eine bestimmte Zeit, rechtliche und kirchliche Selbstverwaltung), die in dem "Goldenen Freibrief" von 1222 festgehalten und später immer wieder bestätigt wurden. Die deutschen SiedlerInnen waren mehrheitlich Ackerbauern und Handwerker, die eine überlegene Produktionsform aus Mitteleuropa in diesen Raum brachten. Sie legten in etwa 250 Dörfern befestigte Wehrburgen, sogenannte "Kirchenburgen" an und bauten befestigte Städte, an denen sich die Landesfeinde (ab dem 15. Jahrhundert waren es die Türken) oft genug die Zähne ausbissen. Die Siebenbürger Sachsen organisierten sich in sieben Stühlen (daher der Name "Siebenbürgen" für den von ihnen besiedelten Teil Transsylvaniens), deren Vorort die "Haupt- und Hermannstadt" wurde, wo der "Sachsencomes" als oberste Verwaltungsinstanz residierte. Im 15. Jahrhundert schloss man sich zur sogenannten "Nationsuniversität" zusammen, die ihren Sitz ebenfalls in Hermannstadt hatte. Andere bedeutende Städte der Sachsen in Siebenbürgen waren Kronstadt, Mediasch und Schäßburg, im Westen Broos und Mühlbach, und im Norden Bistritz. Bis zur Reformation gehörte das Sachsengebiet zum Erzbischof von Graan, ab 1541 setzte sich die Reformation in Hermannstadt und dann im gesamten Sachsengebiet durch. Der evangelische Bischof hatte seinen Sitz in Birthälm und ab 1867 in Hermannstadt. Nach der für die ungarische Krone verlustreichen Schlacht von Mohács (1526) wurde Siebenbürgen ein unabhängiges Fürstentum, das bloß der Türkei tributpflichtig war. Als Folge der Friedensschlüsse von Karlowitz (1699) und Passarowitz (1718) kam Transsylvanien zur Habsburger Monarchie und Hermannstadt wurde Verwaltungssitz der österreichischen Administration. Für die Kultur wichtig wurde in jener Zeit der gebürtige Siebenbürger Sachse Baron von Brukenthal, der zeitweilig Gubernator von Siebenbürgen war. Nach seinem Tod wurden dessen Sammlungen (Gemälde, Münzen, Bücher usw.) der sächsischen Nation zur Verfügung gestellt. Das "Brukenthalmuseum" wurde mithin zum ersten Museum auf dem Gebiet des heutigen Rumänien. 1867 wurde durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich die Eigenverwaltung ("Königsboden") der Siebenbürger Sachsen zerschlagen und die "Nationsuniversität" einige Jahre später aufgelöst. 1918 kam Siebenbürgen als Folge der verlorenen Kriege zu Rumänien. In Hermannstadt tagte der Provisorische Verwaltungsrat ("consiliul dirigent"), der den Anschluss an das Königreich Rumänien dekretierte. Die Siebenbürger Sachsen hatten die Zeichen der Zeit verstanden und schon im Januar 1919 ein Loyalitätsbekenntnis abgegeben. In der NS-Zeit war Hermannstadt zeitweilig Sitz der sogenannten "Deutschen Volksgruppe". Nach dem II. Weltkrieg wurde es verwaltungsmäßig dem Bezirk Kronstadt eingegliedert und 1968 als eigenständiger Kreis organisiert, was es bis heute geblieben ist. Es gehört nach Ausdehnung und Bevölkerungszahl zu den mittelgroßen Kreisen Rumäniens. Wo vor der Wende noch etwa 100.000 Deutsche lebten (in Hermannstadt zählte man 1940 noch 30.000 Siebenbürger Sachsen, also 50 % der Bevölkerung), wohnen heute nur noch rund 2.000 Deutsche in der Stadt; das entspricht etwa 1,6 % der Stadtbevölkerung. In Hermannstadt gibt es ein deutsches Gymnasium ("Brukenthalgymnasium"), eine deutsche Lehrerbildungsanstalt (die einzige in Rumänien), ein halbes Dutzend Untergymnasien mit deutschen Abteilungen, desgleichen mehrere deutschsprachige Kindergärten. Seit über 50 Jahren werden evangelische Pfarrer am "Protestantischen Theologischen Institut" ausgebildet. 1969 wurde für die deutsche Minderheit eine Germanistikabteilung innerhalb der neu gegründeten philologischen Fakultät ins Leben gerufen, die heute über 400 Studierende beherbergt, Deutsch sprechende LehrerInnen, JournalistInnen und ÜbersetzerInnen ausbildet und zahlreiche internationale Kontakte pflegt. Das deutsche geistige Leben wird auch von der Presse getragen: in Hermannstadt erscheint die Wochenschrift "Hermannstädter Zeitung", das Theologische Institut ediert die "Kirchlichen Blätter", die Hermannstädter Zweigstelle der "Akademie für Gesellschaftswissenschaften" gibt die "Forschungen zur Volks- und Landeskunde" heraus. Unregelmäßig erscheinen die "Germanistischen Beiträge" des Germanistik-Lehrstuhls. In Hermannstadt wurde bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts ein deutsches Theater gegründet. Die damit in Verbindung stehende Zeitschrift war die erste Publikation auf dem Boden des heutigen Rumänien. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen setzte dann das Hermannstädter "Deutsche Landestheater aus Rumänien" die sprachliche Traditionslinie fort. Daran anschließend wurde schließlich 1956 eine deutsche Abteilung am städtischen rumänischen Theater ins Leben gerufen, die auch heute noch besteht. In Hermannstadt gibt es zudem ein deutschsprachiges Puppentheater. Das kirchliche Leben der Deutschen beiderlei Konfessionen (evangelisch und katholisch) geht sozusagen normal weiter: der Evangelischen Kirche stehen zwei Kirchhäuser zur Verfügung, in denen auf Deutsch gepredigt wird. Es gibt Jugendarbeit und Altenbetreuung. Deutsche Predigten finden auch einmal pro Monat in der Katholischen Kirche statt. Die reiche musikalische Tradition der Stadt (bis ins 18. Jahrhundert zurückreichend) wird mit Erfolg fortgesetzt. Es gibt einen "Bach-Chor", der in Jahreskonzerten große deutsche, aber auch einheimische Komponisten aufführt. Durch den Exodus der deutschen Bevölkerung hat auch das deutschsprachige literarische Leben abgenommen. Der Literaturkreis der Stadt besteht seit 1991 nicht mehr, doch gab es punktuell bescheidene Fortsetzungen im Literaturkreis des "Pädagogischen Lyzeums" und in jenem der GermanistikstudentInnen, der in letzter Zeit als "Lesekreis" reaktiviert wurde. Die in Hermannstadt oder, wenn man den Raum etwas ausdehnt, in Südsiebenbürgen verbliebenen SchriftstellerInnen haben zum Beispiel die Gelegenheit, sich einmal jährlich bei den "Deutschen Literaturtagen" in Reschitz zu treffen. In Hermannstadt steht ihnen der hora- und der Honterus-Verlag zur Verfügung, in Kronstadt der Aldus-Verlag, es gibt auch den staatlichen Kriterion-Verlag. Namen wie Joachim Wittstock, Eginald Schlattner, Ursula Bedners oder Carmen Pucheanu haben auch im Ausland einen guten Klang, hinzu kommen noch solche wie E. G. Seidner oder Wilhelm Meitert, die sich vor allem im sächsischen Dialekt artikulieren. Nicht unerwähnt, weil fördernd soll die "Blutzufuhr" aus Deutschland bleiben: Das Generalkonsulat der BRD und der "IFA" initiieren und finanzieren zahlreiche Kulturaustausche. Im Jahr 2003 wurde an der Lucian-Blaga-Universität ein österreichisches Kulturinstitut eingerichtet. Im Jahr 2007 wartet Hermannstadt in einer gemeinsamen organisatorischen Anstrengung mit Luxemburg als Kulturhauptstadt Europas mit einer zahlreichen Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen auf. 54 verschiedene Festivals verwöhnen die neugierigen Augen und Ohren der BesucherInnen mit internationalem Programm. So eröffnet das Sibiu-Jazz-Festival zwischen dem 8. und 15. Mai mit einer musikalischen Darbietung das Jahreskulturprogramm. Am 11. Mai treffen Interessierte an der Philologischen Fakultät zusammen, um über den rumänischen Philosophen Emil Cioran (1911-1995) im Rahmen des Internationalen Kolloquiums, welches seinen Namen trägt, zu sprechen. Während das Internationale Theaterfestival zwischen dem 26. Mai und 5. Juni zum XIII. Mal mit Schauspielkunst aus der ganzen Welt locken wird, kommen Kinder und Jugendliche zur zehnten Ausgabe des Festivals für unkonventionelle Kunst "La strada" zusammen. Weitere musikalische Präsentationen sollen zwischen dem 1. Juni und 1. September unter dem Motto "Halte den Rhythmus" für Abwechslung sorgen. Im August werden zwei traditionelle folkloristische Kunsthandwerkfestivals zu Töpferwerkstätten und Keramikausstellungen einladen. Am 25. August soll das mittelalterliche Festival "Siebenbürgische Burgen" einen mediävalen Flair verbreiten, abschließend lädt die europäische Kulturhauptstadt zum Internationalen Astra Dokumentarfilmfest zwischen dem 23. und 28. Oktober ein. (Programm im Internet: www.sibiu.ro/ro/cultura2005.htm) Im September 2007 werden unter der Schirmherrschaft der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und dem Rat Europäischer Bischofskonferenzen der römisch-katholischen Kirche (CCEE) alle christlichen Kirchen Europas zur Dritten Ökumenischen Versammlung (nach Basel, 1989, und Graz, 1997) zwischen dem 4. und 8. September in Hermannstadt erwartet. Nicht zuletzt der angekündigte Besuch des Papstes wird Hermannstadt dazu verhelfen, in altem neuen Glanz zu erstrahlen. |
| .... |