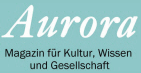|
......
Von Walter M. Weiss |
|
... |
|
Die Stimmung war ähnlich überschäumend wie damals vor 17 Jahren, eine knappe Woche nach Ceauşescus Tod: Als am Silvesterabend auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz von Hermannstadt (rumänisch Sibiu), die Sektkorken knallten und zu den Klängen aus Beethovens Neunter die EU-Fahne gehisst wurde, empfanden die abertausenden Festgäste den Moment wohl als endgültige Besiegelung ihrer seinerzeit so opferreich errungenen Freiheit. Inbrünstig sangen sie anschließend beim Konzert der Rockgruppe "Phoenix" jene Lieder mit, deren rebellische Texte während der Diktatur ihren Widerstandsgeist angefacht hatten. Das Wissen, dass sich im alten, erweiterungsmüden EU-Europa die Begeisterung über Rumäniens Beitritt in Grenzen hält, konnte ihrem Enthusiasmus keinen Abbruch tun. Am nächsten Abend ging die Megaparty weiter, feierte man im Beisein von Staatspräsident und Premierminister mit Konzerten und einer fulminanten Lichtshow samt Feuerwerk den Beginn von Sibius Jahr als europäische Kulturhauptstadt. Und signalisierte damit der Welt selbstbewusst, dass man diesen Status, den man, gemeinsam mit Luxemburg, als erste Stadt aus einem der noch jungen, östlichen EU-Mitgliedsländer erlangt hat, als immense Chance begreift. Toleranz als Chance Als das "Wunder von Hermannstadt" hat Richard Wagner die erstaunliche Entwicklung der südsiebenbürgischen Stadt nach 1989 kürzlich bezeichnet. Vielleicht mit der Hoffnung, sie werde die Rumänen in diesen Zeiten des Um- und Aufbruchs auf ähnliche Weise beflügeln, wie nach der Fußball-WM 1954 das "Wunder von Bern" die Deutschen. Als Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Sonderweg nannte der rumäniendeutsche Schriftsteller eine historisch gewachsene Gelassenheit. In der Tat war die Stadt am Zibinsfluss seit ihrer Gründung im 12. Jahrhundert stets ein Ort der Toleranz. Hier und in den Dörfern der Umgebung lebten seit alters Menschen unterschiedlicher Herkunft und Konfession, Rumänen, Deutsche, Ungarn und Roma, Orthodoxe, Protestanten, Katholiken und Juden – mal mehr mit-, mal eher nebeneinander, aber ohne ethnische Konflikte, wie sie etwa in der Konkurrenzstadt Klausenburg/Cluj bis in die jüngste Vergangenheit immer wieder hochkochten. Als prägend erwies sich der Einfluss der Siebenbürger Sachsen, der Nachfahren jener vor 800 Jahren vom ungarischen Königshaus zur Sicherung der südöstlichen Reichsgrenze aus dem Rheinland, Flandern und Luxemburg verpflichteten Kolonisten, deren Mundarten in der wundersam melodischen Sprache der Rumäniendeutschen bis heute durchklingen. Vor allem sie, die gänzlich vom Arbeits- und Ordnungs- und Bildungsethos der Reformation durchdrungen waren und noch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg fast die Hälfte der Einwohner stellten, verschafften der Vielvölkerstadt nicht nur eine Karriere als blühende Handelsmetropole und politisches Herz der "Sächsischen Nation". Sie bescherten ihr auch eine bürgerliche Beschaulichkeit, die den Exodus der Deutschstämmigen im späten 20. Jahrhundert offensichtlich überlebt hat. "Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht", so hat der kürzlich verstorbene, in Hermannstadt geborene Büchner-Preisträger Oskar Pastior diese spezifische Paarung von selbstzufriedener Nabelschau und schöpferischer Neugier prägnant umschrieben. Nachhaltige Renaissance Das materielle Erbe dieses Lebensgefühls begeistert – im Verbund mit den grandiosen Kirchenburgen im Umland – zunehmend Reisende aus dem Westen: Hermannstadt, das dank seiner massiven Befestigungen nie, nicht einmal von den Türken, erobert wurde, auch in den modernen Kriegen kaum Zerstörungen erlitt und selbst vom Demolierungswahn des Conducator weitgehend verschont blieb, ist in seinem Kern ein architektonisches Bijou. Ein bezauberndes Stück Mitteleuropa im Karpatenbecken, das abendländischer nicht sein könnte. Der Panoramablick vom Ratsturm offenbart vor der Kulisse des bis in den Spätfrühling schneeweißen Fagaras-Gebirges drei zentrale Plätze, verkehrsbefreit und eingerahmt von einem pastellbunten Prachtensemble aus Kirchen, Patrizier- und Handwerkerhäusern mit Laubengängen, rundum ein Geflecht gewundener Gassen, Reste von Wehrmauern und jene berühmten Treppen, über die Émile Cioran, ein weiterer prominenter Dichtersohn der Stadt, zwischen den Weltkriegen allnächtlich seine legendären Spaziergänge unternahm. Für schier endlose Jahrzehnte war Hermannstadt, wie Transsilvanien insgesamt, gleich einer Insel im Strom der Zeit unter grauem Schleier, in bitterer Armut isoliert gewesen. Anfang der Neunziger begannen die Uhren nicht zuletzt dank bundesdeutschem Know-how und Geld allmählich wieder zu ticken. Und seit der Kür zur Kulturhauptstadt hält Europa, mit der Globalisierung im Schlepptau, machtvoll Einzug. Als Pacemacher das enorme Modernisierungstempo bestimmt seit 2000 Klaus Johannis. Der 47jährige Bürgermeister, deutschstämmig und mit einer Rumänin verheiratet, gelernter Physiker und allseits als eine Art Wundertier an Führungskraft und Effizienz gepriesen, lenkte einen dicken Strom von Auslandskapital in die Stadt. Im neuen Gewerbegebiet im Osten sind Grund und Boden nahezu ausverkauft, haben sich dutzende Westfirmen, darunter Leitkonzerne wie Continental und Siemens, Voestalpine und ThyssenKrupp, niedergelassen. Parallel wurde die städtische Infrastruktur auf Vordermann gebracht, bekam die Altstadt ein umfassendes Facelifting verpasst. Gesamtinvestitionen: gut 100 Millionen Euro. Jahrelang war Sibiu eine einzige Großbaustelle. Nun strahlt es. Das kommunale Haushaltsvolumen hat sich binnen sechs Jahren verfünffacht. Die Arbeitslosigkeit liegt bei knapp drei Prozent. Und eine weitere gute Nachricht: Das Wirtschaftswunder hat die Butzenscheiben-Idylle des mittelalterlichen Stadtkerns nicht beschädigt. Es gibt weder Porno- noch Fastfood-Shops, dafür jede Menge Buch- und Antiquitätenläden, Galerien – auch für Gegenwartskunst – und für die 30.000 ansässigen Studenten bis frühmorgens belebte Cafés und Szenebeisln. Auf den geschnitzten Torbögen der alten Bürgerhäuser mit den kirschroten Ziegeldächern und mandelförmigen Gaubenfenstern wächst wilder Wein. Hermannstadt ist aus seinem touristischen Dornröschenschlaf erwacht. Für 2007 rechnet es mit bis zu 500.000 zusätzlichen Gästen, doppelt so vielen wie sonst. Noch heuer will die Unesco entscheiden, ob sie die hundert Hektar große City zum Weltkulturerbe erklärt. Dennoch, zeigt sich Gabriel Rosca, der junge Präsident der örtlichen Architektenkammer, zufrieden, droht keine Musealisierung. "Die Immobilien-Preise sind zwar bereits gestiegen, doch die soziale Vielfalt ist bis auf weiteres ungefährdet." Symbolisches Kapital
Dracula, Pferdekarren und
Plattenbauten, Securitate-Seilschaften und Straßenkinder ... Die alten
Klischees kleben den Rumänen wie Kaugummi an den Sohlen und werden sich wohl
nur langsam auflösen. Auch in Sibiu ist die vordergründig so fotogene
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, sind die krassen sozialen Gegensätze
noch offensichtlich. Dennoch stellt die Stadt für das frischgebackene
EU-Mitgliedsland eine Ausnahme und ein Versprechen dar. Modernität und
Multikulturalität: Wofür Hermannstadt alias Sibiu alias Nagyszeben als ein
Zentrum an der Peripherie des Habsburgerreiches zur Blüte der Aufklärung im
späten 18. Jahrhundert stand (siehe Kasten), symbolisiert es in gewissem
Sinne auch wieder 2007. Allein daraus, dass seine Ortstafeln, wie überall in
Siebenbürgen, selbstverständlich mehrsprachig beschriftet sind, ließe sich
anderswo viel lernen. Wegweisender jedoch ist etwa die Tatsache, dass die
170.000 Hermannstädter, obwohl zu 95% rumänisch, bei der letzten Wahl ihren
deutschstämmigen Bürgermeister mit 88,7% im Amt bestätigten und so der
Korruption und erhabenen Großmäuligkeit der alten Apparatschiks eine
definitive Absage erteilten. Politisches Vertrauen über ethnische Grenzen
hinweg: ein beispielhafter Vorgang im Südosten Europas, der, fernab aller
k.u.k.-Seligkeit oder Deutschtümelei, das immaterielle Erbe einer
800jährigen Stadtgeschichte der Toleranz widerspiegelt; der neue
Perspektiven für ein politisch korrektes Verhältnis zwischen Mehr- und
Minderheiten nicht nur in Rumänien aufzeigt. Und der eigentlich auch die
Zustimmung der skeptischen Alteuropäer zur jüngsten Erweiterungsrunde
erhöhen sollte. Wie meinte der für die Koordination des Kulturprogramms im
Festjahr Hauptverantwortliche, Cristian Radu? "2007
feiern wir eigentlich nur die Geburt einer Kulturhauptstadt. Entscheidend
für ihre Wiedereingliederung in Europa wird sein, wie es danach weitergeht." |