|

Erwin Wagenhofer
erwin.wagenhofer [at]filmmacher.at
geb. 1961 in Amstetten
(NÖ), ist freischaffender Autor
und
Filmemacher und darüber
hinaus Lehrbeauftragter der
Universität für
angewandte
Kunst in Wien.

"We feed the world"
ist ein Film über unseren
Umgang mit unserer Nahrung.
Er zeigt, wie sie
hergestellt
wird und was die darüber
denken, die an ihrer Herstellung
beteiligt sind. Wobei nicht bloß
"gewichtige" Stimmen
zu Wort
kommen wie der Nestlé-
Manager Peter Brabeck oder
der
UN-Sonderberichterstatter
für das Recht auf Nahrung,
Jean Ziegler, sondern
auch
die selten gehörten: so etwa
der französische Kleinfischer,
ein
österreichischer Geflü-
gelzüchter oder die afrikani-
schen Gastarbeiter, die in
den Gewächshäusern von
Almeria ein dürftiges Aus-
kommen gefunden haben.

"We feed the world"
ist innerhalb weniger Monate
zum erfolgreichsten öster-
reichischen
Dokumentarfilm
avanciert. Bislang haben knapp
200.000
Menschen die
Kinovorstellungen besucht
(Stand: Mai 2006).

Im Übrigen ist "We feed
the world" der beste Beweis
dafür, dass gute Filme nicht
teuer sein müssen und
durchaus auch mit
einfachen
Mitteln gemacht werden
können: Mit 290.000
Euro
stand nur ein relativ geringes
Budget zur Verfügung; gedreht
wurde mit
einer 3.000 Euro
teuren Videokamera; die
"Filmmannschaft" bestand
aus Erwin Wagenhofer und
seiner 22jährigen Assistentin,
Lisa Ganser.
Weitere Infos zum Film
www.we-feed-the-world.at
www.essen-global.de
Buchtipp
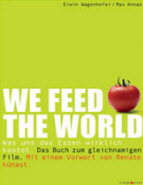
Erwin
Wagenhofer.
We feed the world. Was
uns
das Essen wirklich kostet.
Orange Press, 2006, 191 S.
ISBN: 3936086265
Pressestimmen
"Aber Wagenhofers Meister-
schaft als
Dokumentarist
besteht darin, daß er allein
die Bilder und seine
Gesprächs-
partner sprechen läßt - und
das Ganze mit einer grandios
unauffälligen Tonkulisse
unterlegt ... Schrecken nähert
sich hier in seiner niedlichsten
Form: als Meer von gelben
Küken, die für
Hühnermast-
betriebe gezüchtet werden.
Nach wenigen Wochen sieht
man die Tiere
auf dem Schlacht-
band unten gesammelt herein-
und darüber fein säuberlich
geköpft wieder herausfahren.
Brust und Keulen bleiben,
aufs Gramm genau
sortiert,
in Europa, die Innereien gehen
nach Afrika."
(FAZ, 29.04.
2006, Nr.
100, S.35).
"In
seiner Dokumentation
'We Feed the World – Essen
Global' liefert Regisseur Erwin
Wagenhofer
viele Fakten, die
den Zuschauer gleichzeitig
staunen
und aufstöhnen lassen.
Aber ihm gelingt es nicht,
diese in einen größeren
Zusam-
menhang zu bringen, er zeigt
nur die einzelnen Auswirkungen
der
Globalisierung und nicht
das Phänomen als Ganzes.
So kommt der
hochambitio-
nierte Film nicht über die
Aussagekraft einer einfachen
'Pro 7'-Reportage hinaus und
auch der Unterhaltungswert ist
nur unmerklich höher.
(Christoph
Petersen,
www.filmstarts.de).
"Auch wenn es gnädiger wäre,
manches nicht so
genau zu
wissen: Die Einblicke, die
Wagenhofers Dokumentation
in das
Geflecht aus Waren-
strömen und Geldflüssen, aus
Zusammenhängen zwischen
Hybrid-Saatgut und Ge-
schmacksverarmung, aus
Soja-Import und Mais-Ver-
brennung
gibt, regen zur
Gewissenserforschung an."
(Oberösterreichische
Nachrichten, 29. 09. 2005).
"Mit aufrüttelnden Fakten
und globalen
Verbindungen
versucht der österreichische
Regisseur Erwin Wagenhofer,
ein
Bewusstsein für Zusamm-
enhänge im weltweiten Kreislauf
von Herstellung und
Verbrauch
von Nahrung zu schaffen."
(Ö1
Synchron, ORF)
"Eine der Erkenntnisse dieser
breit gefächerten Dokumentation
ist die
Tatsache, dass wir zur
Geschmacklosigkeit verführt,
gegängelt und bestärkt
werden.
Was brauchen wir Tomaten
und Erdbeeren im Winter?
Mal probiert?
Eben! Sie
schmecken nach nichts. Da
kann einem wirklich der Appetit
vergehen." (Rolf Breiner,
www.cineman.ch).
Frühere filmische
Arbeiten
1995
"Chasing after the Molecule"
Fundacion Favaloro Buenos
Aires, Argentina
1997
"Off Screen"
Portraits von Filmgewerbe-
treibenden abseits der Leinwand
1998
"Menschen am Fluss"
Fluss-Schiffer auf der Donau,
ORF Nightwatch,
Diagonale
Graz, Budapest Sonderschau
50 Jahre Donaukommission
1999
"Die vergorene Heimat"
Bayerischer Rundfunk
"Artist in Residence Vol. 01"
Bundeskanzleramt Kunst
"Daheim in Europa"
Dokumentarfilm Europa 10
Jahre nach dem eisernen
Vorhang
2000
"Artist in Residence Vol.
02"
Bundeskanzleramt Kunst
"Der Gebrauch des
Menschen" Dokumentarfilm
mit und über Aleksandar
Tisma
- Akademie der Künste Berlin
2001
"Vergiss Neider!"
Spielfilmdrehbuch
"Limes... Aktion Limes"
Diagonale Graz, Filmfest Cork
(Irland), Filmmuseum Wien
2002
"Agnes..."
Kurzspielfilm
"Moving Vienna"
Stadtfilm Wien für die
IFHP in China
2003
"C2H5OH -
Äthanol
oder schlicht ALKOHOL"
Dokumentarfilm
"Ach Paul..."
Spielfilmdrehbuch
"Kein Wien..."
Dokumentarfilm gemeinsam
mit Christoph Steinbrener
2004
"OPERATION FIGURINI"
Dokumentarfilm
2006
"MONEY ODER DAS
GELDSYNDROM"
Dokumentarfilm in Arbeit
|
AM: In der
letzten Zeit sind zahlreiche österreichische Filme in die Kinos gekommen,
die sich kritisch mit der Globalisierung bzw. mit dem Thema Arbeit
auseinandersetzen. Mir fallen neben Ihrem Film auf die Schnelle
"Workingman’s death" von Michael Glawogger,
"Darwin’s Nightmare" von Hubert Sauper oder
"Struggle" von Ruth Mader ein. Welche Rückschlüsse
darf man daraus ziehen oder anders gefragt: Warum haben Sie jetzt einen Film
über die Globalisierung gemacht? Und warum stehen dabei das Essen und die
Landwirtschaft im Zentrum?
Wagenhofer:
Ich versuche, mich in meiner Arbeit mit dem zu beschäftigen, was jetzt und
hier und also in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft vor sich geht.
Dinge die mich berühren und die auch unmittelbar mit uns zu tun haben. Und
dann suche ich nach einem Thema, anhand dessen ich das transportieren kann.
Zum Beispiel hat mich die Öffnung des "Eisernen
Vorhangs" sehr beschäftigt, und daraus sind dann vier
Filme entstanden: "Menschen am Fluss" (1998),
"Daheim in Europa" (1999), "Limes"
(2000) und "Der Gebrauch des Menschen" (2001).
Was die Globalisierung betrifft: Die ist jetzt im Trend, weil sie in
eine neue Phase tritt. Grundsätzlich ist sie ja ein alter Hut, ich schätze
sie hat mit Kolumbus begonnen und diese terrestrische Phase, wenn man so
will, die ist jetzt abgeschlossen. Jetzt beginnt unter anderem durch die
Digitalisierung eine neue Phase; der deutsche Philosoph Peter Sloterdijek
spricht in diesem Zusammenhang von Sphären, also man könnte es die
"sphärische Phase" nennen.
So ein Umbruch, so eine Verunsicherung, das beschäftigt dann
natürlich die Leute und eben auch die Filmmacher. Und umgekehrt, wenn man
heute einen Film über Nahrung oder über Arbeit macht, dann kommt man an
dieser so genannten Globalisierung nicht vorbei, sie kommt automatisch durch
die Hintertür herein. So ist es mir bei "We feed the
World" gegangen. Die Globalisierung ist dort an sich nicht im Vordergrund
gestanden. Aber mich hat auch die Gentechnik nicht
interessiert und zwar, weil ich mich da gar nicht auskenne und kein
Genetiker bin. Andererseits war mir von Anfang an klar, dass dieses Thema
reinkommen wird in den Film, weil es die Leute selber ansprechen, weil es
sie eben betrifft und beschäftigt. Was mich
interessiert ist die simple Frage: Wie gehen wir miteinander um? Und das
Thema an Hand dessen wir diese Frage "abgearbeitet"
haben ist eben bei diesem Film die Nahrung. Also wie gehen wir jetzt,
zu Beginn des 21. Jahrhunderts, mit unserer Nahrung
um, wo kommt sie her, wie wird sie ver- und erarbeitet etc. Aus diesen
Fragen ist dieses Bild unserer materiell reichen, westlichen Gesellschaft
entstanden.
AM: "We feed
the world" hat den Kinos Zuschauerzahlen beschert wie kein anderer
österreichischer Dokumentarfilm davor. Wie erklären Sie sich den
unglaublichen Erfolg Ihres Films?
Wagenhofer:
Ehrlich gesagt, habe ich da keine wirklich schlüssige Antwort. Ich wollte
einen einfachen und einigermaßen ehrlichen Film machen, der die Dinge von
innen her aufrollt. Was sagen die Leute, die damit zu tun haben: die Bauern,
die Fischer, die Konzernmanager, die Geflügelzüchter etc.
Das läuft alles ganz unspekulativ ab und die Besucher spüren das,
dass ich mich da über niemanden lustig mache. Ich freue mich, dass man es
eben auch so machen kann und dass das jetzt auch angenommen wird, ohne das
da auf jemanden hingehauen wird.
AM:
Als ich mir "We feed the world" angesehen habe, hat
sich ein Kinobesucher neben mir gefragt, warum man von dem, was Sie in ihrem
Film zeigen, vergleichsweise selten hört, sieht oder liest. Also, warum?
Warum reden die (EU-)Politiker kaum davon? Warum berichten die
"normalen" Medien so selten darüber? Warum schafft’s
"We feed the world" wahrscheinlich nie ins
Fernseh-Hauptabendprogramm?
Wagenhofer:
Also, alles was sie im Film sehen ist in einem ganz legalen Rahmen. Das war
mir auch ganz wichtig, die Dinge zu zeigen, wie sie alltäglich ablaufen; und
zwar abseits von den journalistischen Themen, wie eben Tiertransporte,
Käfighaltung, Gentechnik etc. Ich will damit sagen: Diese Abläufe sind nicht
geheim, wenn sich jemand informieren will, dann gibt es diese Informationen:
in Buchform, im Internet und auch in anderen Medien.
Was das Fernsehen betrifft, so ist das immer schon ein politisch besetztes
Medium gewesen und eben leider immer noch mehr dazu verkommen. Und
bekanntlich ist die Politik heute von der Wirtschaft gelenkt. Und weil wir
nun einmal keinen Werbefilm gemacht haben, wird es wirtschaftliche
Interessen geben, das nicht zu zeigen oder spät in die Nacht hinein zu
verstecken; vor allem im eigenen Land, also in unserm Fall in Österreich.
Bei ausländischen Sendestationen ist das schon wieder etwas anderes, weil
die können sich dann darauf ausreden, dass es eben ein ausländischer Film
ist, der angekauft wurde, sprich: sie können die
Verantwortung wieder dorthin verschieben, wo der Film her ist.
Ich glaube überhaupt, dass die Demokratie auch ein wunderbares System ist,
um die Verantwortung ständig von sich zu schieben. Man kann da nämlich immer
zu einem sagen: Ja, das können Sie doch alles nachlesen. Oder: Es herrscht
doch eh die Meinungs- und Pressefreiheit! Kurz, ich glaube, dass der
Deckmantel der Demokratie vielfach benutzt wird, um gewisse Interessen quasi
zu legitimieren. Aber wie hat doch schon Bertolt
Brecht gesagt:
"Ein Wahlzettel macht einen Hungernden nicht satt!".
AM: Auch wenn
Sie in Ihrem Film auf Kommentare verzichten und so gesehen, "auf niemanden hinhauen", spürt man doch das Engagement.
"Wir müssen anders essen, anders einkaufen, wir
müssen anders leben!", das nennen Sie dann auch an einer Stelle die
Botschaft von "We feed the world". So ähnlich hat es
der amerikanische Schriftsteller und Farmer Wendell Berry einmal formuliert.
Auf die Frage, was wir tun könnten, um den Niedergang der Landwirtschaft zu
verhindern, antwortete er: "Verantwortlich essen!" –
Was heißt nun für Sie, verantwortlich zu essen, und wie sind die
Empfehlungen zu bewerten, biologisch oder regional zu essen, wenn
beispielsweise der Verdrängungswettbewerb, der den in ihrem Film
dargestellten Kleinfischer Domenique Cleuziou bedroht, mittlerweile auch den
Biolandbau und die Direktvermarkter erreicht hat?
Wagenhofer:
Vielleicht darf ich das zuerst so beantworten: Wir müssen lernen,
Verantwortung zu übernehmen; zunächst einmal für uns selbst und in der Folge
für unser Tun und Handeln. Wenn das einmal geschafft ist, dann ergibt sich
der Rest wahrscheinlich von selbst. Um beim Beispiel der von Ihnen
angesprochenen Fischer zu bleiben, dann sieht ja der Laie schon rein optisch
den Unterschied zwischen einem vom "autonomen
Kleinfischer" gefangenen Fisch und einem so genannten "Industriefisch".
So und jetzt stellt sich die Frage: Warum machen das Leute, warum verwenden
sie ihre Energie und ihre Lebenszeit, um diese Art der Fischerei, nämlich
die industrielle, zu betreiben, weil sie müssen ja selbst spüren, dass das
falsch ist. Und das meine ich mit "Verantwortung
für unser Handeln übernehmen". Das ist eben auch ein kollektiver Prozess.
Aber weil der gegen das momentane Wirtschaftssystem laufen würde, sind die
Kollektive bewusst kaputt gemacht worden. So haben wir heute nur mehr den so
genannten individuellen, ständig mit sich selbst und anderen konkurrierenden
Konsumenten, der schwer vereinsamt vor sich hin lebt.
In Österreich leben heute mehr Menschen mit einem Tier zusammen als mit
einem Menschen. Also wenn man sich das vorstellt, das sagt doch sehr viel
über unsere Gesellschaft aus und wohin wir als Individuen verkommen sind.
Das "Verantwortung übernehmen" kommt für mich
im Übrigen vor dem "verantwortlich Essen". Diese
Unterscheidung ist mir wichtig, weil man auch aus einem rein egoistischen
Grund "verantwortlich essen", aber nebenbei ein
großer "Falott" sein kann. Das
hat mich auch bei einigen Veranstaltungen unheimlich gestört, wo ich von
Biobauern eingeladen wurde, um nach der Vorführung des Filmes zu sprechen.
Da ging es häufig darum, dass Bio die Welt retten wird und so weiter. Da
wird der Film benutzt, um für die eigenen Produkte Werbung zu machen. Man
stellt sich auf eine Stufe mit den Armen aus Brasilien und hat sie, wenn die
Sequenz abgelaufen ist, schon wieder vergessen. Ich will damit sagen, dass
es bei den Biobauern wieder einigen nur ums Geschäft geht, d.h. dieselben
Motivationsgründe vorliegen wie bei unserem Nestlé-Chef, Peter Brabeck.
Dieser unglaubliche Egoismus ist aber einer der Gründe für die Schieflage
des Planeten.
AM:
Wie sehen Sie die Rolle der Politik in dieser Frage?
Wagenhofer:
Die Politiker haben sich mit der Wirtschaft ins Bett gelegt und haben dabei
ihren Handlungsspielraum bis auf ein Minimum eingebüßt. Sie beten die
Wirtschaft an, aber eine Wirtschaft die nicht dazu da ist, den Menschen zu
dienen, sondern ausschließlich um ihre Profite zu maximieren.
Der Direktor des Institutes für höhere Studien (IHS), der zum
Beispiel unsere Regierung in Wirtschaftsfragen berät, hat es in einem
Nebensatz so formuliert: "...dieses wäre zwar human,
schadet aber der Wirtschaft!" ("Die Presse" vom 10.07.2004, Seite: 23).
Und den geringen Spielraum den die Politiker noch haben, nützen sie
dafür, um ihre jeweilige Klientel zufrieden zu stellen und um von denen
wieder gewählt zu werden und nicht um Regelungen zu treffen, die für die
Menschen gut wären. Darum wird ja dauernd von Deregulierung des Marktes und
solchen hochgestochenen Dingen geredet, die letztlich kein Mensch versteht.
Um Ihnen das anhand eines Beispiels zu konkretisieren: Der ehemalige
deutsche Bundeskanzler, Gerhard Schröder, ist mit einem Jumbojet voller
Wirtschaftkapazitäten nach China geflogen, um den Chinesen Dinge zu
verkaufen, die heute auf den gesättigten, europäischen Märkten
"stagnieren", wie es so schön heißt.
Anstatt dass der Kanzler alleine mit dem Fahrrad nach China fährt,
damit er endlich zum nachdenken kommt. In einen Rucksack
drei Filmrollen einpackt und den Chinesen dann den täglichen Stau im
Großraum Frankfurt, Berlin oder Köln vorführt, und sie dann fragt:
"Ist es das, was ihr wollt?" Und wären wir wirklich eine hoch
entwickelte, zivilisierte und gar kultivierte Hi-Tech-Gesellschaft, dann
hätte er auch gleich die passende Alternative dabei. Aber wer denkt denn
heute noch etwas, dass längerfristiger ist als eine Legislaturperiode?
AM: Die
ungeheure, aber oft nicht nachhaltige Produktivität der Landwirtschaft; die
jahrzehntelange Überproduktion; die staatlichen Subventionen; die billigen
Vergleichsprodukte aus allen Teilen Europas, ja der ganzen Welt;
höchstwahrscheinlich auch die gesellschaftliche Unterbewertung der
landwirtschaftlichen Tätigkeit: Das alles hat dazu geführt, dass das Gefühl
dafür, was Lebensmittel eigentlich kosten müssten, abhanden gekommen ist. Es
ist einfach zu lange, wie Nietzsche sagt,
"in eine bestimmte Richtung gehört worden." Wird sich
das Wertempfinden jemals wieder ändern lassen? Wird man es jemals
akzeptieren, dass selbst das halbe Hühnchen am Hendlstandl nicht unter 5
Euro zu haben ist? Oder wird man dafür den Globalisierungsprozess weiter in
Kauf nehmen?
Wagenhofer:
Um mit Nietzsche zu antworten: "Entweder wir lassen
uns vom Schicksal führen oder wir werden von ihm hinterher gezogen!"
Momentan werden wir hinterher gezogen, weil wir, wie ich am Beispiel der
Fischer zu erläutern versucht habe, unser "Gespür"
hinten anstellen und weil wir noch nicht verstanden haben, dass die Dinge im
Leben, die wir wirklich suchen, um Geld nicht zu haben sind.
Und solange wir das nicht verstanden haben, jagen wir primitiven
Slogans wie "Geiz ist geil" nach. Aber wo sind wir da
hingekommen, wenn wir jetzt schon den Geiz geil finden? In eine erotische
Untergangsstimmung, denn nur ein "erotischer
Flachwurzler" kann Geiz geil finden.
AM:
Nun findet man immer Gründe, ein Einkaufsverhalten zu rechtfertigen: Der
Wirt erklärt, dass das Gulasch zu teuer wird, wenn er das Fleisch dafür beim
Biobauern um die Ecke einkauft. Ein Schweinebauer versichert, dass ihm gar
nichts mehr bleibt, wenn er seine Schweine mit inländischem Kraftfutter
füttert. Die Hausfrau sagt, dass ihre Haushaltskasse schon zur Monatsmitte
leer wäre, wenn sie immer "gut" einkaufen würde. – Wo
hört für Sie das Verständnis für diese Argumentation auf, d.h. welche
Produkte dürfen einfach nicht produziert oder gekauft werden?
Wagenhofer:
Also die reine Geldfrage ist sicherlich als Argument zu wenig nachhaltig. Da
schleppen sich Leute in Wien die Mineralwasserflaschen in die Wohnungen hoch
und bezahlen einen Haufen Geld für überteuertes, abgestandenes Wasser,
während sie gleichzeitig 800 Liter feinstes Hochquellenwasser frisch aus der
Leitung haben, zum Preis von einem Liter Mineralwasser. Da kaufen sich
Schüler diese ganzen "Hi-Tech-Jogurts" zu sagenhaften
Preisen und mit sehr zweifelhafter Rechtfertigung. Und da ernähren sich
Leute, die eventuell arbeitslos sind, von "Pringles";
also gepresstem Erdäpfelstaub. Wenn man das auf den Kilopreis hochrechnet,
kommt das Kilogramm Kartoffeln dann auf 12 €. Dafür darf dann das Fleisch
nichts mehr kosten etc. Also da verführt uns die Werbung zum Geldausgeben,
wo dies gar nicht notwendig, geschweige denn gesund ist.
Nach einer Vorführung in Fohnsdorf in der Steiermark hat mir eine einfache
Bäuerin vorgerechnet, dass Sie, wenn Sie ihren
Lebensstil wirklich auf
"Bio" umstellen wollte, im
Monat um 50 bis 70 € pro Person an Geld bei den Lebensmitteln einsparen
würde. Ich glaube es dieser Frau, denn wenn man seinen Lebensstil
wirklich auf diese Ernährung umstellt, dann isst und dann lebt man eben ganz
anders. Man ist "schneller" zufrieden gestellt, isst
also weniger, setzt sich zum Essen hin, nimmt sich viel mehr Zeit und
beginnt anders zu genießen. Und das meine ich damit, wenn ich sage, wir
müssen anders leben, anders essen, den Medien anders gegenüber stehen etc.
AM:
Viele Leute fragen sich, warum den ohnehin subventionierten Bauern
und ihren Problemen so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, wo beispielsweise
auch im produzierenden Gewerbe in Deutschland in den letzten 15 Jahren 4
Millionen Menschen ihren Job verloren haben? Sind der Stahlarbeiter und der
Bauer nicht in Wahrheit auf der gleichen Ebene zu behandeln oder ist die
Krise der Landwirtschaft für Sie etwas Spezielles?
Wagenhofer:
Diese Frage verstehe ich nicht ganz, ich vermute da eine ideologische
Tendenz dahinter. Aber wie auch immer, das Problem ist nicht der Bauer und
nicht der Stahlarbeiter, sondern das Problem ist die Verteilung des
vorhandenen Reichtums und dass dieses System das Geld von denen, die es
brauchen würden, wegsaugt, hin zu denen die es eigentlich nicht brauchen,
weil ihre Bedürfnisse ohnehin gedeckt sind. Kurz: Dieses System ist von den
Reichen geschaffen worden und wird von ihnen gefördert.
John F. Kennedy hat es in etwa so formuliert: "Wenn
eine Gesellschaft den vielen, die arm sind, nicht helfen kann, kann sie auch
die wenigen nicht retten, die reich sind." Bekanntlich hat er diese seine
Sicht der Dinge nicht überlebt.
AM: Ich
möchte die obige Frage nochmals anders stellen: Glauben Sie, dass das Land,
dass die Peripherien ökonomisch und arbeitsplatzmäßig auf die Landwirtschaft
verzichten können? Ronald Barazon, der gerne mit dem Wirtschaftsliberalismus
kokettierende Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, hat etwa einmal
geschrieben, dass 200.000 der 260.000
österreichischen Bauernhöfe aus
"Effizienzgründen" weg müssten. Ideologie hin oder
her: Ist das nicht eine katastrophale Perspektive für das Land?
Wagenhofer:
Hans Joehr, der Direktor der Abteilung Landwirtschaft bei Nestlé, formuliert
es so: Von den 25 Millionen Kaffee produzierenden Familien, die es heute auf
der Welt gibt, müssen mindestens 10 Millionen "bereit
sein zu verschwinden". Das verlangen die globalen
Kräfte des Marktes, so Joehr. Na gut, und wo sollen die hin verschwinden?
Und was machen sie dann dort, in den Elendsgegenden der Großstädte, z.B. in
den Favelas von Sao Paulo? Gibt es da eine Antwort von Herrn Barazon oder
von Herrn Joehr oder von Herrn Brabeck oder von Herrn Ackermann, dem Chef
der Deutschen Bank? Ja, von Herrn Brabeck gibt es eine Antwort, die ist auch
im Film drinnen: Diese Leute sollen mehr arbeiten, lautet sie!
Es ist eben ein unfassbarer Blödsinn, den diese Leute von sich geben, weil
ja in Wirklichkeit jedem Kind klar ist, dass ein Bauer in Österreich einen
anderen Lebensstandard hat wie ein Bauer in Brasilien oder Indien. Aber die
Produkte, die sie herstellen, sollen dann auf den Weltmärkten den gleichen
Preis haben, das nennen diese Liberalisierungsfundamentalisten dann
"die Kräfte des freien Marktes".
Wenn alles im Leben nur mehr aus der Perspektive der "Effizienz"
betrachtet wird, dann ergibt das ein Lebensbild, das ich nicht haben will.
Darum mache ich auch solche Filme wie "We feed the
world". Freilich, für das Land an sich, also
geografisch gesehen, würde das Verschwinden der Menschen keine Katastrophe
bedeuten, so wie es für den Urwald keine Katastrophe ist, wenn er nicht von
Menschen besucht wird, eher das Gegenteil ist der Fall.
AM: Die WTO
will die Exportsubventionen für die Landwirtschaft der Industrieländer
streichen und gleichzeitig die Dritte-Welt-Länder
durch Mindestmarktzutritte vor allem auf die landwirtschaftlichen Märkte des
Westens unterstützen. Was halten Sie davon?
Wagenhofer:
Dazu fällt mir nur folgende Episode ein. Die WTO ist im
"Centre William Rappard" in der Rue le Lausanne in
Genf untergebracht, einem tristen grauen Betonklotz aus den Zwanzigerjahren,
der ursprünglich das "Internationale Arbeitsamt"
beherbergte. Es ist also ein Witz der Geschichte,
dass die WTO heute ausgerechnet in jenem Gebäude untergebracht ist, das
ursprünglich für die "Erhaltung" der Arbeit
konzipiert war, während die WTO selbst
–
mit ihren Grundvektoren
"Privatisierung und Liberalisierung"
–
maßgeblich an der Vernichtung der selbigen beteiligt ist.
AM: Jeder
Volkswirtschaftler wird (noch immer) bestätigen, dass der Freihandel den
beteiligten Ländern unterm Strich mehr Vorteile als Nachteile bringt. In
Österreich oder in Deutschland wird dann auch gerne betont, dass die
Exportwirtschaft das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre gerettet hat.
Heißt das nicht, dass die – wohlgemerkt:
"ökonomischen"
– Argumente eindeutig auf der
Seite der Wirtschaftsliberalisten und Globalisierer sind? Dass das
"protektionistische" Verhalten der Globalisierungsgegner zwar zu
besserer Luft, aber zu ökonomischem Schaden wie einer noch höheren
Arbeitslosigkeit führen würde? Was ist zum Beispiel mit den Leuten in
Almeria, wenn niemand mehr spanische Tomaten kauft?
Wagenhofer:
Wenn sie unser System ernsthaft als eines des so genannten Freihandels
bezeichnen, dann sitzen sie einem schwerwiegenden
Irrtum auf. Was soll das für ein Freihandel sein, wo heute die 50 größten
Unternehmen praktisch Monopole sind. Wir haben ja
erlebt, dass die Planwirtschaften im Osten kein großer Erfolg waren, warum
sollen dann die Planwirtschaften im Westen, die ja nicht einmal im Dienste
eines Volkes, sondern im Interesse ihrer Aktionäre handeln, ein großer
Erfolg sein? Die 50 größten Planwirtschaften sind heute Privatunternehmen
und an 51. Stelle kommt dann vielleicht Kuba. Das ist ja nicht der Markt,
der bestimmt, sondern diese Leute kontrollieren ja den Markt. Das letzte was
sie wollen ist ja, dass der Markt irgendwie
eingreift. Deswegen stellen sie sicher, dass der Staat Rahmenbedingungen
erlässt, welche sie vor dem Markt schützen und der ihnen solche Privilegien
gibt, dass sie weiter ihren eigenen Markt ausbauen können. So viel zum Thema
"protektionistisches" Verhalten. Das führt
dann dazu, dass der reichste Mann der Welt, Bill Gates 90% der Computerwelt
beherrscht und einen privaten Besitz angehäuft hat, der höher ist als ganze
Staathaushalte von bald halb Afrika zusammen. Oder dass ein Mann wie Peter
Brabeck ein Jahresgehalt von 20 Millionen Schweizer Franken hat. Er verdient
also mehr als alle Staats-
und Regierungschefs der EU 25 zusammen. Der Chef der
deutschen Telekom verkündet in einer Pressekonferenz stolz die
Milliarden-Euro-Gewinne, um kurz darauf
–
in der gleichen Pressekonferenz
–
zu verlautbaren, dass 30.000 Mitarbeiter, nämlich
auch die, die diesen Gewinn erarbeitet haben, gekündigt werden. Soviel zur
Arbeitslosigkeit.
Und wer in Almeria die Knochenarbeit macht, haben sie ja im Film
gesehen. Und diese Leute sind aus Afrika weggegangen, weil unter anderem
unser Subventionssystem sie dort arbeitslos gemacht hat. Man sollte also
genau hinschauen, wenn man ökonomische Argumente bemüht.
Und wir hatten ja voriges Jahr ein so genanntes Jubeljahr: 60 Jahre
Ende des 2. Weltkrieges, 50 Jahre 2. Republik, 10 Jahre EU Beitritt. Mit
anderen Worten: 60 Jahre Wirtschaftswachstum. Aber kennen sie jemanden der
wirklich glücklich damit geworden ist?
AM: Können
Sie etwas näher erklären, was Sie damit meinen, dass die Politik die großen
Privatunternehmen vor dem Markt schützt!
Wagenhofer:
Nichts leichter als das: Bekannt ist das Beispiel der amerikanischen
Baumwolle: Speziell von der Bush-Administration werden die amerikanischen
Baumwollfarmer dermaßen massiv subventioniert, dass die amerikanische
Baumwolle auf dem Weltmarkt billiger ist als die Baumwolle aus Afrika, die
qualitativ die bessere ist. Ähnliches passiert mit unseren überschüssigen
Lebensmitteln. Die tauchen "höchst
exportsubventioniert" auf afrikanischen Märkten auf
und helfen mit, die Landwirtschaft vor Ort zu ruinieren.
Dann muss in diesem Zusammenhang noch unser "konzernfreundliches
Steuermodell" erwähnt werden. Das Steueraufkommen
wird heute fast ausschließlich von den kleinen Einkommen bewerkstelligt.
Dazu eine Zahl: In Deutschland betrug das Einkommen an Körperschaftssteuer
für den Staat bis zum Jahr 2000 etwa 25 Milliarden Euro. Dann wurden durch
die Steuerreform 2001 die Steuersätze gesenkt und im Jahr 2002 betrugen die
Einnahmen aus der Körperschaftssteuer der Konzerne nur mehr 0,5 Milliarden
Euro. In Österreich wurde unter Finanzminister
Grasser die Körperschaftssteuer von 34 auf 25 Prozent gesenkt, da freut sich
die Industriellenvereinigung und sieht ihre "Spende"
von 280.000 Euro an den Verein Namens "New Economy"
gut angelegt. Dass von diesem Verein eine Jubel-Homepage für Herrn Grasser
um sagenhafte 240.000 Euro gebastelt worden ist, sollte bekannt sein,
interessiert aber hierzulande nur ein paar "rote
Gfrieser", wie sich der Nationalratspräsident,
Andreas Khol, auszudrücken pflegt. Weiters wären da
noch die Off-Shore-Plätze mitten in Europa zu nennen, wo dann diese Konzerne
ihre Gewinne ganz legal parken, um wieder keine Steuern zu zahlen. Die
Konzerne tragen also selbst nichts
–
oder sehr wenig
–
zum so genannten Gemeinwohl bei, nutzen aber die Infrastruktur ganz enorm
für sich aus, von den Transportwegen angefangen bis zu den
Subventionen, die letztlich ja auch den Konzernen zugute kommen. Tatsache
ist ja, dass der gestützte Zuckerpreis natürlich auch Nestlé nützt. Bei der
Herstellung von Schokolade zum Beispiel.
AM: Abschließend noch zwei allgemeine Fragen: Was wäre für Sie die schlechteste
Entwicklung, die das Land nehmen könnte?
Wagenhofer:
Ein Freund von mir, der serbische Donaukapitän Punisa Grbovic, den ich bei
den Dreharbeiten zu "Menschen am Fluss" kennen
gelernt habe, würde sagen: "Das
Schlimmste, was einem Land passieren kann, sind ausgebildete Dumme."
Ich sehe das auch so. Leute, die durch ein Stück Papier ermächtigt sind und
nicht auf Grund ihrer Intelligenz und ihrer Integrität, gewisse führende
Positionen einzunehmen. Solche Leute sind für ein Land schlecht, wir
brauchen ja nur ein Geschichtsbuch aufschlagen.
AM: "Das darf
nicht verschwinden!" An welche Situation denken Sie bei diesem Satz zuerst,
wenn Sie an das Land denken?
Wagenhofer:
Die Lust am Leben. Meine eigene und die der anderen.
Aber das beantwortet jetzt Ihre Frage nicht. Sie wollen von mir ja etwas zum
Land als dem Gegensatz zur Stadt hören. Also: Ich bin am Land aufgewachsen
und mit 19 Jahren in die Stadt Wien übersiedelt, wo ich jetzt seit 25 Jahren
lebe. Ich mag das Land, es ist schön anzusehen, es riecht. Es war mir ein
großes Bedürfnis, über jenen Landstrich, in dem ich aufgewachsen und
hineingeboren bin, einen Film zu machen. Ich konnte dieses Bedürfnis im
Jahre 2000 befriedigen und habe für den Bayrischen Rundfunk
"Die vergorene Heimat" gemacht. Der Film wird seitdem jedes Jahr
wiederholt. Wenn ich nur kann, fahre ich mit meinem
Rennrad raus aus der Stadt, hinein in den Wienerwald und runter zur Donau,
die ich auch liebe und über die ich ebenfalls einen Film gemacht habe,
nämlich "Menschen am Fluss" (ORF,
1998). Aber weder die Stadt noch das Land sind ohne seine Bewohner zu
sehen. Und so widerlich es sein kann, an einem vernebelten Montagmorgen die
grantigen Wiener zu erleben, so stößt mir das leider auf dem Land
existierende "Sumperertum"
auf. Dazu eine kleine Episode: Für den Wienmarathon 2000 habe ich mich
ordentlich vorbereitet und so kam es, dass ich beim Besuch meiner Mutter,
die nach wie vor auf dem Land lebt, auch dort einen Trainingslauf absolviert
habe. Ich lief hinaus zu den Feldern und als ich an einem Bauernhof vorbei
kam, saß da der alte Bauer auf der Hausbank. Als ich auf seiner Höhe
angekommen war, raunzte er mir zu: "Host ka Oarbeit?"
In dieser Episode ist beides schön verdeutlicht: der degenerierte Städter,
der seinen Ausgleich beim Laufsport sucht, und der reaktionäre Landbewohner,
für den alles, was nicht Arbeit ist, gleich auch zwecklos ist.
AM:
Herr Wagenhofer, vielen Dank für das
Gespräch!
|
|