|

Vasile V.
Poenaru
bardaspoe [at]
rogers.com
geboren
1969, zweisprachig
aufgewachsen, Studium der
Germanistik in Bukarest,
darauf Verlagsarbeit und
Übersetzungen. Lebt
in Toronto.

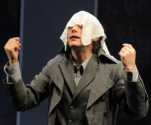
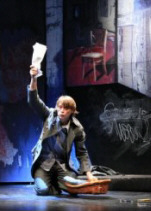
(c) Maria Stefanescu (www.arcub.ro)
Was Marius Manole hier
durchmacht, ereignet sich
nicht im fernen Russland,
nicht in der Vergangenheit,
nicht in Gogols Welt,
sondern hier und jetzt,
in unserer Welt, in unserer
Zeit. Das geht uns an. Das
zermürbt uns. Das jagt uns
einen ontologischen
Schrecken ein.



(c) Maria
Stefanescu (www.arcub.ro)
Um Marius Manole herum,
kreisend, paradigmatisch
in drei verschiedenen
Stellungen abgebildet,
mit verschwommenen
Umrissen:
Alexander
Bălănescu, die Verkörpe-
rung des Klangs, der
Töne, der Mysterien
und Urkräfte.
Linktipp
www.arcub.ro
|
|
Das
Hirn steckt nicht im Schädel. Es kommt vom Kaspischen Meer. Dies erfährt der
auf begrifflicher und emotionaler Ebene systematisch und zielorientiert
verunsicherte Zuschauer von Felix Alexas bewundernswerter, auf Emil
Iordaches rumänischer Übersetzung basierender Gogol-Inszenierung
(Bühnengestaltung: Diana Ruxandra Ion). Die Premiere fand am 1. Februar 2013
im Bukarester ArCuB-Saal statt.
Die Russen
kommen! Nein, sie waren schon immer da, mit ihrer ganzen Kultur, mit ihrer
abgründigen Philosophie, mit ihrem Geschick, herauszufinden, wie der
Angstschrei, wie der Todesschrei eines Menschen in Anbetracht seiner
Gedankenwelt dramatisch zu destillieren und den Mitmenschen zu kommunizieren
sei, die ja oft bereits längst selber an ihrem eigenen Schrei ersticken,
ohne es zu ahnen, weil sie nicht wissen, dass sie schreien wollen, weil sie
nicht wissen, was ihre Gedankenwelt "im Innersten
zusammenhält", um es mal ein bisschen out of line mit Goethe zu
sagen. Freilich: An einem Gogol kann man sich die Finger verbrennen. Der
rumänische Regisseur Felix Alexa kam heil davon.
Was diese
Aufführung ohne viel Aufhebens bewerkstelligt, ist eine im
durchaus besonnenen Ton formulierte Argumentation aus
progressiv entgleisender Sicht. Eine tiefgreifende und – Hand aufs Herz –
ziemlich anstrengende Auseinandersetzung mit den grundlegenden Gegebenheiten
des Menschseins, mit dem jenseits der Illusion gesellschaftlicher Bindungen
vereinzelnden Individuum und seiner Gedankenwelt, mit seiner Dürftigkeit,
mit der Unbehaglichkeit des freien Willens und seinen Grenzen. Ein Hader auf
allerkleinstem Raum, kurz, ein Verhängnis: erzählen zu wollen, was in keine
Geschichte passt. Die ganze Tragik des Zusammenbruchs von Vernunft und
Verstand.
Schon aus dem
grafisch gelungenen Programmheft dringt der zum Teil
erkundende, zum Teil wissende, zum Teil bangende, ja wie flehende Blick
eines Mannes durch, der sich in zunehmendem Maße seiner Befangenheit bewusst
wird, ihr dabei jedoch keinen Sinn abzugewinnen vermag und daran schließlich
verzweifeln muss. Dank der durchaus überzeugenden Leistung des
Hauptdarstellers Marius Manole und der folgerichtig und stimmig
ausgearbeiteten (nicht nur) musikalischen Begleitung seines "Alter Ego"
Alexander Bălănescu wird eine vorzüglich ansprechende Diskursivität des
szenischen Werdegangs gewährleistet, die den Rahmen der menschlichen
Bedingtheit und ihrer überwältigenden Tragik, ja jeden Rahmen – und jedes
Zwangshemd – sprengt.
Der in Rumänien
längst berühmte Schauspieler Marius Manole schafft es, den Zuschauer von der
Authentizität, von der zeitgenössischen Relevanz der Handlung
– sprich Verwirrung – zu überzeugen. Was er
durchmacht, ereignet sich nicht im fernen Russland, nicht in der
Vergangenheit, nicht in Gogols Welt, sondern hier und jetzt, in unserer Welt,
in unserer Zeit. Das geht uns an. Das zermürbt uns. Das jagt uns einen
Schrecken ein, einen ontologischen Schrecken.
Fast will einem da Georg Büchners Lenz einfallen, dem es – wie vom Autor
beiläufig mitgeteilt wird – "manchmal
unangenehm [war], daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte." Oder Kafkas
Urteil. Oder Hoffmannsthals Brief. Dank der Authentizität
der Inszenierung merkt man, wie aktuell die grundlegende Frage ist, Sinn und
Sinnlosigkeit zu trennen, ein (logisches) Urteil zu fällen, ein gescheites
Wort aufzuzeichnen: sich überhaupt noch was
einfallen zu lassen über das Leben, die Welt, die Frau, das Aufblitzen eines
erhabenen Moments, das Spitzen eines Bleistifts.
Eine
Gogol-Geschichte über ein der geistigen Umnachtung verfallendes Individuum
zu einem Hundert-Minuten-Marathonlauf durch eine begrifflich kaum fassbare
Seelen-Einöde szenisch aufarbeiten: zu einer "fantastischen und ergreifenden
Sinfonie", zu einem "subtilen Miteinander von Text und Musik, zwischen dem
Realen und dem Imaginären". Nichts weniger hatte der Regisseur Felix Alexa
im Sinn, als er an "seinem" Wahnsinnigen bastelte. Und jeder Satz, dem
Marius Manole mit Schwung und reflektierender Lebendigkeit szenische Wirkung
einhaucht, sitzt. Jede Saite (des Violinisten Alexander Bălănescu)
schwingt die wundersamen Töne unserer Selbstheit und unserer Andersheit und
unserer ontologischen Einsamkeit in jene Schichten des Seins, die uns am
wenigsten behagen: wo die Gedankenwelt des Individuums nicht mehr im Selbst
generiert wird, sondern das gleichsam in seiner Eigenschaft als
vernünftiges, als räsonierendes Wesen ausgeschaltete Individuum von außen
her überkommt, etwa vom Kaspischen Meer.
In Marius
Manoles mal vage aufbegehrenden, mal schier trotzigen, mal wie einsichtig
grübelnden, mal verheißungsvoll vielseitig bejahenden Zügen spricht
Unbändigkeit und Lähmung, Sprachgewalt und Entsetzen: vor dem Alleinsein
im weitesten Sinne, vor dem Unvermögen, etwas Gereimtes, etwas in sich
Zusammenhängendes zu formulieren, etwas, das auch außerhalb des Selbst (und
seines Alter Ego) Bestand habe. Manole spielt den (mutmaßlich) ins Irrenhaus
eingewiesenen schizophrenen Helden
Poprischtschin, der die
Grenzen zwischen dem Normalen und dem Abnormalen dergestalt entschärft, dass
einer gar nicht mehr weiß, wann das ursprünglich ganz vernünftig,
wennschon nicht gleich erbaulich klingende Selbstgespräch eines
Durchschnittsmenschen mit überdurchschnittlichen Ambitionen ins total
Sinnwidrige ausschwenkt.
Poprischtschin
ist der irrende Geist, dem das Gebäude der Logik zu eng wird. Um ihn herum
schweben Instanzen einer Wirklichkeit, deren Unsch ärfe
auch auf dem Programmheft bedeutungsvoll und kreativ wiedergegeben wird.
Klar erkennbar: Marius Manole, die Verkörperung
des Wortes. Um ihn herum, kreisend, paradigmatisch in drei verschiedenen
Stellungen abgebildet, mit verschwommenen Umrissen:
Alexander Bălănescu, die Verkörperung des
Klangs, der Töne, der Mysterien und Urkräfte, die um das Wort herum unter
anderem unter Berücksichtigung der in die Aufführung eingebauten
erkenntnistheoretischen Zusammenhänge das Sagen haben.
Aufzeichnen
heißt Festhalten. Nur, das Schreiben verfällt zu einer mechanischen
Tätigkeit, das Denken zu einer zwecklosen, linkischen Handhabung von
Begriffen, von Informationen, von Gedankenzügen, die nirgendwo hinführen.
Seine Vernunft kommt ihm abhanden. Der Mensch wird entmenschlicht. Und doch.
In den
"Aufzeichnungen" werden sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne
viele Bleistifte gespitzt. Und dann werden sie freilich wieder gebrochen:
diese brutale Dekonstruktion einer festhaltbaren szenischen Wirklichkeit
synthetisiert vielleicht am besten das weit ausholende Bestreben dieses
Gogol-Projekts, von der Unsagbarkeit der Dinge zu
erzählen.
Was nicht
(mehr) gesagt werden kann,
was in keine gescheite Formulierung mehr passt, wird durch Musik
wettgemacht. Wegweisend, betörend, verdoppelnd, nein, vervielfachend und
gleichsam in andere Dimensionen der Wahrnehmung einbettend wirken Bălănescus
Töne, beklemmend wirken seine Worte, die nicht seine Worte sind, sondern
jene aller sonstigen Personen, und dazu die des Helden dieser zweckmäßig
fehlgeratenen Handlung. Verloren blickt uns Marius Manole entgegen. Uns: den
Gefundenen. Dass die "Aufzeichnungen" letztendlich im wundersamen
Aufgehobensein zwischen Text und Musik leserlich werden, gehört
zu den mitschwingenden Konsequenzen einer Metatext-Dialogik, an der man noch
lange nach dem Fall des Bühnenvorhangs kauen darf. |
|
