|

(c) www.vol.at
Wolfgang Hermann
geb. 1961 in Bregenz,
Schulausbildung in Dornbirn,
Matura 1981.
Anschließend
Studium der Philosophie und
Germanistik in Wien, Promo-
tion mit
einer Arbeit über
Hölderlin. Mitarbeit an einem
Forschungsprojekt der
Uni-
versität Wien. Seit 1987 freier
Schriftsteller. Lebte von 1987
bis 90 in
Berlin, anschließend
fünf Jahre in Frankreich
(Paris
und Aix-en-Provence).
Zahlreiche Reisen mit längeren
Aufenthalten, u.a. auf Sizilien,
in Tunesien,
in New York.
1996-98 Universitätslektor
an der Sophia Universität,
Tokyo.
Lesereisen durch
Japan und Korea. Erzählungen
und Gedichte erschienen in
Sammelwerken u.a. in
englischer, französischer,
spanischer, arabischer,
japanischer, koreanischer
Sprache.
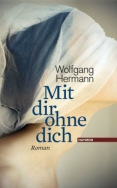
Wolfgang Hermann.
Mit dir ohne dich.
Haymon, 2010. 152 S.
ISBN: 3852186242
"Am meisten staunte ich,
als ich zum erstenmal ins
Salzkammergut kam. Das
war Österreich, wie ich es
nur aus Heimatfilmen
kannte, überall Dirndl
und Loden, eine Natur
wie aus der Schmuck-
schatulle."

Wolfgang Hermann.
Herr Faustini verreist.
Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, 2006. 139 S.
ISBN: 3552060251
"Früher habe ich
geglaubt, ich könnte im
Unterwegssein wohnen,
im stetigen Aufbruch, aber
meine Welt ist kleiner
geworden, manchmal
nussschalenklein, faustini-
klein, und der Weg hinaus
aus der Enge scheint oft
unmöglich."

Wolfgang Hermann.
Konstruktion einer Stadt.
Limbus, 2009. 110 S.
ISBN: 3902534273
"Wer bin ich? Ich bin
eigentlich Kleinstädter,
aufgewachsen in einer
emsigen, kleinen Welt mit
protestantischer Arbeits-
moral, doch ohne die
Weltzugewandtheit des
Protestantismus, der ja
einen Ausweg aus der
dunklen Verhocktheit des
Katholischen bietet."

Wolfgang Hermann.
In Wirklichkeit sagte ich
nichts. Erzählungen.
edition laurin, 2010, 128 S.
ISBN: 3902719389
"Jeder große Autor schafft
seine ganz eigene Welt,
deren Lichtkreis wohl erst
für die Nachgeborenen so
recht leuchtet. Ich kann
leider schwer darüber
urteilen, was die österrei-
chische Literatur von
heute ausmacht."
Linktipp
www.wolfganghermann.at
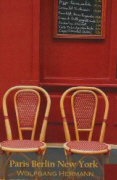
Wolfgang Hermann.
Paris. Berlin. New York.
Limbus, 2008. 102 S.
ISBN: 3902534214
"Die Zeit scheint ein
Stein zu sein, der im
Innern anwächst und
irgendwann alle
Ausgänge blockiert."

Wolfgang Hermann.
Das Gesicht in der Tiefe
der Straße. Momente
einer Stadt.
Otto Müller, 2004. 157 S.
ISBN: 3701310823
"Es gibt eine Familie derer,
die nahe am Abgrund
dichten, Poeten der Über-
schreitung wie Hölderlin,
Kleist, Nerval, Rimbaud,
Lautréamont, Trakl usw.
Und es gibt die Familie der
zärtlichen Schüchternen,
wie Robert Walser, wie
Celan, wie Philipp Jaccottet
usw. So gibt es mehrere
Indianerstämme von
Poeten und schreibenden
Haudegen, die Familie der
Trunkenbolde und Mann-
Männer, die Familie der
Träumer, der Aufschneider
und Angeber, der schüch-
tern Liebenden, der
Schwebenden und der
irdischen Kraftlackeln."

Wolfgang Hermann.
Ins Tagesinnere. Gedichte.
Otto Müller, 2002. 108 S.
ISBN: 3701310467
"Von den richtigen Maßen
eines gelungenen Buchs
weiß ich nichts, ich ver-
suche sie jedesmal neu
zu finden, fange immer
wieder bei Null an. Mehr
tue ich nicht. Ich gehöre
der altmodischen Spezies
von Menschen an, die
glauben, das Werk benö-
tige ihrer (und sie seiner)
nur solange es entsteht."

Vasile V.
Poenaru
bardaspoe [at]
rogers.com
geboren
1969, zweisprachig
aufgewachsen, Studium der
Germanistik in Bukarest,
darauf Verlagsarbeit und
Übersetzungen. Lebt
in Toronto.
|
|
Wolfgang
Hermann, unauffälliger Verfasser der vielbeachteten Faustini-Romane,
stiller Tracker und Vermittler eines Japanischen Fährtenbuchs,
hellwacher Architekt einer philosophisch-kapriziös gezeichneten inneren
Konstruktion einer Stadt, der das Handwerk des Schreibens auch mal als
Entfesselung oder gar als Ausgeliefertsein erlebt (so im 2010 erschienenen
Roman Mit dir ohne dich), ist stets auf der Suche nach "den richtigen
Maßen eines gelungenen Buchs".
In Anerkennung
seines literarischen Schaffens erhielt er 2007 den Förderpreis zum
Österreichischen Staatspreis für Literatur (Laudatio: Erich Hackl). Seine
Werke wurden u.a. in der Neuen Zürcher Zeitung (Leopold Federmair),
in der ZEIT, in der Berliner Morgenpost, in der Wiener
Zeitung, in Literatur und Kritik, im Wespennest, in der
Schreibkraft, in der ADZ (Allgemeine Deutsche Zeitung für
Rumänien) und im ORF besprochen.
Im
folgenden Interview erörtert der Autor das österreichische Gefühl spannender
Sprachkunst aus der Perspektive eines Vorarlbergers, der in Berlin, Paris oder
Tokyo nicht fremd ist, im "tiefen Österreich" (etwa im Salzkammergut) jedoch
zu staunen anfängt. Geschickt weicht Hermann verallgemeinernden Fragen über
den Begriff "österreichische Literatur" aus und wirft seinerseits im
breiteren Wirkungsfeld der Ende 2010 erfolgten Grazer manuskripte-Feier
rund um Alfred Kolleritsch und dessen Autorenschar zweckmäßige Fragen auf,
die den "Stamm der Schreibenden" im weitesten Sinne – über räumliche,
zeitliche und sprachliche Grenzen hinweg – angehen.
Sein Vorarlberg
kennt Wolfgang Hermann auch von einer gewissen "behäbigen" Seite. Sein
Berlin gibt es nicht mehr, und Paris ist weit, um es so auszudrücken (und
Japan erst recht). Was die Österreicher schreiben, weiß Hermann – und er
versteht sich auch darauf, ihr Wirken, ihre Bedeutungssphäre, ihre Tonlagen
und "so manche Arten des Blicks auf die Dinge der Welt" in die Diskussion
einzubinden.
Wien gehört
jetzt wieder zu seinem näheren Umkreis, da weiß er als "Miniaturreisender,
ein Reisender von Augenblick zu Augenblick", ein paar Menschen, die ihm
wichtig sind – und es gibt dort mehr als nur ein paar Cafés. Wie Österreich
schmeckt, weiß er nicht.
Jahrelang
dachte Wolfgang Hermann sein Zuhause im Unterwegssein zu finden. "Ich
schlafe in einem Bett aus Papier", hieß es noch in seiner Berliner Zeit.
Oder in Traum von der rauchenden Stadt: "Niemand sagt, was er denkt.
Zu sagen, was er denkt, wäre für einen Menschen von hier Verrat."
Jetzt lebt und wirkt der gleichsam auf
Umwegen aus der dritten Person auf die erste zustrebende Beobachter
kleinster Dinge des Alltags wieder zu Hause in Österreich.
Von draußen
kommen, das ist bei Wolfgang Hermann eine Konstante des Schreibens. Freilich
fragt sich der Autor: "Aber wer ist denn drin?" Ein Österreicher, der nicht
weiß, wer er ist. Einer, dessen Wanderpfade auf dem Gebiet der Literatur
sich an Gemeinplätzen vorbeischlingeln, ohne sie unbedingt zu meiden. Einer,
der sich nicht so leicht zur Marke abstempeln lässt und dem Allgemeinen
gerne das Einzelne entgegenhält – nicht so sehr um ein Urteil zu fällen,
sondern eher um Zeugnis abzulegen. Sein Weg ins Freie ist ein Ausweg hinaus
aus der Enge, ein Weg, der oft unmöglich scheint. Die Zeit: "Ein Stein, der
im Innern anwächst und irgendwann alle Ausgänge blockiert". Die Hoffnung auf
eine neue Seite: der Antrieb zum Sein. Das Weiterschreiben: ein Fortdauern.
AM:
Lieber Wolfgang Hermann, Sie sind gerade aus Graz zurückgekehrt, wo im
Dezember 2010 manuskripte, die Zeitschrift "von funfzig Jahren"
(um gleich mal auch ein bisschen Goethe in die Diskussion
hineinzuschmuggeln) von drei mal funfzig Schriftstellern ganz groß
gefeiert wurde. Haben Sie Ihren Koffer mitgehabt? Oder: Brauchen Sie für
so etwas einen Koffer?
Wolfgang Hermann:
Ja, ich hatte meinen Koffer dabei, einen ganz kleinen, federleichten,
aber leider nicht so schön altmodischen wie Herr Faustini ihn benutzt.
AM: Ein Österreicher in
Graz: War das für Sie ein Besuch oder sind Sie zu Hause in dieser Stadt,
in diesem Land ... ?
Wolfgang Hermann:
Ich bin selten in Graz, zuletzt 2006, um aus "Herr Faustini verreist"
vorzulesen. Ich mag Graz, die schön gewundenen Gassen der Altstadt, aber
ich staune doch immer wieder in den österreichischen Städten, wie
österreichisch sie sind. Denn außer Vorarlberg und Wien kenne ich
Österreich kaum. Aber Vorarlberg ist exterritorial, das merkt man erst,
wenn man ins tiefe Österreich kommt. Am meisten staunte ich, als ich zum
erstenmal ins Salzkammergut kam. Das war Österreich, wie ich es nur aus
Heimatfilmen kannte, überall Dirndl und Loden, eine Natur wie aus der
Schmuckschatulle. Ich fühlte mich wie auf Zeitreise durch den Film
"Sound of Music", sogar ein Schlecker-Geschäft konnte meinen Eindruck
nicht trüben.
AM: ...
und in dieser Sprache, dem Deutschen. Und im Englischen. Und im
Französischen. Und ... Paris, Berlin, New York, Tokyo: alles in Ihrer
Hosentasche. Wenn sich einer zum Beispiel Ihren Herrn Faustini (mit dem
Koffer auf dem Umschlag) anschaut, muss er gleich denken: Ja das ist
noch ein echter Koffer, ein ordentlicher Koffer. Reist es sich besser
auf Umwegen?
Wolfgang Hermann:
Zu Hause bin ich nirgends richtig. Eine zeitlang war ich es im
Unterwegssein. Aber ich bin nicht robust genug, um ein Weltreisender zu
sein, schön wärs. Die sogenannten Weltstädte liegen ja schon seit
längerem nicht mehr auf meiner Reiseroute. Mein Hauptreiseziel ist Wien,
wo ich ein paar Menschen weiß, die mir wichtig sind, mit denen ich gute
Stunden im Café und auf Spaziergängen verbringe. Früher habe ich
geglaubt, ich könnte im Unterwegssein wohnen, im stetigen Aufbruch, aber
meine Welt ist kleiner geworden, manchmal nussschalenklein,
faustiniklein, und der Weg hinaus aus der Enge scheint oft unmöglich.
Bis die Enge sich löst, aufgeht, wenn ein warmer Wind in die Bäume fährt
und alles zusammenkommt, alles sich fügt wie von selbst, dann geht meine
Welt wieder auf. Ich bin wie Faustini ein Miniaturreisender, ein
Reisender von Augenblick zu Augenblick, immer in der Hoffnung, der
Horizont möge sich öffnen, der Boden fest sein, auf dem ich stehe.
AM:
Zum Thema Rückkehr und Identität: "Ich bin, der ich bin", hieß es noch
bei Hölderlin, über den Sie ja mal in good old Vienna
promovierten – und dann bei Schnitzler: "Mir sein mir". Ja wer sind wir
denn? Wer sind Sie?
Wolfgang Hermann:
Wenn ich wüsste, wer ich bin, müsste ich vielleicht nicht schreiben. Weil
ich es aber nicht weiß, schreibe ich. Aus dem Nichtwissen heraus zu
schreiben, das ist vielleicht typisch österreichisch? Ob man das mit der
Geschichte entschuldigen kann, ewig mit dem Sermon vom Ende der
Donaumonarchie? Bei Joseph Roth mag das noch gestimmt haben, als der
Wind der Welt noch durch die Steppen Galiziens wehte. Aber heute, wo
nichts mehr festen Halt bietet, schon gar keine Idee von einer Nation
mehr, gegen und mit der man anschreiben konnte, wie Hofmannsthal noch in
seinen wunderbaren "Briefen eines Zurückgekehrten" – wogegen, auf
welchem Boden sollte ich heute noch schreiben? Ich muss ihn mir jedesmal
neu erfinden, aus der Luft heraus, aber diese Luft ist eigentümlich
getränkt, von eigenem Licht gefärbt, hierzulande eben österreichisch. Da
ich nicht aus dem wirklichen tiefen ländlichen Österreich komme, habe
ich auch nichts dagegen anzuschreiben. Ich kenne es kaum, dieses
Land-Österreich, so wie ein Innerhofer es kannte, ein Winkler es kennt,
oder der wunderbare Reinhard Kaiser-Mühlecker es kennt. Bei ihm scheint
es in einem ganz eigenen, neuen und doch alten Licht, dieses Land-Land
Österreich. Ich lese es mit Bewunderung, träume da mit, aber ich kenne
es kaum, außer bei Stifter und Franz Nabl, aber das ist eben nicht
"Hollabrunn liest Kronen Zeitung". Wer bin ich? Ich bin eigentlich
Kleinstädter, aufgewachsen in einer emsigen, kleinen Welt mit
protestantischer Arbeitsmoral, doch ohne die Weltzugewandtheit des
Protestantismus, der ja einen Ausweg aus der dunklen Verhocktheit des
Katholischen bietet. Nicht aber im tiefkatholischen Vorarlberg, wo sich
der Glaube in die "Realitäten" des Immobiliengewerbes verflüchtigt hat.
Eine karge Welt, in der außer dem Glauben an die Grundstückspreise nicht
viel geblieben ist. Da blieb in anderen Gegenden Österreichs vielleicht
noch mehr Luft, in Vorarlberg fokussiert sich alles aufs Eigenheim, da
es unbezahlbar geworden ist.
AM:
Schreiben die Österreicher, weil sie nicht erzählen können – oder ganz
im Gegenteil? Wird jetzt österreichische Literatur "gemacht"? Wird Sie
nur noch verwaltet? Besser: Konnten Sie sich im fünfzigjährigen
Stadtpark die schöne Arbeit des Windes ansehen?
Wolfgang Hermann:
Ich kann schwer über "die österreichische Literatur" sprechen, ich sehe
nur viele Einzelstimmen, und es sind die Einzelnen, die mich
interessieren, über Trends kann ich nicht viel sagen, das überlasse ich
denen, die das als Handwerk betreiben. Natürlich könnte man einstimmen
in den alten Sermon vom Verfall der Literatur, denn welches Buch der
Gegenwart würde man gerne getrost neben die Werke Stifters, Roths,
Brochs und Musils halten. Jeder große Autor schafft seine ganz eigene
Welt, deren Lichtkreis wohl erst für die Nachgeborenen so recht
leuchtet. Ich kann leider schwer darüber urteilen, was die
österreichische Literatur von heute ausmacht. Ich habe bei der
manuskripte-Jubiläumsfeier in Graz, die vor allem eine Feier für das
Lebenswerk Alfred Kolleritschs war, 150 Autoren gesehen und möchte mir
nicht anmaßen, deren Werk beurteilen zu wollen. Und der Wind wehte
klirrend kalt, so kalt, dass ich beim Gang an der Mur fast selbst zu Eis
wurde.
AM: Sie
schlafen in einem Bett aus Papier, so steht es geschrieben. Gehört das
zur Gewachsenheit des Schrift? Ist Ihr Abdruck ein lesbarer?
Wolfgang Hermann:
Das Bett aus Papier gehört einem Berliner Freund und in meine Berliner
Zeit, die solange zurückliegt, dass ich erschrecke. Die Zeit scheint ein
Stein zu sein, der im Innern anwächst und irgendwann alle Ausgänge
blockiert. Der Wind weht scharf um die Hausecken, man starrt auf ein
altes Türschild, sucht im Gedränge der U-Bahn nach einem Gesicht von
damals, aber alles, die ganze Welt von damals ist zusammengeschrumpft
auf den inneren Stein, mit dem man irgendwie leben muss. Man hält
Ausschau nach jemandem, der das ohne viele Worte verstehen würde.
Sprachlosigkeit legt sich Schicht für Schicht um diesen Stein, und
irgendwann erinnern wir uns nicht mehr, was sich darin verbirgt, und die
zunehmende Müdigkeit lässt uns die Empörung darüber vergessen, die uns
einst umtrieb, das Staunen und das Entsetzen, das am Anfang des
Schreibens stand. Wenn das ganz aufhört, dann ist es auch mit dem
Schreiben vorbei.
AM: Den
Überblick über 50 Jahre manuskripte ließ der manuskripte–Boss
von Musikern und Schauspielern aufbieten, denn die seien "besser als
Autoren im Zaum zu halten." Und die Häppchen können dann leichter
serviert werden, erläuterte Kolleritsch. Was stimmt noch vom Bild der
Ungebändigkeit der schreibenden Spezies in Österreich? Besteht ein
Widerspruch zwischen spannender Sprachkunst und schmackhaften Häppchen?
Wolfgang Hermann:
Mich interessiert das Innen der Literatur und des Schreibens, nicht das
Außen.
AM:
Österreiche Literatur: Gibt es das? Darf man, muss man etwa mit dem
Schweizer Hugo Loetscher (und sozusagen "gegen" Urs Widmer) von einer
"Literatur deutschsprachiger Ausdrucksweise" sprechen? Ästhetisch
ausgedrückt (natürlich anhand der Häppchen-Perspektive): Nach was
schmeckt Österreich? Ja schmeckt Österreich?
Wolfgang Hermann:
Mehr als nationale Kategorien verbinden manche Tonlagen, manche Arten
des Blicks auf die Dinge der Welt einzelne Autoren miteinander. Es gibt
sozusagen Familienmitglieder, die miteinander über die Zeiten hinweg in
Verbindung stehen. Es gibt eine Familie derer, die nahe am Abgrund
dichten, Poeten der Überschreitung wie Hölderlin, Kleist, Nerval,
Rimbaud, Lautréamont, Trakl usw. Und es gibt die Familie der zärtlichen
Schüchternen, wie Robert Walser, wie Celan, wie Philipp Jaccottet usw.
So gibt es mehrere Indianerstämme von Poeten und schreibenden Haudegen,
die Familie der Trunkenbolde und Mann-Männer, die Familie der Träumer,
der Aufschneider und Angeber, der schüchtern Liebenden, der Schwebenden
und der irdischen Kraftlackeln. Auch unter den großen Epikern gibt es
eigene Indianerstämme, verbunden durch geheime Netze. Wer ganz einsam
blieb, ist Marcel Proust, in dessen Kathedrale aus Licht und Schatten
keiner zu folgen vermochte. Auch Stifter ist so eine schöne einsame
Insel, von der ein wunderbares Licht abstrahlt. Wie Österreich schmeckt,
weiß ich nicht. Dazu lebe ich schon zu lange wieder hier. Aus dem
Ausland kommend, beim ersten Kontakt mit dem Dialekt am Flughafen, im
Zug glaubt man eher zu wissen, was das Land ausmacht. Aber auch das ist
nur eine Illusion.
AM:
Sie haben sich etwa zehn Literaturpreise zustecken lassen. Ihre Fährte
reicht vom stillen Gesetzmäßigen zwischen allerkleinsten Zeilen bis hin
zum hinreißenden Shootingstar, der den Roman schreiben will, aber nicht
kann – und dann doch. Die Spur, die Sie hinterlassen haben, führt wieder
zurück nach Bregenz. Sehen die Flugzeuge am nächtlichen Himmel da aus
wie Shootingstars? Ist etwa das Bogenschießen aus Ihrer japanischen Zeit
noch da? Wie lässt sich die Welt am Standpunkt Bodensee umspannen?
Wolfgang Hermann:
Reisende sehen im Land um den Bodensee vor allem dessen idyllische
Seite, die Schönheit der Landschaft, im Winter die verschneiten
Skipisten. Die Berge hier bieten wunderbare Zeiten der Stille. Das
Rheintal hingegen ist eher unruhig und seltsam fahrig, nicht besonders
geschmeidig. Wer länger in Vorarlberg bleibt, dem wird eine gewisse
Schwere und Behäbigkeit auffallen, an die man sich entweder gewöhnen
kann oder nicht – und dann verreisen muss. Da die Welt in jedem Sandkorn
enthalten ist, kann man auch hier ganz nach innen gehen und staunen. Wer
aber die frühmorgendlichen Regenfarben im Wasserstrahl der
Straßenreinigungsfahrzeuge in Paris sehen möchte und daraus sein Glück
zieht, der muss dorthin aufbrechen.
AM:
Produktionswut ist bei Ihnen wohl das falsche Wort. Trotzdem: Es kommt
so manches auf den Leser zu – mal angemessen, mal befremdend. Welches
sind die richtigen Maße für ein gutes Buch? Ist der Autor ein Mensch?
Ist er eine Marke? Ein Rädchen im Getriebe, im Literaturbetrieb?
Wolfgang Hermann:
Der Autor lässt mit Hilfe seiner Einbildungskraft eine Serie von Bildern
erstehen, die sich mehr oder minder gelungen zu einer Kette, einem
Gebinde, einer Geschichte fügen sollen. Von den richtigen Maßen eines
gelungenen Buchs weiß ich nichts, ich versuche sie jedesmal neu zu
finden, fange immer wieder bei Null an. Mehr tue ich nicht. Ich gehöre
der altmodischen Spezies von Menschen an, die glauben, das Werk benötige
ihrer (und sie seiner) nur solange es entsteht.
AM:
Das literarische Werk? "Ein Geschenk. Ein Geschenk an die Leserschaft."
So der Kanadier Yann Martel, gerade noch ein Shootingstar unter den
Jungautoren (wie Richard Marten in Ihrem Roman Mit dir ohne dich).
Ihr Held Marten meint, man möge den Text, jeden Text, als Geschenk
nehmen, ohne davon abhängig zu werden. Ist das eine Faustregel?
Wolfgang Hermann:
Ich denke, es ist gut, alle Dinge des Lebens als Geschenk zu betrachten,
ohne sich von ihnen abhängig zu machen. Das ist leicht gesagt. Ein
Autor, der nicht schreiben kann, ein Mann, der von seiner Frau verlassen
wird, ist herausgefordert, die Dinge in Ruhe zu lassen, nichts zu
forcieren, zu warten, bis das Leben zu ihm zurückkehrt, mit Geschenken,
Begegnungen.
AM:
"Stadt, sei gut zu mir." Würden Sie es heute noch so sagen?
Wolfgang Hermann:
Ein solcher Satz folgt einem lyrischen Gesetz, einer inneren Welle. Wenn
sie da ist, trägt sie einen manchmal an seltsame Ufer. Ja, ich würde es
wieder so sagen.
AM:
Sich mit einer Stadt, mit einem Text, mit einem Konstrukt anfreunden,
ist nicht jedermanns (und nicht jeder Frau) Sache. Gibt es Ihr Berlin
noch?
Wolfgang Hermann:
Berlin wie es heute ist, kenne ich nicht. In der Erinnerung schrumpft
eine Stadt nach vielen Jahren auf einen kleinen Kern zusammen, auf
einzelne Bilder, auf intensive Augenblicke, ein Lächeln, das man an
einer Hausecke bekommen hat. Mein Berlin ist irgendwo in mir verborgen,
die Jahre, die ich dort erlebte. Wie es wirklich ist, weiß ich nicht.
Für jemand anders ist es eine völlig andere Stadt.
AM:
Und – weil wir schon mittendrin sind in Ihrer Dekonstruktion des
Begriffs Stadt, der verlorenen Hymäre des städtischen Lebensgefühls –
zum Schluss noch ein Zitat von Ihnen: "Ist dort Draußen? Ich bin einer
von draußen, nicht wahr, sagt mir, ich bin einer von draußen, komme ich
von draußen sagt sagt sagt" (Wolfgang Hermanns Zeichensetzung
beibehalten, Red.) Das Namensagen ist die Zeit, wenn sie vergeht, so
Kolleritsch. Gibt es noch etwas außerhalb dieses Landes, dieser Zeit,
dieser Stadt, dieser Sprache?
Wolfgang Hermann:
Wer draußen ist, sieht die Dinge schärfer, denn er sieht sie aus dem
Mangel, aus dem Nichts in ihm selbst. Selbst? Wer oder was ist das für
den, der draußen ist? Wer schreibt, ist schon draußen. Aber wer ist denn
drin? Auch der glückliche Mensch in Gemeinschaft erlebt irgendwann den
Augenblick, wo sich die Schleier des Lebens, der Geborgenheit heben und
sich das nackte grausame Leben zeigt, wie es umgeben vom Nichts um sein
Fortdauern zappelt.
|
|
