|

Vasile V.
Poenaru
bardaspoe [at]
rogers.com
geboren
1969, zweisprachig
aufgewachsen, Studium der
Germanistik in Bukarest,
darauf Verlagsarbeit und
Übersetzungen. Lebt
in Toronto.
Immer geht es Gauß auch
um Sprachliches, nie nur
um Sprachliches. Immer
geht es ihm auch um
Persönliches. Doch nie
und nimmer bleibt es
beim Nur-Persönlichen.
Der Bogen wird weit
gespannt. Und die Leser
spüren, da ist schon
was dran.

Literatur und Kritik:
"Neue Romane",
September 2013, Nr. 477/478.
Irgendwie ist es nun, als
säßen wir, die Leserschaft
der Visitenkarte Österreichs,
allesamt im wundersam
klangvollen Prunksaal
eines alten Schlosses im
schönen Tirol, um in Erfah-
rung zu bringen, was so
alles in diesem einen Wort
steckt: Aufbruch.
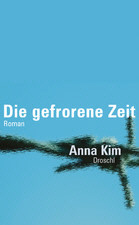
Anna Kim.
Die gefrorene Zeit.
Droschl, 2008, 147 S.
ISBN: 3854207425
Ob Literatur langweilt
oder nicht, das dürfen ja
bekanntlich nicht die
Herausgeber selber ent-
scheiden, sondern die Leser
oder
– insofern als sich die
Leser in Geschmacks-
sachen gerne bevormun-
den lassen – die Rezen-
senten und Literatur-
kritiker.
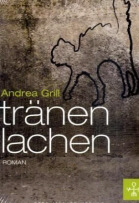
Andrea
Grill.
Tränenlachen.
Otto Müller, 2008, 208 S.
ISBN: 3701311536
"Ja, der Aufbruch weiß
von sich selbst, dass er
notwendig ist, aber nicht,
was er im Nachhinein
historisch für die Mensch-
heit oder lebensgeschicht-
lich für den einzelnen
bedeutet haben wird."
(Karl-Markus Gauß)
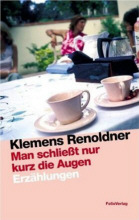
Klemens
Renoldner.
Man schließt nur
kurz die Augen.
Folio, 2008, 166 S.
ISBN: 3852564476
Als
Literatur und Kritik
von Gauß wiederbelebt
wurde, wehrte sich die alte
Garde durch rechtliche
Schritte gegen die Beibe-
haltung des Namens
Literatur und Kritik.

Wolfgang
Hermann.
Abschied ohne Ende.
LangenMüller, 2012, 128 S.
ISBN: 3784432913
"Ich kann es
kaum
glauben, und doch ist es
wahr: meine Arbeit ist
fertig! Endlich! Nach
drei
Jahren! Welch ein Gefühl,
am Ziel seiner Anstrengung
zu sein! (...) Die
Arbeit ist,
mit großer Befriedigung
stelle ich es fest, voll-
ständig und
bereit zur
Niederschrift."

(c) schloss-wartholz.at
Die 1967 in Eferding (OÖ)
geborene Autorin Karin
Peschka erhielt 2013 den
Wartholz Literaturpreis für
ihren Text "Watschenmann".
|
|
Ob nun in der
Festspielstadt an der Salzach oder in der Olympiastadt am Inn: Ein Gau ß
jodelt sich, in den tieferen semantischen Schichten eines jedweden von ihm
ausgesprochenen Wortes verwurzelt, wie er es nun einmal ist, garantiert
nachvollziehbar durch die sprachliche und außersprachliche Landschaft eines
mal gleichklingenden, mal im großzügigen Reich der Andersheit
mitschwingenden Kulturkreises, der sich
bestens dazu eignet, den rechten Ton zu
setzen. Von A-Tönen bis zu O-Tönen: alles drin im Gaußschen Alphabet
transkontinentaler Erzählbarkeit.
Seit
gut zwanzig Jahren beglückt uns dieser Salzburger Buchstabenmeister aus
gutem – und freilich längst "verösterreicherten" – donauschwäbischen Hause
(denn Karl-Markus Gauß kam zwar in Salzburg auf die Welt, doch in seinem
kulturwissenschaftlich weit ausholenden und dabei dank seiner oft souver än
in den Raum gestellten Formulierung als Zusammenbruch von Welten erlebten
Wahrhaftigkeit der Aussage unwahrscheinlich vertraut klingenden Stil ertönen
auch lauter fremdartige Klänge, die den immer wieder erneut ins bittersüße
Tintenrevier der Sagbarkeit aufbrechenden Österreicher mit der Vorgeschichte
einer vielsprachigen Familie bereichern) mit seinen Editorials in der auf
allen Erdteilen gelesenen literarischen Visitenkarte Österreichs (mehr dazu
auch
hier).
Immer geht es
ihm auch um Sprachliches, nie nur um Sprachliches. Immer geht es ihm auch um
Persönliches, oft genug um die ansprechend kapriziöse Verortung einer
aktuellen Debatte – oder eben einer Debatte, die der Herausgeber geschickt
in die Aktualität rückt ;
doch nie und nimmer bleibt es beim Nur-Persönlichen. Der Bogen wird weit
gespannt. Und die Leser spüren, da ist schon was dran.
September
2013: "Wie merkwürdig vieldeutig ist er, der Aufbruch!" So Gauß’ erster Satz
in seinem vorletzten Editorial (LuK 477/478). "Aufbruch?" fragt der nicht
unbedingt klangkundige Leser, der nun eben einmal in manchem Rezensenten
steckt. "Wohin geht’s denn? Etwa nach Kanada? Oder einfach die Donau runter,
den intelligentesten Strom auf Erden?
"In die Berge",
kommt gleich die Antwort. Von irgendwoher kommt sie, von nah, von fern, vom
frühen Morgen der Festspielstadt am Mönchsberg, vom späten, ruhmvollen
Nachmittag österreichischer Farbtöne diesseits wie jenseits der Salzach,
wobei einer auf Anhieb gar nicht so genau sagen könnte, ob die der irgendwie
im Aufgehobensein einer längst verklungenen k. und k. Mentalität mit
eingebaute Arie aus alten Zeiten möglicherweise nicht etwa eigentlich
raffiniert fingierte Modernität ausmacht. Doch das gehört zur Sache.
Ganz am Schluss
des Editorials wird’s erklärt. Es handelt sich, wie es der klangkundigere
Leser (der freilich, wie gesagt, nicht unbedingt in einem jedweden
Rezensenten steckt) schon längst gemerkt hat,
um die Anrede, die Gauß zur Eröffnung der
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik hätte halten sollen; ein
Bandscheibenvorfall hielt ihn davon ab.
Immerhin
hat der geladene Redner den Text der Rede geschrieben, seine wohltemperierte
Stimme, die aus den ersten Seiten der Zeitschrift zur Leserschaft dringt,
gesellt sich nun im Nachhinein zur Stimme des Schauspielers hinzu, der die
Anrede im Prunksaal des Schlosses Ambras in Anwesenheit des österreichischen
Bundespräsidenten und weiterer prominenter Gäste aus gutem Hause vorlesen
durfte. Irgendwie ist es nun, als säßen wir, die Leserschaft der
Visitenkarte Österreichs, allesamt im wundersam klangvollen Prunksaal eines
alten Schlosses im schönen Tirol, um in Erfahrung zu bringen, was so alles
in diesem einen Wort steckt: Aufbruch.
Dass Gauß auch
schnell auf die gerade jetzt angesichts der bald eintretenden totalen
Arbeitsmobilität in der EU wieder mal besonders aktuelle Problematik der
Migration zu sprechen kommt, ist kein Zufall, gilt doch die innere Resonanz
der Gaußschen Worte immer auch seinen Mitmenschen vom Tellerrand, den
"Europäern der Peripherie" – und dem, was alles hervorquillt, wenn mal die
Hülle dieses vielschichtigen Begriffs aufbricht. Und neue Romane stecken
(auszugsweise) auch mit drin im jüngsten LuK-Heft, denn ein authentischer
Aufbruch à la Gauß muss natürlich nicht nur die gute alte Musik
berücksichtigen, sondern in erster Linie eben auch die gute alte
Literatur und Kritik. Anna Kim, Wolfgang Hermann, Andrea Grill, Klemens
Renoldner und Karin Peschka dürfen uns in den Seiten der Zeitschrift aus den
Romanen "vortragen", an denen sie gerade schreiben.
Es
handelt sich, so die Einleitung zum Dossier des Heftes (Neue Romane) um
"fünf Autorinnen und Autoren ,
die außer der Tatsache, dass sie alle aus Österreich kommen und Romane
schreiben, nur noch das eine gemeinsam haben werden: dass ihre Literatur
nicht langweilig ist […]" Das einzige Problem dieser Formulierung: Ob
Literatur langweilt oder nicht, das dürfen ja bekanntlich nicht die
Herausgeber selber entscheiden ("nicht langweilig" macht übrigens sowieso
ein gar nicht so kurzweiliges Gütesiegel aus), sondern die Leser oder
– insofern als sich die Leser in Geschmackssachen gerne
bevormunden lassen – die Rezensenten und Literaturkritiker ( und wie es ein
Ludwig einst so schön auf Deutsch-Französisch formulierte, wenn ich
mich nicht irre: Le
Rezensent und Literaturkritiker, c’est moi).
Dass die im Heft
vorgestellten Autorinnen und Autoren allesamt aus
Österreich kommen, ist auch nett ausgedrückt.
Das hört sich ja an, als seien die jetzt allesamt anderswo. Vielleicht ist
das aber wirklich der Fall.
Mal schauen:
Fehlanzeige. Alle fünf leben derzeit in Österreich, und vier
stammen auch aus Österreich ("kommen" passt also
wohl kaum, sonst klingelt gleich die Sprachpolizei);
die fünfte hingegen (was hier heißen will: die erste), die
südkoreastämmige Anna Kim, kommt in der Tat aus einem
anderen Land als dem, in dem sie jetzt lebt. Sie kommt aber nicht aus
Österreich, sondern eben aus Südkorea. Drücken wir es
zusammenfassend-schlichtend so aus: Ob es nun von Südkorea nach Österreich
oder von Österreich nach Österreich geht, was zählt, ist der Aufbruch.
Menschensucher,
so heißt etwa Andrea Grills
"Beginn eines Romans", in dem Menschen mit Blicken eingefangen und
Schmetterlinge unter die Lupe gebracht werden (oder war das umgekehrt?), der
Beginn eines Romans, in dem ein Körper eigene Ideen hat und das Ich zum
Aufbruch drängt, der aber "ein ganz unwissenschaftlicher" wäre.
Klemens
Renoldner schielt,
die Pistole in der Hand (so auch der Titel seines
Romans), auf Begriffe, über Begriffe hinweg,
an Begriffen vorbei.
Halunke, Anstand, Krieg, Tod, Gott, Österreich, Vergangenheit,
Vergangenheitsverschönerung, Vergangenheitsbewältigung. Durch den Lauf
seiner Pistole, genauer gesagt durch den Lauf der Pistole seines Großvaters,
der sehr zum erst jetzt, im Nachhinein, vom Ich-Erzähler kritisch
hinterfragten Stolz der Familie ein Offizier der Gendarmerie gewesen war,
späht der Autor in die ihm schon als Kind überlieferten Bruchstücke von
erlebter Geschichte, die er nun als Erwachsener neu ordnet, ohne sie dabei
unbedingt zu einem kohärenten Ganzen anwachsen zu lassen oder sie ihrer
intuitiven Unmittelbarkeit zu berauben.
Aufgebrochen
wird also in viele Richtungen, aus vielen Richtungen heraus. "Neue Romane"
steht unter dem lässig aufgeschlagenen älteren Buch, das auf dem
Vorderumschlag des Heftes abgebildet ist. "Das Doppel-, ja Mehrdeutige, das
dem Aufbruch von Anbeginn eignet", wird anhand dieses abgewetzten Buches,
das die Versinnbildlichung neuer österreichischer Romane in der
Vorstellungswelt der Leser begleiten soll, besonders wirkungsvoll
inszeniert. Das (von seiner Aufmachung und seinem erkennbaren Benutzungsgrad
her zu urteilen) mindestens ein paar Jahrzehnte alte Buch ist so ungefähr in
der Mitte aufgeschlagen. Die paar zum Teil sichtbaren Seiten sind
unbedruckt.
Neue
Aufbrüche beschert uns somit nicht nur die neue Alte Musik, sondern auch die
neue alte Welt der Romane. Es geht hier wohl vor allem um Aufbrüche, die zu
verschiedenartigen Perspektiven führen, die oft genug ruhig auch mal aus
älteren Zeiten überlieferte Sachverhalte in Augenschein nehmen, die
sinnstiftend aufbrechen. Um es mit Gauß zu sagen: "Es ist das Schöne und
Bedrohliche des 'Aufbruchs', dass sich vor ihm stets ein offener Horizont
des Möglichen auftut. Hinter ihm liegt etwas, das den Protagonisten des
Aufbruchs für abgelebt, überholt, in Tradition erstarrt gilt, aber was vor
ihnen liegt, das glauben sie zwar zu erahnen und möchten sie aus Eigenem
bestimmen, aber sie können es selbst doch meist nicht wissen. Ja, der
Aufbruch weiß von sich selbst, dass er notwendig ist, aber nicht, was er im
Nachhinein historisch für die Menschheit oder lebensgeschichtlich für den
einzelnen bedeutet haben wird." Und im letzten Abschnitt des Heftes
(Österreichisches Alphabet) bricht Franz Mayrhofer eben in die jüngere
Vergangenheit auf, um des 2008 verstorbenen
"Vollblut-Schreibers"
und Chefdramaturgen Christian Martin Fuchs zu gedenken. Es wird auch dadurch
eine begriffliche Kontinuierlichkeit des Aufbruchs gezeitigt, in dem
Literatur und Kritik seit 1991 begriffen ist, genauer: seit Karl-Markus
Gauß den Dirigentenstab übernahm.
"Erbe und
Absage", so hieß das erste Editorial der Ära Gauß(1).
Eine neue Ausrichtung, eine neue Melodie, einen neuen Ton bekam die
Zeitschrift damals in einem Zug. Und mit der Tradition wurde weitgehend
gebrochen. Nun gut, also: Tradition in der Zweiten Republik ... Als
Literatur und Kritik von Gauß sozusagen unter Missachtung bzw.
Infragestellung althergebrachter Machtstrukturen im Kulturbetrieb
entschieden wiederbelebt wurde, wehrte sich die alte Garde durch rechtliche
Schritte gegen die Beibehaltung des Namens Literatur und Kritik, und
die damals noch ganz im Bann der alten Machtstrukturen einher marschierende
Österreichische Gesellschaft für Literatur kündigte kurzerhand die über
hundertachtzig Abonnements, die sie in den letzten fünfundzwanzig Jahren
regelmäßig im Ausland vertrieben hatte.
Doch
wir wollen unseren Aufbruch nach hinten nicht so weit zurück ansetzen,
sondern nur zwölf – in gemäßigtem österreichischen
Schritt durchlaufene – Monate in eine Vergangenheit dringen, die
damals Gegenwart war. Auch vor einem Jahr kam in Literatur und Kritik
(Heft 467/468, September 2012) das Allzusprachliche auf seine Kosten; dabei
fängt das Editorial jenes Heftes bezeichnenderweise nicht in der schönen
Welt der Musik an, sondern beim Fußball. Nach dem Match eine andere Welt:
Zwei Fußballtrainer sitzen sozusagen in Karl-Markus Gauß‘ Editorial
auf der Bank. Der Deutsche "ermahnt" vom Österreicher korrektes Deutsch, und
zwar "in seinem Sauerländischen Dialekt, den er mit dem identifiziert, was
er für die verbindliche Form des Hochdeutschen hält." Ein
quasi-linguistisches Nachspiel – aus der Perspektive eines munteren
Herausgebers und Polemikers miterlebt, der auch mal den "Outstanding artist
award" des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst (u.a. für Autoren,
"deren Beitrag zur österreichischen Literatur ein outstandiger ist",
ausgelobt) mit seinen Pfeilen streift. Gewitzte Bemerkungen der Sorte Gauß.
Mit Fingerspitzengefühl und Sinn für die Sache formulierte Bemerkungen.
Bemerkungen, die sitzen.
Schon auf dem
Umschlag erfasst der inspirierte Fotograf Ferdinand Palanka, ein Alter Ego
des Herausgebers Gauß, in dem die donauschwäbische Vorgeschichte seiner
Familie und deren u.a deutschsprachigen, aber eben nicht nur
deutschsprachigen Ausdrucksweise mitschwingt, eine erste ansprechende
Sitzmöglichkeit im Freien: Ein Türke sitzt auf einem Stein, seine
geschwungene Türkenpfeife in der Linken, das krumme Türkenschwert in der
Rechten – er wird wohl hergekommen sein, um Wien zu belagern, sagen wir so
um 1683 herum, schon eher friedfertig aussehend, andachtsvoll, ernsthaft
nachsinnend, kräftiger Schnurrbart, die Laute am Rücken ... Moment: Laute?
Sieht ganz so aus wie eine Bandura, ja doch, eine ukrainische Bandura!
Versuchen
wir’s also noch einmal: kein Türke, sondern vielmehr ein ukrainischer
Kosake, höchstwahrscheinlich auf dem Vorderumschlag von Literatur und
Kritik gelandet, besser, aus dem Sattel gestiegen, um Wien von den
Türken "mitzubefreien", wie man ja schließlich auch dem Gedenkstein zu
seiner Linken entnehmen darf (soweit man rückwärts lesen kann
– denn das Bild mit dem Kosaken ist ein
Spiegelbild, wie denn auch die darin codierte Geschichte bestimmt eine
Spiegelgeschichte ist). Dass sein unsichtbares Pferd ein bisschen abwärts
grast, da der Reiter mal gerade nicht im Sattel sitzt, liegt auf der Hand.
Darüber, dass
man heutzutage beruflich nur noch im Sitzen und durch das Sitzen weiterkommt
("den Sessel an den Hintern geklebt, um ihn beim täglich fünfmaligen
Aufstehen nicht weggeschnappt zu kriegen"), gibt Peter Steiners Beitrag "Die
Niederschrift" Aufschluss, in dem es um das Phänomen der Vorläufigkeit im
Gegenspiel zwischen Theorie und (absterbender) Praxis geht – und um die
guten alten Zeiten, in denen ein Gedanke noch die Muße hatte, zu reifen,
bevor derjenige, der ihn hegte, vermittels allerschnellster Veröffentlichung
Anspruch auf ihn erheben musste, um im Nahkampf mit seinen Kollegen, den
anderen "Veröffentlichern", nicht den Kürzeren zu ziehen. Dass die
eigentliche Arbeit vor der Niederschrift erfolgen sollte, ist bei Steiner
eine Selbstverständlichkeit.
"Ich kann es
kaum glauben, und doch ist es wahr: meine Arbeit ist fertig! Endlich! Nach
drei Jahren! Welch ein Gefühl, am Ziel seiner Anstrengung zu sein! (...) Die
Arbeit ist, mit großer Befriedigung stelle ich es fest, vollständig und
bereit zur Niederschrift."
"Kleine Prosa":
der Schwerpunkt des Heftes. Über verschiedene "Sitzmöglichkeiten" informiert
Teresa Präauer in Wort und Bild. Die von ihr gezeichneten Stühle leiten das
Dossier ein. Fast will sich einer hinsetzen, um sie auszuprobieren. Und dann
gesellt sich zu jedem Stuhl ein Text in Kurzform; dabei merkt man, wie
Menschen in ihre Rollen schlüpfen können, in ein Ich oder in ein Es.
In
Leopold Federmairs "Teehaus in Kanazawa" sitzt man natürlich auf dem
Fußboden, denn Japan ist immer noch Japan. "To be born again", so Federmairs
zweite, kleine, großartige Prosa im aktuellen Dossier. Ganz am Ende des
Heftes, neben seiner kurzen Vorstellung in der Autoren-Rubrik, sitzt Leopold
Federmair denn schließlich auch für eine Fotoaufnahme (oder steht er?) – ja,
der Otto Müller Verlag stellt hier sein neues Buch vor:
"Die Ufer des Flusses. Verschiedene Prosa". Ein bisschen abseitig, außerhalb
des Bildrahmens, grast wohl sein Pferd. Hinter den Gleisen. Gleich da. Im
Bahnhof Zoo – was irgendwie großartig exotisch klingt:
big in Japan. Aber so ist es eben mit dem Aufbruch bestellt, man kann nie so
genau wissen wohin er führt.
Anmerkungen:
(1)
Evelyne
Polt-Heinzl, "Es
spricht der Herausgeber", in Herbert Ohrlinger und Daniela Strigl
(Hrsg.): Grenzgänge. Der Schriftsteller Karl-Markus Gauß.
Zsolnay, 2010, S. 167.
|
|
