|
Wir leben in einer
sexbesessenen Gesellschaft, gleichzeitig leiden jedoch viele Menschen unter
einer masochistischen Scham, nämlich dann, wenn es um ihren eigenen Körper
geht (1). Eine Psychologie der Scham, wie es unsere
gemeinsame Dissertation "Sexualwissenschaftliche
Untersuchung zu Sexualität, Scham, Nacktheit, Körperbild und Selbstwert von
Jugendlichen im Alter von 15 Jahren bis 20 Jahren"
(2) darstellt, ist daher – in
Anbetracht der gesellschaftlichen Unehrlichkeit um Liebe, Körper, Nacktheit
und Sexualität – sehr wichtig, denn Menschen erkranken vielfach an einer
Überfülle von Schamgefühlen, zum Beispiel an Depression.
Der gesellschaftlich
führende Umgang mit Nacktheit und Sexualität produziert in unserer
westlichen Kultur – nicht nur bei Jugendlichen
–
massenhaft Scham. Die pornographischen, aber auch medialen Standards durch
die unzähligen Angebote in Werbungen, im Internet etc. Bezug nehmend auf
nackte Körper beiderlei Geschlechts lassen beim Großteil Gefühle von
Beschämung zurück. Grund dafür ist die Empfindung von Mangelhaftigkeit. Immer
mehr Teenager leiden an einer massiven Körperbildstörung (wie zum Beispiel
an Anorexia nervosa).
Das Schamgefühl ist
anthropologisch als universell anzusehen, es ist nicht ein
Resultat von bestimmten Epochen. Wie Menschen beschämt werden – hier
sei an den kommerziellen Kult des perfekten body erinnert, ist
historisch relativ als auch geschlechtsspezifisch. Die Geschlechterunterscheidung zum
Schamverhalten zeichnet sich deutlich in unserer empirischen Untersuchung
ab. Eine unserer Thesen lautete: Körperbild und
Körperempfinden stehen in direktem Zusammenhang mit Scham. Wir befragten 523
BerufsschülerInnen aus Kärnten, davon waren 318 Jungen und 205 Mädchen.
Anhand unserer empirischen Auswertungen von drei Fragebögen (HFS, FBeK und
TSST) (3) pro Person bestätigte sich die These. Bei
den befragten männlichen Jugendlichen herrschen Minderwertigkeitsgefühle
vor, die sich
primär auf deren Penis (Ausschauen wie Größe, Dicke, etc.) beziehen. Diese
werden von uns als geschlechtsbedingte Scham bezeichnet. Für die
befragten Mädchen führt die Scham, bezogen auf ihren ganzen Körper (wobei
das weibliche Genital hier eine untergeordnete Rolle einnimmt), zu
einem starken
Gefühl von Minderwertigkeit. Das führen wir auf
geschlechtsspezifische Sozialisierung zurück. Die befragten Jugendlichen
gehen mit ihren Körpern überaus selbstkritisch um. Sie vergleichen ihre
Körper ständig mit dem in unserer Gesellschaft
geltenden Idealbild. Dieses künstlich generierte
Ideal ist jedoch nicht zu erreichen. Insgesamt haben die weiblichen
ProbandInnen eine höhere Schamschwelle, was auch mit einem niedrigeren
Selbstwert einhergeht.
Scham ist ubiquitär.
Selbst mit Angeboten wie "Die Scham ist vorbei" kann
eine solche sich nicht überspielen lassen. Die Scham ist nach Hegel
"eine Wirkung der Liebe" und "…
dieses Zürnen der Liebe über die Individualität ist die Scham"
(4).
Die Scham wirft den liebenden Menschen ob seiner Unvollständigkeit auf sich
selbst zurück. Minderwertigkeit bezogen auf Körpergröße (Brustumfang, Penis-
sowie Scheidengröße), Hautfarbe, Adipositas
etc. können Ansatzpunkte für das Gefühl sein, dem gegenwärtigen oder
vorgestellten Liebesobjekt nicht auszureichen. Damit in Zusammenhang steht
der Handlungsimpuls, der zur Scham dazugehört, entweder sich selbst oder
Teile von sich selbst zu verbergen. Destruktive Folgen von starker Scham,
wie etwa Wut und Zorn, können Amokläufe
sein. Scham kann zu psychischen Krankheitsbildern führen wie zum
Beispiel Dysthymie (vormals neurotische Depression) und
Persönlichkeitsstörungen.
Auf unsere Frage
"Meinen Sie, dass gehemmte/unterdrückte Sexualität
(in welcher Form auch immer) krank machen kann?" (TSST) ging hervor, dass
weit über die Hälfte der befragten Lehrlinge der Meinung sind, dass dies
möglicherweise krank machen kann.
Wie lässt sich Scham
demnach transzendieren? Hierzu entwickelten wir ein
"Schammodell":
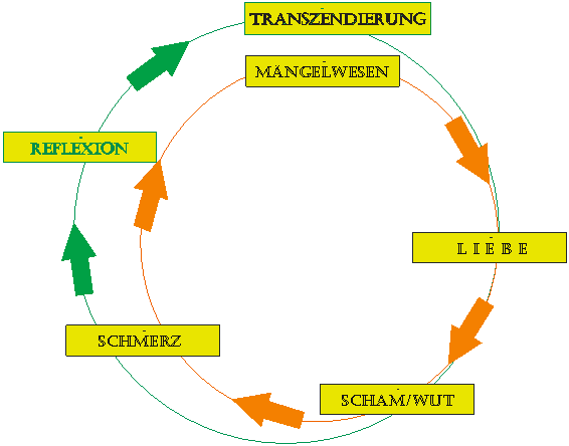
Das
Modell besagt folgendes: Psychoanalytisch betrachtet geht es um die
Überwindung einer narzisstischen Kränkung. Wird die Annäherung zwischen zwei
Menschen im Namen der Liebe durch die Abweisung eines Individuums
verhindert, führt das unmittelbar in seinem Widerpart zu Scham und Wut.
Diese unmittelbare Haltung gilt es zu überwinden, um dadurch die Sicht
darauf zu ermöglichen, dass diese schmerzliche Ablehnung in der
unwiderlegbaren Individualität des anderen begründet liegt und in diesem
Sinne akzeptiert und respektiert werden muss. Gelingt dieser Schritt, so hat
man/frau auch unmittelbaren Zugang zum Gegenüber als ganzen Menschen
gewonnen, und seine Abweisung wird zu einer Bestätigung der eigenen
Menschlichkeit. Am Ende dieses Prozesses stehen zwei gleichwertige
Individuen, denen es möglich ist, vernünftig und unmittelbar
miteinander zu kommunizieren und dabei der Forderung der Aufklärung
nachzukommen, das Gegenüber nie nur als Mittel für die eigenen Zwecke zu
betrachten. Narzissmustheoretisch stellt der Humor eine der wenigen Chancen
dar, aus den Schwierigkeiten der Kränkung herauszukommen.
In einer von uns
dargestellten Clusteranalyse (Suchmethode) nach der Wart-Methode, wurde
versucht Gemeinsamkeiten der zwei Testinstrumente (FBeK und HFS) zu finden.
Die fünf Cluster wurden
wie folgt dargestellt:
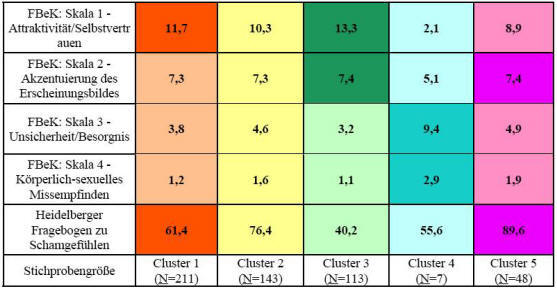
Cluster 1: "Die
Selbstbewussten"
Sie
bilden die größte Gruppe, die sich selbst als durchschnittlich attraktiv
bezeichnen und ein gesundes Selbstvertrauen aufweisen.
Cluster 2: "Die
Durchschnittstypen"
Diese
weisen in keiner der vier Skalen des FBeK Auffälligkeiten auf.
Allerdings kämpfen sie mit ihren Schamgefühlen, da sie sich ständig mit den
imaginären Idealbildern messen müssen.
Cluster 3: "Die
Egoisten bzw. die Ichbezogenen"
Sie
haben kaum eine Unsicherheit, eine Besorgnis sowie ein körperlich-sexuelles
Missempfinden in Bezug auf ihren Körper. Sie haben ein hohes
Selbstwertgefühl und sind jene Gruppe, die es scheinbar geschafft hat, dem
vorgestellten Schönheitsideal am nächsten zu kommen, was mit einem geringen
Schamverhalten zusammenhängt.
Cluster 4: "Die
Opfer"
Diese
bildet vergleichsweise eine relativ kleine Gruppe mit 7 Personen,
wobei 5 Probandinnen im Fragebogen TSST auf die Frage "Sind
Sie in Ihrer Kindheit zu sexuellen Handlungen angehalten worden?" mit
"ja" antworteten. Dies kommt mit einer relativ großen
Unsicherheit und einer Besorgnis sowie mit einem körperlichen-sexuellen
Missempfinden zum Ausdruck. Diese Gruppe dominieren Mädchen.
Cluster 5: "Die
Schamhaften"
Diese Gruppe setzt sich
vorwiegend aus den befragten weiblichen Jugendlichen zusammen. Sie besitzen
einen gesunden Egoismus, der eine außerordentliche Gewichtung des
Erscheinungsbildes des eigenen Körpers mit sich bringt.
Zusammenfassend kann
festgehalten werden, dass die Mädchen extrem stark auf Nacktheit reagieren,
die nicht nur auf das weibliche Geschlechtsorgan bezogen ist, hingegen die
Burschen auf die Genitalscham mit höheren Schamrohwerten reagieren. Somit
läuft die weibliche Geschlechtlichkeit und Körperlichkeit Gefahr, durch
Eigen- und Fremdabwehr zu erkranken.
"Geliebt wirst du einzig
dort, wo du schwach dich
zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren." (Adorno)
Anmerkungen
(1)
Odreitz, Klaudia (2002): Nacktheit - ein Menschenrecht, das
erkämpft werden muss? Anmerkungen zu einer durchaus widersprüchlichen
Situation. Dissertation an der Alpen-Adria-Universität 2002,
Klagenfurt
(2)
Odreitz, Klaudia, Obersteiner, Mario (2007):
Sexualwissenschaftliche Untersuchung zu Sexualität, Scham, Nacktheit,
Körperbild und Selbstwert von Jugendlichen im Alter von 15 Jahren bis 20
Jahren, Dissertation an der Alpen-Adria-Universität 2007, Klagenfurt
(3)
HFS = Heidelberger Fragebogen zu Schamgefühlen, FBeK = Fragebogen
zur Beurteilung des eigenen Körpers, TSST = Abgewandelter Fragebogen zur
Sexualität von Odreitz und Obersteiner
(4)
Hegel, G.W.F. (1986): Frühe Schriften, Werke 1, Suhrkamp,
Frankfurt/Main. S. 247
|