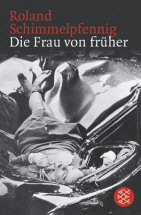Die Eingangsszene der
"Frau von früher" wird leichtfertig verschenkt. Warum? Weil das
Bühnenbild keine Wohnungstür vorsieht. Auf diese scheinbare
Nebensächlichkeit lässt sich die Sache runterbrechen, und es ist das nicht
das einzige Missverständnis in dieser Inszenierung (Regie: Paola Aguilera;
Ausstattung: Martin Käser).
Eine Familie im Aufbruch:
Mutter, Vater und adoleszenter Sohn verlassen nach Jahrzehnten ihre Wohnung.
Im weitläufigen Flur türmen sich die Umzugskartons. Der Flur – ein
symbolischer Ort: Verschiebebahnhof für das Gepäck von Jahrzehnten, Relais
in eine neue Zukunft. Im Bühnenmittelpunkt befindet sich keine vollständige
Wohnungstür, sondern ein Türrahmen mit klar hervorgehobener Türschwelle,
bedeutungsperspektivisch vergrößert wie in gotischen Tafelbildern die
Muttergottes.
Das Stück setzt ein mit
einem Dialog der Eheleute. Die Frau, gerade aus dem Badezimmer gekommen,
meint, Stimmen gehört zu haben. Der Mann verneint: "Es
ist niemand hier." Das ist der Moment der Lüge. Der Text sieht hier vor,
dass die Frau die Wohnungstür öffnet. Und wie vom Schlag getroffen, gewahrt
sie wie auch der Zuseher: Eine Frau steht in der Tür: die Frau von früher,
eine Jugendbekannte ihres Mannes.
Dieses Überraschungsmoment
entfällt bei der Schauspielhaus-Produktion. Aufgrund des Fehlens einer
Wohnungstür sieht man die Frau noch ehe die Figuren sie herankommen
sehen. Damit wird jene schockhafte Erkenntnis verunmöglicht, die
Schimmelpfennig mit seiner nicht chronologischen Stückstruktur intendiert
und den Zuseher unmittelbar durchleben lässt: Das, was wahr und gewiss
scheint, muss nicht wahr sein; Sicherheit kann von einem Moment auf den
anderen in Unsicherheit umschlagen – auch nach zwanzig Jahren Ehe.
Durch
Neukontextualisierung erreicht er, dass Gewissheit als Scheingewissheit oder
Lüge kenntlich wird. Er wiederholt ganze Dialoge, lässt sie früher beginnen
oder später enden, was ein neues Licht auf Bekanntes wirft. Die Zeitsprünge
werden durch eine Off-Stimme zu Gehör gebracht – warum eine Kinderstimme
diese Ansagen übernimmt, erschließt sich nicht wirklich.
Bedauerlich ist der Hang zu
Theatralik und Effekt, vor allem in der zweiten Stückhälfte. Mit viel Licht-
und Tonzauber wird hier ein Grauen gemalt, das in Gestalt der Frau von
früher ins nett arrangierte Eheleben einbricht. Wie viel besser ließe sich
dieses Grauen unter der Halogenlampe eines Chirurgen ausleuchten!
Stattdessen finden Schlüsselszenen hinter den Kulissen statt, wird ins
Dämonische gerückt, was an die unerbittliche, realitätsnahe Sichtbarkeit
gezerrt gehörte.
Auch die Frau von früher,
Romy Vogtländer, die die gefährliche Potenz eines absoluten Liebesideals
verkörpert, wird dämonisiert: Sie erscheint als Domina in Lack und Leder.
Das ist bedauerlich, da so der Umstand, dass der Ehemann ihr allmählich
verfällt, in den Kontext eines Rollenspiels rückt. Derweil stellt
Schimmelpfennig eben nicht Rollenzwänge, sondern die Macht einer Idee und
ihre Folgen aus. Jener Idee, dass Romy und der Mann, nachdem sie sich völlig
aus den Augen verloren hatten, nach 24 Jahren noch immer ein Paar sind.
Nicola Trub als Romy
spielt engagiert die taufrische Ex, die, wie es bisweilen scheint, das
Ausspannen des Mannes vornehmlich als Selbstbestätigungsspiel betreibt. Das
Obsessive der Rolle, die medeahaften Züge brachte Christiane von Poelnitz in
ihrer Rollengestaltung bei der Uraufführung des Stückes 2004 im Burgtheater
wesentlich eindrucksvoller zur Erscheinung.
Die überzeugendste
schauspielerische Leistung des Abends erbrachte Ulrike Arp. Sie gibt die
starke Ehefrau an der Seite eines schwachen Mannes (farbloser als es die
Rolle verlangt: Volker Wahl). Stark auch Christiane Warnecke als Freundin
des gemeinsamen Sohnes (Philip Leenders). Rotzig-frech formen die beiden das
junge Paar, das sich teilweise bereits in den Fußstapfen des älteren Paares
bewegt.
Manches muss sich noch
einspielen, zu ungenau sind bisweilen die wiederholten Szenen. Man vermisst
das Zwingende des Ablaufs, die Zuspitzung auf die Katastrophe. Auch geben
die Schauspieler den kunstvoll verknappten Sätzen mitunter zu wenig Raum zum
Atmen. Das Publikum amüsierte sich bei den burlesken,
ehekriegsartigen Szenen. Die tragische Dimension des Stückes kam zu kurz.
Fazit dieser Inszenierung: Zu grell, zu laut, zu effekthascherisch; aber:
ein sehenswertes Stück allemal!