DAS UNPRÄSENTE PRÄSENS
Die Fische schweigen jedoch nicht. Ebensowenig übrigens die Bäume.
Nicht nur die Sprache von Oleg Jurjew in „von orten“ und „von zeiten“, auch Motive, Form und Umsetzung behaupten ihre Eigenständigkeit, ihr Anderssein, welche zunächst Erstaunen und Verwunderung auslösen. Es handelt sich dabei um zwei Gedichtbände, die Zeit brauchen, um sich ihren Lesern ganz zu öffnen. Die durchaus erfrischende Fremdheit, die eingefahrene Denkmuster untergraben und aufrütteln kann, ist wohl teilweise auch dadurch bedingt, dass Oleg Jurjew sich dafür entschied, diese beiden Poeme auf Deutsch zu schreiben und nicht in seiner Muttersprache Russisch. Dem Dichter, dem mehrere Sprachen zur Verfügung stehen, ist zugleich die Möglichkeit gegeben, zwischen den Sprachen hindurch zu schreiben. Und darin ist Oleg Jurjew ein großer Meister.
Erschienen sind beide Gedichtbände in der „reihe staben“ des gutleut verlages. „von orten“ erschien 2015 neu durchgesehen vom Autor in zweiter Auflage. Der gutleut verlag macht Bücher, die so schön sind, dass man beinahe aufs Lesen vergessen könnte, dabei ist ihr Inhalt ebenso besonders, wie ihr Erscheinungsbild. Die beiden Gedichtbände „von zeiten. ein poem“ und „von orten. ein poem“ von Oleg Jurjew gehören zueinander, ergänzen sich und schreiben sich ineinander fort. „von orten“ ist der frühere Gedichtband, von 2006-2009 geschrieben, „von zeiten“ im Anschluss daran von 2010-2015. Beide Gedichtbände gehören zu einem Ganzen und sind dabei doch eigenständig. Querverbindungen lassen sich anhand einzelner Motive ziehen, beispielsweise taucht der unsichtbare Holunder sowohl in „von orten“ auf:
MITTE MAI, MAINUFER, VIER UHR NACHMITTAGS. DER UNSICHTBARE
HOLUNDER[…] Sämtliche Wohlgerüche, überwiegend von Fladerbäumen, Fliederbäumen, Faulbäumen und Falschen Akazien, haben sich mit einem anderen Geruch
vermischt, und im Ergebnis roch es nach Pisse – nur: nach Katzenpisse oder
nach Engelspisse? So muß der Holunder riechen, aber gerade vom Holunder
ließ sich nichts blicken. […]..als auch später in „von zeiten“, in denen ebenfalls der unsichtbare Holunder zu riechen ist:
[…] Gehst du nach draußen, läufst du schwankend unter den Linden, in
ihrem unverwandt-süßen Duft, unter ihrem anströmenden und abklingenden
Rauschen, und plötzlich: der unsichtbare Holunder, so quälend-
unwohlriechend, daß es beinahe schon wieder wonnig ist. […]
Beide Poeme sind in durchnummerierte „Gesänge“ unterteilt, wobei in „von zeiten“ auch noch zusätzliche Untertitel zu jedem Gesang hinzu kommen. Diese Untertitel befassen sich alle mit Zeitphänomenen:
GESANG ZWEI
DIE ZÄHLBARE UNVOLLSTÄNDIGE ZEIT
Damit wird „Zeit“ als roter Faden wesentlich sichtbarer, als das zuvor bei „Orten“ in „von orten“ der Fall gewesen war.
Die jeweiligen Titel der einzelnen Gedichte sind in „von zeiten“ tendenziell reduzierter, lauten schlicht ES WIRD REGEN GEBEN oder DER TOD IST EIN BAHNHOF. Ganz anders liest sich da im Vergleich dazu einer der Titel aus „von orten“:
NEUES AUS DER BAUMKUNDE, DIE SCHILLERHÖHE OBERHALB VON STUTTGART, EINSTMALS HERZOGSPARK, HEUTE WILDWUCHS MIT NUMERIERTEN BAUMSTÄMMEN UND BIOLOGISCHEM WILDBRUCH. ANSCHEINEND MITTE MÄRZ
Bücher vom gutleut verlag haben alle eine äußerliche Besonderheit: der Einband lässt sich abnehmen und auffalten und darin finden Neugierige Zusatzinformationen. Bei Oleg Jurjew ist das unter anderem ein Interviewauszug. Im aufgefalteten Cover „von orten“ spricht Oleg Jurjew über das Resultat kleiner Gedichte und großer Romane:
„Aber allgemein gesprochen denke ich, daß das Resultat eines kleinen Gedichts gleich dem Resultat eines großen Romans ist (wenn sowohl das eine als auch das andere gelungen ist, versteht sich) – und dieses Resultat ist: die Stille, die aus dem Text aufsteigt. Eine Stille, in der es keine Zeit gibt.“
An diesem letzten Satz bleibt man gerade dann hängen, wenn man zugleich auch den Folgeband „von zeiten“ in Händen hält. Möchte Oleg Jurjew Gedichte über Zeit schreiben, damit diese dann in der aus ihnen aufsteigenden Stille ihr zentrales Thema, Zeit, verlieren?
Warum der erste Band „von orten“ als Titel trägt und Oleg Jurjew von Orten ausgeht, erfährt man ebenfalls an dieser Stelle. Er meint dazu:
„Ich bin eigentlich überzeugt, daß jedes Gedicht – ob es nun eine Angabe des Handlungsortes enthält oder nicht – irgendwo passieren muß. Gedichte, die nirgendwo passieren, sind im Grunde keine Gedichte, sondern bloß – Worte. […] Man kann es auch so sagen: Ich schreibe Gedichte, um herauszufinden, wo sie passieren.“
Im aufgeklappten Cover „von zeiten“ spricht Oleg Jurjew nicht allgemein über die Bedeutung von Zeit für (seine) Gedichte, sondern über zwei zeitliche Zäsuren oder Grenzen in seinem Schreiben:
„Ich kenne in meinem Schreiben von Gedichten zwei Grenzen sehr gut. Eine zwischen dem Jahr 1980 und dem Jahr 1981, seit dem ich richtige Gedichte schreibe. […] Und die zweite Grenze waren einige Jahre Ende der neunziger Jahre, als ich fast aufgehört hatte, Gedichte zu schreiben.“
Aber falten wir die Cover wieder zusammen, wickeln sie um die Bücher und schlagen wir das erste Gedicht auf. Der Gedichtband „von zeiten“ beginnt gleich mit einem Blick in die Zukunft, einer überaus apokalyptischen Wettervorhersage:
Der Sommer wird klirrend-klar sein.
[...]
Ende Juni werden die Vögel fortziehen, in der dritten Juliwoche die Igel
einschlafen. In unseren Mänteln aus Maulwurfpelz werden wir laufen die
dummen blühenden Pflanzen entlang, die nicht zu unterscheiden wissen
zwischen Wärme und Licht. [...]
Es folgt eine weitere Wettervorhersage, diesmal scheinen sintflutartige Regenfälle erwartet zu werden. Wobei das Gedicht dann mit dem folgenden Satz endet:
Es wird aber keinen weiteren Regen geben ...
...und damit seinem eigenen Titel widerspricht, der noch sehr zuversichtlich das genaue Gegenteil versprochen hatte:
ES WIRD REGEN GEBEN
Die darauf folgenden Poeme behandeln ein anderes, mit Zeitlichkeit eng verknüpftes, Thema: Vergänglichkeit. Dabei wird der Frage des Danach unernst ernst der Boden unter den Füßen entzogen:
Nachdem ich gestorben bin, werde ich zu deinem Hund, wahrscheinlich,
zu einer französischen Bulldogge auf kurzen krummen Beinen [...]
Der zentrale Übergangsort zwischen Leben und Tod, der auch in vielen weiteren Gedichten immer wieder aufgegriffen wird, ist dabei der Bahnhof:
Wenn überhaupt sterben, dann doch am liebsten am Witebsk-Bahnhof in
Petersburg – dem schönsten aller Bahnhöfe dieser Welt! [...]
Wobei der Tod selbst zum Bahnhof wird, wie es an anderer Stelle heißt:
Der Tod ist ein Bahnhof, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut
wurden: mit einer Kuppel, aus gußeisernen Lilien zusammengeflochten. [...]
Hinterfragt wird nicht mehr oder weniger, als die Endgültigkeit und Eindeutigkeit des Todes. So kann man vom Bahnhof Pawlowsk, „dem schönsten Bahnhof der anderen Welt“, wenn man den letzten Zug vor dem Dunkelwerden nicht verpasst, auch wieder einfach zurück nach Petersburg fahren. In einem anderen Gedicht trifft man auf Tote, denen man ungeachtet der Tatsache, dass sie nicht mehr leben, dennoch immer wieder begegnen kann: Natalja Gorbanewskaja in Paris, Boris Ponisowsky in Petersburg, Sergej Wolf, Jelena Schwarz, vielleicht auch dem seligen Großvater. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Autor, oder vielleicht doch nur das Ich im Gedicht, unterwegs auch sich selbst begegnet:
[...]Und zurück in Frankfurt, im Flughafen schon, treffe ich auf jenen schmal-
äugigen, dickwangigen, geduckten Kerl in einer grauen Mütze, mit einem
Bärtchen von ungewisser Farbe und nach unten abgeflossenem Bauch –
auf mich?
Damit endet das erste Kapitel, GESANG EINS, und bildet eine thematische Ouvertüre zum Gedichtband. GESANG ZWEI schlägt daraufhin jedoch ganz andere Töne an und enthält Gedichte, welche eine bisweilen absurde Stereotypisierung vorführen, humorvoll sind, oder sein wollen, wobei politischer Korrektheit nicht immer oberste Priorität zugemessen wird. So zählt ein Gedicht die vier wesentlichen Sorten von Frauen auf, ein anderes die fünf wesentlichen Sorten von Männern:
1 ) intelligente, ernsthafte und begabte Amerikaner, die an denkendes
Gemüse erinnern;
2) französische Professoren, die wie erfolglose Kommunalpolitiker
ausschauen, und deutsche Kommunalpolitiker, die das Äußere von
erfolglosen Professoren haben;
3) Moskauer revolutionäre Poeten, die unschönen jüdischen Mädchen
ähneln;
[…]
Stereotypisierungen wie diese machen es mir schwer, weiter zu lesen. Aber da Oleg Jurjew ein Autor ist, bei dem ich davon ausgehe, dass er das was und wie er es schreibt, nie unhinterfragt tut, nehme ich an, dass diese Stelle nicht so platt und diskriminierend gemeint ist, wie sie erscheint, wenn man sie für sich isoliert heraus nimmt. Vermutlich ist es schlicht harmlos humorvoll gemeint, wobei ich so etwas absolut nicht zum Lachen und eher erschreckend finde. Dies ist mein schwerwiegender Kritikpunkt am Gedichtband, was sehr schade ist, gerade weil die beiden Gedichtbände abgesehen davon so besonders und eigen sind.
Besonders und eigen sind die Gedichte auch deswegen, weil Oleg Jurjew das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen und das Gewöhnliche ungewöhnlich sieht:
Weingärten sind die perfidesten Labyrinthe: Kaum Biegungen und
Blind-Enden, lediglich falsche Ein- und Ausgänge haben sie, aus welchem
Grund es nahezu unmöglich ist, in das Zentrum des Labyrinths zu gelangen.
Und wenn zufällig doch, dann ist es völlig unmöglich, zurückzukehren,
zumindest nicht, wie du vorher warst. [...]
Überaus aufmerksam richtet Oleg Jurjew seinen Blick auf alles ihn Umgebende und entdeckt kleine Details, die aus Banalem zauberhaft Märchenhaftes werden lassen:
In Neustadt an der Weinstraße gibt es am Bahnhof, an einem der
Bahnsteige, etwas weiter westlich auch schon Perrons genannt, eine Uhr,
die, in der Glaswand des Wartehäuschens gespiegelt, rückwärts läuft.Wer diese Uhr sieht, wird jünger.
Ich stieg dort um und wurde genau 16 Minuten jünger. [...]
Märchenhaftes kann dabei aber auch gänzlich abgekoppelt von einer „realen Wirklichkeit“ für sich alleine stehen:
ES GIBT EINE STADT,
so klein wie die Nasenwurzel eines Vogels – über dem flachen Schnabel
des Flusses, unter der gewölbten Stirn des Meeres. [...]
Wie schon der Titel „von zeiten“ ankündigt, sind Zeit und Zeitlichkeit das zentrale Thema des Gedichtbandes:
[…] Früh wird’s spät.
Geht es um Zeit, spielt Vergänglichkeit, und damit verbunden Religion, ebenfalls eine wichtige Rolle. Wobei „Religion“ ebenso wie „Gott“ eher vergeblich in verschiedenen Kirchen gesucht wird:
TAMPERE, OKTOBER 2014, WIR HABEN DIE KIRCHE ST. JOHANN
BETRETEN, GOTT GAB ES DORT NICHT,Menschen aber ebenfalls keine – eine absolute Leere. [...]
Stattdessen ist jedoch anderes in Kirchenräumen zu finden:
KÄRNTEN, NOVEMBER 2014, IN DER KIRCHE DES DORFES MARIA
SAAL ISTdie Spur eines Teufelshufs auf dem Boden zu bewundern (bei der Verfolgung
eines Lokalfausts trat der Satan über die Kirchenschwelle und verbrühte
sich einen Fuß; der Huf ist nicht groß). […]
Fixpoetry 2016
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

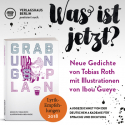
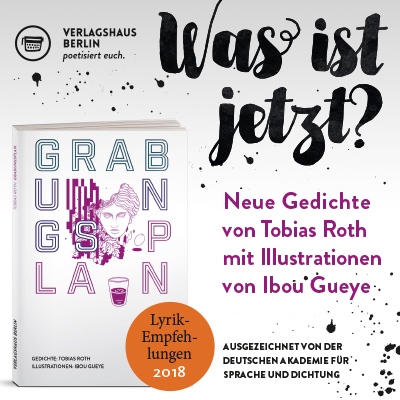
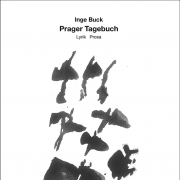
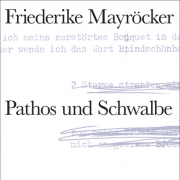
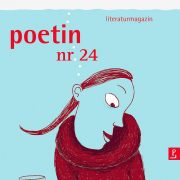

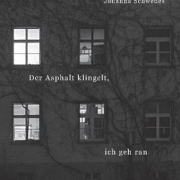
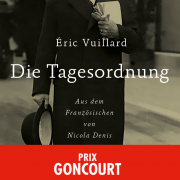
Neuen Kommentar schreiben