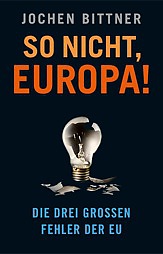|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Jazz aus der Tube Bücher, CDs, DVDs & Links Schiffsmeldungen & Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Tonträger, SF & Fantasy, Autoren Verlage Glanz & Elend empfiehlt: 20 Bücher mit Qualitätsgarantie Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Berserker und Verschwender Berserker und VerschwenderHonoré de Balzac Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Europa:
eine
Institution sui generis Wenn man ein Buch über Europa aus der Feder eines ZEIT-Redakteurs in der Hand hält, erwartet man ein pro-europäisches Plädoyer. Mindestens. Mindestens ein Bekenntnis wie das von Bernd Ulrich, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung, der kurz vor den Europawahlen 2009 über Europa als »Der beste Kontinent der Welt« schrieb. »Nie zuvor ließ es sich in Europa so gut leben, nirgends sonst gibt es so viel Freiheit und Gleichheit.« (DIE ZEIT vom 6. Juli 2009) Europabegeisterung als Programm. Wer eine ähnliche Begeisterung von Jochen Bittner erwartet, wird enttäuscht. Vielleicht ist enttäuscht zu harsch, aber die Europabegeisterung wird doch relativiert. Bittner schreibt nicht über den »besten Kontinent der Welt«, sondern über einen Erdteil im Entstehen, über Brüsseler politische Prozesse, bei dem das eine oder andere schief geht. Im Gegensatz zu den Sympathisanten von außerhalb hat Bittner als Europa- und NATO-Korrespondent der ZEIT Brüssel erlebt, hat den Geruch der Stadt in sich aufgenommen und die europäische Hauptstadt vermessen. Vielleicht bezieht sich Bittner daher lieber auf den Nachsatz von Ulrichs gerade erwähntem Artikel: »Eine Verteidigung der EU gegen ihre Kritiker – und gegen ihre Lobredner.« Schon 2009 musste das Projekt EU verteidigt werden, »die Sinnfrage geklärt und besser erklärt werden«. Heute, 18 Monate nach Ulrichs Artikel, steht die EU in der Tat nicht gut da. Finanzielle Stützhilfen für Griechenland, Finanzregenschirme für Iren, Portugiesen, Spanier etc. haben die Stimmung pro EU nicht verbessert. Im Gegenteil. Hier in Berlin outet man sich als weltfremder Idealist, wenn man noch den Hymnus auf das historische Projekt Europa anstimmt. Vielleicht wurden zu viele dieser Hymnen gesungen, zu oft in die Vergangenheit geschaut und zu wenig in die Zukunft. Oder wie Bittner schreibt: »Ihre Gründungszwecke, Frieden, Wohlstand und Freiheit, sind unstreitig erreicht. Dies stellt, keine Frage, eine einzigartige historische Errungenschaft dar. Wie aber lässt sich ein derart konsolidiertes Projekt noch steigern?« (S.11). anders gefragt: Wie kann man das Paradies noch paradiesischer machen? Vielleicht ist das die Krux der EU. Vielleicht verkommt sie wegen ihres eigenen Erfolges. Große Dinge können nicht mehr geregelt werden, also ergeht man sich im Klein-Klein von Regulierungen. Und während man sich im Klein-Klein verliert, verschwindet das Große aus dem Blickfeld. Während die USA mit Barack Obama den ersten Präsidenten hat, dessen familiären Wurzeln nicht nur in Europa liegen und daher auch schon als erster pazifischer Präsident bezeichnet wird, betreibt die EU europäische Nabelschau. So oder so ähnlich argumentiert auch Bittner, der drei Fehler der EU konkret benennt und durchdekliniert:
Die
EU regelt Kleines zu groß und Großes zu klein. Was meint Bittner unter diesen Punkten konkret? Zunächst einmal gibt es verschiedene Ebenen von Europa. Denn wenn auch alle von Europa sprechen, so meinen sie nicht immer das gleiche. Für die einen ist Europa immer noch die ganz große politische Idee, die Hoffnung, die Vision. Historiker wie ich meinen dieses Europa, wenn sie davon sprechen. Dagegen gibt es schon andere, die sprechen von der operativen Umsetzung dieser Vision. Und da jedes Projekt seine Tücken aufweist, so etwas lernt man beim Projektmanagement, sprechen diese auch ungeniert von den Problemen, Schwierigkeiten und Widersprüchen der EU. Hinter dieser Differenz des Begriffs steht häufig auch eine Generationenfrage. Der ehemalige französische EU-Minister Pierre Moscovici brachte dies einmal folgendermaßen auf den Punkt: »Sie [gemeint sind die Politiker um die Jahrtausendwende] haben nicht den Glauben der Gründer, aber den Realismus der Konstrukteure.« Da dieses Zitat aber auch schon wieder mindestens zehn Jahre alt ist, stellt sich die Frage, welche aktuelle Generation wir im Moment aufweisen. Die der Ultra-Realisten? Der Neo-Nationalisten? Bittner macht eine weitere Ebene auf. Er schreibt: »Tatsächlich changiert die EU permanent zwischen diesen beiden Regierungsformen, zwischen verwalteter Einheit und erkämpfter Einigkeit. Es gibt keinen politischen Begriff für diese Dualität. Die EU ist kein Bundesstaat, denn es fehlt ihr an einer bürgergetragenen Regierung. Sie ist aber auch mehr als ein Staatenbund, weil sie nicht nur durch Diplomatie zusammengehalten wird. Wissenschaftler haben sich mittlerweile einfach darauf geeinigt, die EU als eine Institution sui generis, eigener Art, zu bezeichnen.« (S.25) Wie kann man aber Bürgerinnen und Bürgern Europas die Union erklärt werden, wenn man Wissenschaftler benötigt, die letztlich lediglich mit lateinischen Begriffen die Sonderstellung der EU beschreiben können. Ja, es sind generell zu viele Schlagwörter im europäischen Diskurs zu finden, die es Sympathisanten schwer machen, Gegnern aber leicht. »Finalität«, »Erweiterung UND Vertiefung«, »Subsidaritätsprinzip« sind so Begriffe, bei denen einem rasch die Lust vergeht. Und schließlich gibt es noch die Ebene zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die EU hat Großmachtansprüche à la USA kombiniert mit einem Funktionsprinzip à la UN. Eine Supermacht mit menschlichem Antlitz quasi. Leider agieren die europäischen Staaten oft zu gerne vereinzelt als 27 politische Zwerge. Vor allem im Verhältnis mit Russland, ein Beispiel etwa, mit dem Bittner die Diskrepanz und auch die hohle Rhetorik europäischer Politik beschreibt. Zurecht. Schließlich ist das Thema Energiesicherheit eines der außenpolitischen Topthemen. Aber trotz einer Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik behandeln die Außenminister der europäischen Staaten gerade dieses Thema gerne im engen nationalen Rahmen. Nicht im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger. Bittner reiht ein Beispiel nach dem anderen an, bei dem die EU unter ihren eigenen Möglichkeiten bleibt. Wo sie richtige Fragen stellt, aber keine Antworten gibt. Oder noch die falschen. Was mich ermutigt, ist, dass die EU bereits die richtigen Fragen stellen kann. Auch dies ist keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht sollten wir ein wenig nachsichtiger sein, schließlich geht es auch um Politik, die eigene Regeln und Logiken folgt. Nicht unbedingt nur journalistischen. Zwei kritische Punkte sind angemerkt. Nein, vor allem auch nach der Lektüre dieses Buches, ist die Kritik an der Brüsseler Bürokratie nicht unberechtigt. Ist sie aber neu? In seiner Humboldt-Rede vom 12. Mai 2000, also vor mehr als zehn Jahren, sagte der damalige deutschen Außenminister Joschka Fischer: Der »europäische Einigungsprozess ist gegenwärtig bei vielen Menschen ins Gerede gekommen, er gilt als eine bürokratische Veranstaltung einer seelen- und gesichtslosen Eurokratie in Brüssel und bestenfalls als langweilig, schlimmstenfalls aber als gefährlich.« Mit Bürokratie-Bashing macht man immer noch die sichersten Punkte. Im Grunde ist aber Kritik an Bürokratie eine Kritik an unserer generellen Lebensführung. Wie schrieb schon Max Weber: »Die Bürokratie ist gegenüber anderen geschichtlichen Trägern der modernen rationalen Lebensordnung ausgezeichnet durch ihre weit größere Unentrinnbarkeit.« (Max Weber: Geschichte und Gesellschaft, S.834f.) Bürokratien haben die Tendenz sich auszudehnen, immer mehr Lebensbereiche zu erfassen. Weber konnte dies bereits um die Jahrhundertwende feststellen, um die Jahrtausendwende war dies nicht anders. Schließlich die Kosten der EU. »7,4 Milliarden Euro«, so Bittner, »zahlte die Bundesregierung 2007 in den Brüsseler Haushalt ein. Statistisch kostet die EU-Mitgliedschaft jeden Deutschen also bisher 263 Euro jährlich. Das ist, zum Vergleich, ein Zehntel dessen, was jeder Bürger in den Bundeshaushalt einzahlt (2678 Euro, jeweils brutto, jeweils 2007).« Bittner relativiert also schon einmal. Nur ein Zehntel dessen, was ein Bundesbürger an die Bundesrepublik an Steuern abführt, führt er an die EU ab. So teuer ist das eigentlich nicht. Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es ist saubillig. Was könnte man in Deutschland mit 7,4 Milliarden Euro anfangen? Man könnte damit zum Beispiel die Hypo Real Estate stützen. Denn diese 7,4 Milliarden Euro sind nicht ganz so viel, wie die HRE als direkte Hilfe durch Kapitalmaßnahmen aus dem Finanzmarktstabilisierungsfonds, kurz SoFFin, erhalten hat. Sie erhielt 7,7 Milliarden Euro. Abgesehen von den 124 Milliarden Euro an Garantien, die die Hypo Real Estate beanspruchen kann. Ja, auch solche Dinge leisten wir uns. Nein, die EU ist noch nicht Zeugnis eines perfekten Gesellschaftszeitalters im Sinne eines Auguste Comtes. Und wir werden in Zukunft weitere Bücher wie »So nicht, Europa!« zum Lesen erhalten, wenn nicht das passiert, was Jochen Bittner als »Schubumkehr« bezeichnet. Nämlich, dass sich die EU weniger als Regulator versteht, sondern als Ermöglicher. Wenn, ja wenn, sie die Eigenarten seiner Glieder nicht als Gefahr empfindet, sondern als willkommene Triebkräfte. Wenn Brüssel hilft, die Potentiale der Menschen in der EU zu entfalten, wird die Kritik an Kommission, Rat etc. verstummen. Dann wird die Hoffnung eintreten, die Bernd Ulrich hatte: »Brüssel ist der Ort, von dem man als Europäer nicht abreisen kann, eine in Permanenz tagende Friedensverhandlung, Bestiarium der Verschiedenheiten, Laboratorium des jeweils nächsten Europas, kurzum, etwas, das man sich leisten sollte.«
In diesem Sinne ist Jochen
Bittners Buch ein informatives, interessantes, exzellent unterhaltsam
geschriebenes Buch. Vor allem aber: Es ist ein wichtiges Buch.
|
Jochen Bittner |
||
|
|
||||