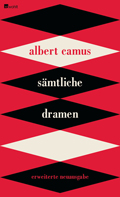|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
© Rowohlt Verlag Artikel online seit 07.11.2013 |
Die Wahrheit des Menschen Zum 100. Geburtstag von Albert Camus
Von Dieter Kaltwasser |
||
|
Als Albert Camus am 7.
November 1913 auf einem Bauernhof in Mondovi in der Nähe von Algier zur Welt
kam, wies nichts darauf hin, dass aus ihm einer der berühmtesten französischen
Schriftsteller werden sollte, der zu seiner Zeit mit Jean Paul Sartre zu
Frankreichs einflussreichsten Intellektuellen zählte. Er wuchs neben einer
stummen Mutter und einer tyrannischen Großmutter, beide waren Analphabetinnen,
in einem ärmlichen Viertel in Belcourt auf, einem Vorort von Algier. Sein Vater,
Lucien Camus, starb am 14. Oktober 1914 in der Marneschlacht an den Folgen einer
Kopfverletzung. Albert und sein Bruder Lucien standen beide als Kriegswaisen
unter staatlicher Fürsorge. Camus schreibt in seinem posthum erschienen Roman:
»Nein, er würde seinen
Vater nie kennen, der dort drüben, das Gesicht für immer in der Asche verloren,
weiterschlafen würde.« Die Armut, in der er
lebte, betrachtete Camus nicht als Übel, wie er in seiner ersten
Veröffentlichung »Licht und Schatten« formuliert:
Jahrzehnte später, im
Juli 1944 schreibt Camus in seinem vierten »Brief an einen deutschen Freund«,
der ein imaginärer Freund war: Er liebte seine Mutter, die das Regiment ihrer tyrannischen Mutter schweigend ertrug: »Sie hatte ein sanftes, ebenmäßiges Gesicht, das schön gewellte Haar der Spanierin, eine gerade kleine Nase, schöne, warmherzige braune Augen.« Sie war für ihn, wie es in seinem posthum erschienen Roman »Der erste Mensch« heißt, »das, was er am meisten liebte, auch wenn er sie hoffnungslos liebte.« Die Familie von Catherine Sintès stammte von Menorca, der nördlichsten Baleareninsel, jedes Jahr musste in Algerien ein Antrag für eine Aufenthaltsgenehmigung gestellt werden, »aber letzten Endes war da nur das Geheimnis der Armut, die Menschen ohne Namen und ohne Vergangenheit hervorbringt«. Durch Fürsprache seines Lehrers Louis Germain, ohne den es wohl den Schriftsteller Camus nicht gäbe, schaffte er den Sprung in die Bildungsinstitutionen einer der führenden Kulturnationen. Ab seinem sechzehnten Lebensjahr arbeitete er in Algier als Hafenangestellter, er wurde krank, im Krankenhaus des Armenviertels stellte man eine Lungentuberkulose fest. Die Ärzte gaben ihn auf, er hatte sein Todesurteil erhalten, dessen Vollstreckung im Ungewissen blieb. Sein Onkel Gustave, ein Metzger und Literaturfreund, nahm ihn in sein Haus auf. Der Fleischer drückte seinem Neffen die Bücher von André Gide in die Hand. In Gides algerischem Hymnus »Früchte der Erde«, für Camus ein »Evangelium der Armut« fand der Algerienfranzose seine Welt wieder, seine frühen Texte sind von Gide beeinflusst. Bei Gide heißt es: »Mach keinen Unterscheid zwischen Gott und deinem Glück und lege all dein Glück in den Augenblick«, bei Camus finden sich die Worte: »Ich lerne, dass es kein übermenschliches Glück gibt und keine Ewigkeit außer dem Hinfließen des Tages.« Später wandte sich Camus von Gide ab, und die Ursache muss wohl darin zu suchen sein, dass er einen neuen Meister gefunden hatte, Jean Grenier, der Lehrer seiner Jugend. Der zwanzigjährige Albert Camus begann sein Studium der Philosophie an der neu eröffneten Universität von Algier, wo er mit dem jungen Professor Jean Grenier Freundschaft schloss, die trotz unterschiedlicher Lebenshaltungen bis zu Camus Tod im Jahr 1960 dauerte. Camus verfasste zu Greniers Jugedwerk »Inseln« ein begeistertes Vorwort und begann unter dem Einfluss dieses Buches mit dem eigenen Schreiben. Grenier wurde, wie Iris Radisch in ihrer Camus-Biographie erklärt, zum Förderer, Ratgeber, Lektor und Lehrer Alberts. Radisch schildert darin auch die Bezüge zwischen Valerys »Inspirations méditerranéennes« und dem »mittelmeerischen Denken« von Camus, die vor allem durch Grenier vermittelt wurden und bis in seine späten Werke wirksam bleiben. Das »mittelmeerische Denken« ist das Schlusskapitel des 1951 erschienenen Essays »Der Mensch in der Revolte«. Dort stellt er eine mediterrane Kultur der Gelassenheit, des Maßes und der Nähe zur Natur vor, die es gegen die lähmende und erstickende Kultur Europas zu bewahren gilt, und die ihre Herkunft aus dem antiken Griechenland nicht verleugnet. Im beginnenden 21. Jahrhundert wird Albert Camus in Giorgio Agamben einen aufmerksamen Leser dieses Essays finden.
In den dreißiger Jahre
(1934) heiratete Camus Simone Hié, doch die Ehe war nicht von Dauer, trat der
kommunistischen Partei bei, aus der er nach drei Jahren ausgeschlossen wurde,
gründete ein Theater, in dem seine ersten Stücke aufgeführt wurden, absolvierte
sein Studium mit einer Diplomarbeit über die nordafrikanischen Philosophen
Plotin und Augustinus, wurde Mitarbeiter einer algerischen Zeitung, arbeitete an
seinen Roman »Der glückliche Tod«, und veröffentlichte seine Erstlingsswerke
»Licht und Schatten« und »Die Hochzeit des Lichts«. Der Werkzyklus des Absurden begründete den Weltruhm des französischen Schriftstellers. Ein Meister des Absurden und engagierter Denker der Revolte wurde er genannt, 1957 erhielt er den Nobelpreis. Das Absurde besteht für Camus in der Spannung zwischen der Sinnwidrigkeit der Welt und der Sehnsucht des Menschen nach einem Sinn oder sinnvollem Handeln. Der Mensch versuche, so Camus, sich durch einen irrationalen »Sprung« in eine metaphysische oder quasimetaphysische Heilsgewissheit vom Absurden zu befreien. Im »Mythos des Sisyphos« heißt es: »Wenn es das Absurde gibt, dann nur im Universum des Menschen. Sobald dieser Begriff sich in ein Sprungbrett zur Ewigkeit verwandelt, ist er nicht mehr mit der menschlichen Hellsichtigkeit verbunden. Dann ist das Absurde nicht mehr die Evidenz, die der Mensch feststellt, ohne in sie einzuwilligen. Der Kampf ist dann vermieden. Der Mensch integriert das Absurde und läßt damit sein eigentliches Wesen verschwinden, das Gegensatz, Zerrissenheit und Entzweiung ist. Dieser Sprung ist ein Ausweichen.« In der Revolte gegen das Absurde, als Reaktion auf die zuerst erkannte und dann angenommene Absurdität, kann sich der »absurde Mensch« selbst verwirklichen und zur Freiheit finden. Dem eigentlichen Grund der Absurdität, dem Tod, kann er nicht entfliehen: »Was bleibt, ist ein Schicksal, bei dem allein das Ende fatal ist. Abgesehen von dieser einzigen fatalen Unabwendbarkeit des Todes ist alles, sei es Freude oder Glück, nichts als Freiheit. Es bleibt eine Welt, in der der Mensch der einzige Herr ist.« In der Mythologie der Griechen hatte Albert Camus mit Sisyphos eine Figur gefunden, deren Handeln prima vista nur als völlig sinnlos bezeichnet werden kann und dennoch umzuschlagen vermag in Selbstverwirklichung und Glück. Am Ende seiner großen philosophischen Erzählung schreibt Camus: »Darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache. [...] Der absurde Mensch sagt ja, und seine Anstrengung hört nicht mehr auf. Wenn es ein persönliches Geschick gibt, dann gibt es kein übergeordnetes Schicksal oder zumindest nur eines, das er unheilvoll und verachtenswert findet. Darüber hinaus weiß er sich als Herr seiner Tage. In diesem besonderen Augenblick, in dem der Mensch sich seinem Leben zuwendet, betrachtet Sisyphos, der zu seinem Stein zurückkehrt, die Reihe unzusammenhängender Handlungen, die sein Schicksal werden, als von ihm geschaffen, vereint unter dem Blick seiner Erinnerung und bald besiegelt durch den Tod. Derart überzeugt vom ganz und gar menschlichen Ursprung alles Menschlichen, ein Blinder, der sehen möchte und weiß, daß die Nacht kein Ende hat, ist er immer unterwegs. Noch rollt der Stein. […] Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jeder Gran dieses Steins, jedes mineralische Aufblitzen in diesem in Nacht gehüllten Berg ist eine Welt für sich. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.« Im November 1958 kaufte sich Camus, dank des ein Jahr zuvor erhaltenen Nobelpreises, ein Haus in Lourmarin im Departement Vaucluse, zwischen Avignon und Aix-en-Provence gelegen. Es war einsam geworden um ihn, die »Mandarins von Paris« hielten auf Abstand zu ihm. In der Werkbiographie »Albert Camus - Die Freiheit leben« beschreibt Martin Meyer, dass Camus in der Zeit der Nobelpreisverleihung unter starken Depressionen, Schreibhemmungen, Erstickungsanfällen, die von Panik und Ängsten begleitet waren, litt. Das Tagebuch, das Camus zu dieser Zeit im Jahre 1957 führte, enthalte nur sieben Notate, »keines spiegelt die Ereignisse in Schweden«. Nach seinem Unfalltod am 4. Januar 1960 bekannte sich selbst der einst im Streit mit ihm lebende Jean-Paul Sartre wieder zu ihm, als er erklärte, Camus stelle für das 20. Jahrhundert den »wahren Erben jener langen Ahnenreihe von Moralisten dar, deren Werke vielleicht das Echteste und Ursprünglichste an der ganzen französischen Literatur sind«. Albert Camus fand auf dem Friedhof von Lourmarin seine letzte Ruhe. |
Neue Übersetzung:
Martin Meyer
Michel Onfray |
||
|
|
|||