|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 02.03.13 |
|
||
|
Um 1960 entstand in Europa eine Kunstrichtung, der Neue Realismus. Künstlern wie Jean Tinguely, Yves Klein und Daniel Spoerri ging es um eine neue Annäherung der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit an das Reale, um neue Zugänge zur Realität. Ihre Kunst war die Antwort auf den abstrakten Expressionismus von Jackson Pollock und Willem de Kooning. Geistiger Mentor der Bewegung war Pierre Restagny, der für die Manifeste der Neuen Realisten verantwortlich zeichnete. Im zweiten Manifest der Bewegung behauptete er in Anspielung auf Hans Arps »Opus Null«, der Mensch ordne sich bei 40 Grad über dem Nullpunkt-Dada ins Reale ein. Das Manifest wollte die metaphysischen Überbleibsel der Kunst, die Ikonen der universellen Harmonie zu Fall bringen und die Sackgasse des ästhetischen Subjektivismus durchbrechen. Die Neuen Realisten betätigten sich in der Folge als Plakatabreißer, schufen durch Yves Klein lebende Pinsel, sammelten Unrat und produzierten so genannte Fallenbilder: Alltagsgegenstände, die mit Kunstharz überzogen und an Tischen oder anderen Gegenstände eingefangen wurden. Es waren, wie etwa Spoerris viel zitierte Kofferaktion von 1961 in Köln, Momentaufnahmen der Realität, die dazu beitragen wollten, die gewohnte Weltordnung zu hinterfragen. Nun ist der Bonner Philosoph Markus Gabriel angetreten, den Neuen Realismus ein zweites Mal zu erfinden. In seinem Essay »Warum es die Welt nicht gibt« geht er zwar auf die genannten Künstler nicht ein, will aber ihnen gleich Metaphysik und Konstruktivismus überwinden. Der Name des Programms: Neuer Realismus! Für Gabriel ist »Welt« der Inbegriff metaphysischer Systementwürfe. Die Welt der Metaphysiker beheimatet alles. Es ist die absolute Idee, die nicht gedacht werden kann. Ihr stellt Gabriel unendlich viele so genannte Sinnfelder gegenüber. Sinnfelder sind der je spezifische Kontext, in dem die Dinge erscheinen. Da wir beobachtender Teil der Welt sind, seien wir unfähig, eine Gesamtschau der Welt vorzunehmen, denn dann müsste die Beobachtung extern erfolgen. Da die Welt aber das Ganze ist, scheitert das Unterfangen zwangsläufig: Beides zu denken führt in einen unendlichen Regress. Wir erkennen jedoch, so Gabriel weiter, die Dinge, wie sie an sich sind. Es gibt keine hinter den Dingen liegende Wahrheit. Mit einer Reihe von Trugschlussbeispielen, wie sie in der Philosophie seit Zenon von Elea bekannt sind, bemüht sich Gabriel, zwischen objektivistischen und subjektivistischen Positionen zu vermitteln. Seine Ausführungen sind hierbei stark zugespitzt, hin und wieder holzschnittartig. Einige Theorien werden grob vereinfacht widergegeben. Das macht es Gabriel leichter, sie anschließend als unzureichend zurückzuweisen und für die eigene Sicht auf die Dinge zu werben. Die Nicht-Existenz der (einen) Welt wird ihm zur Voraussetzung, den ganzen Rest zu erklären. Der philosophisch geschulte Leser fragt sich allerdings, an wen sich diese Erklärung eigentlich richtet. Denn das Buch ist zwar eine flott formulierte Einführung in die Philosophie, aber kein philosophischer Essay. Es referiert zahlreiche Allgemeinplätze und ist stellenweise redundant. Ein realistischer Ansatz mag es sein, ein wirklich neuer Realismus ist es nicht. Auch haftet an der Idee von Sinnfeldern ein restmetaphysischer Ballast, und die Frage nach dem eigenen Sinn- und Geltungsanspruch bleibt ungestellt. Im Anschluss an Pierre Restagny ist realistisch festzustellen, dass 40 Grad über dem Nullpunkt der Philosophie auch nur mit Wasser gekocht worden ist. |
Markus Gabriel |
||
|
|
|||
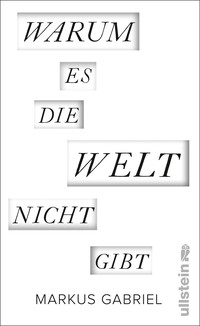 40
Grad über dem Nullpunkt der Philosophie
40
Grad über dem Nullpunkt der Philosophie