|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
|
Kriegsgräuel und Gewaltexzesse, Folter, Schauprozesse, Sklaverei, Sadismus:
|
||
|
Pierre Guyotats »Grabmal für fünfhunderttausend Soldaten« (Tombeau pour cinq cent mille soldats) entstand in den Jahren nach dem Algerienkrieg. Die französische Erstausgabe erschien 1967 bei Gallimard in Paris. Den Hintergrund des Romans bilden Guyotats Erfahrungen im Algerienkrieg. Im Juli 1962 schlossen Frankreich und Algerien den Vertrag von Evian, und Algerien erklärte sich von Frankreich nach acht Jahren blutiger Auseinandersetzungen unabhängig. Der geschichtliche Hintergrund Die französische Kolonisation in dem nordafrikanischen Staat begann bereits 1830. Das militärpolitische Ziel Frankreichs war es, die Piraterie im westlichen Mittelmeer zu bekämpfen und die Sicherheit für die europäische Seefahrt zu verbessern. Die Berber leisteten erbitterten Widerstand gegen die französische Besatzung. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass Frankreich das Land in den folgenden Jahrzehnten unter seine militärische Kontrolle brachte. Ab den 1920er Jahren, besonders ab 1943, wurden die Forderungen nach einem unabhängigen Algerien lauter. 1954 gründete sich die algerische Unabhängigkeitsbewegung FLN. Ihr Mittel zur Befreiung Algeriens war der bewaffnete Kampf. Im November 1954 begann die FLN mit zahlreichen Guerilla-Angriffen auf Kollaborateure, Algerienfranzosen, die französische Polizei, das Militär und algerische Exporteure. Die französische Armee griff ein, der Krieg, der politisch bis in die Gegenwart hineinwirkt, begann. Nach groben Schätzungen starben rund 500.000 Menschen, die französischen Siedler flüchteten aus Nordafrika. Pierre Guyotat wurde im Jahr 1960 in den Krieg nach Algerien einberufen. Dort kam er zwei Jahre später wegen seines Aufrufs zur Desertion und der Verbreitung verbotener Schriften in Haft. Das »Grabmal« gilt als eines der Hauptwerke der französischen Literatur des 20. Jahrhunderts. In Deutschland ist Guyotat hingegen bis heute wenig bekannt. Mit der Veröffentlichung des »Grabmals« sowie seines Werks »Eden Eden Eden« (Diaphanes 2015) wird sich dies schlagartig ändern. Das Buch Worum geht es? Die Szenen des Buches, eingeteilt in sieben Kapitel (Gesänge), kreisen allesamt um kriegerische Auseinandersetzungen in Nordafrika (reale mazedonische und persische Städtenamen sind in der Geschichte geografisch nicht eindeutig zuzuordnen). Es sind allesamt apokalyptische Handlungsorte: Kriegsgräuel und Gewaltexzesse sind an der Tagesordnung. Guyotat beschreibt minutiös Exekutionen, Kreuzigungen, Kannibalismus und die alltägliche Barbarei in den Straßen der Städte. Da sind die Schauprozesse, die Sklaverei, der Sadismus, die Sodomie und die Folter, Vergewaltigungen und das Böse im Menschen: Anekdote, Fiktion und historische Ereignisse vermischen sich zu einem atemlosen Singsang. Es gibt keine stringente Handlung, kaum einen Absatz. Alles geschieht gleichzeitig, alles wiederholt sich, nur Protagonisten und Plätze variieren. Dennoch ist der Bezug zu Algerien nicht nur über die Zahl der Toten im Titel virulent. Auch Begriffe wie Inamenas (Stadt) und Fellagha (Freiheitskämpfer) verweisen auf das nordafrikanische Land. Algerien war weder nur eine Kolonie noch bloß die Fortsetzung der französischen Republik auf der anderen Seite des Mittelmeeres. In den acht Jahren des Krieges war Algerien vielmehr ein Synonym für den Ausnahmezustand schlechthin. Schon Pierre Bourdieu hat sehr detailliert den von Gewalt geprägten, raschen Wandel der algerischen Welt sowie den Kampf der Kulturen in diesen Jahren beschrieben. Seine »Algerischen Skizzen« analysieren die Zerstörung der Hierarchien und der kulturellen Regeln des Landes. Der Zerfall der Ehrbegriffe »im Kontakt mit den Grausamkeiten des Krieges« ist überall greifbar: »Der Krieg räumt, gleich einer Höllenmaschine (machine infernale), vollständig mit den soziologischen Wirklichkeiten auf«, schreibt Bourdieu. Guyotats Roman erinnert an diese Höllenmaschine und ihre Opfer. Er zitiert die Wunden, die Narben, die Knochen, das Blut. Ein Grabmal voller Schweiß, Tränen und Erbrochenem; ein Ort geplatzter Schädel, erigierter Glieder; ein Ort der Exkremente und Fleischfetzen, ein Denkmal für die Einsamkeit, den Ekel, die Verletzungen, das Grauen der Schlacht, die Kälte. Ein Beispiel: »Eine Ratte durchwühlt Kiefer und Backen, die Augen blicken auf, die Ohren wackeln; die alte Frau drückt mit flachen Händen gegen die Schläfen; das Zahnfleisch des Jungen, seine Zunge, die Mundhöhle und der hintere Gaumen sind zerrissen, ein Loch voll Blut hinter geschlossenen Zähnen, in diesem Bad aus Blut und Zahnschmelz dreht sich die Ratte um; die alte Frau stopft ein Stück Teerplane in den Mund, die Ratte, in den Brustkorb hineingedrückt bis zu den Nieren, beißt an der Plane und zieht daran; dann dreht sie sich erneut um, kriecht durch die Brust, gräbt zwischen den Lungen; die alte Frau richtet sich wieder auf, sammelt einen Stock aus dem Schlamm auf, um den Stacheldraht gewickelt ist: Sie schlägt damit auf die Brust des Jungen, die Ratte kriecht unter die Lungenflügel, hebt diese an; mit einem Zischen zerreißt das Fleisch.« Was soll das? Gebrochene Kiefer, durchlöcherte Herzen, freigelegte Eingeweide, brennende und verstümmelte Kinder, ein einziges, über 600 Seiten langes Gemetzel: Überall ist Perversion, überall lauert der Tod. Keiner entkommt. Daran ändert auch das quasireligiöse Finish nichts. Oder doch? Die insgesamt sieben »Gesänge« des Romans sind alles andere als leichte Kost, die Schilderungen des Krieges bewegen sich an der Grenze des Erträglichen. Dabei ist Guyotats Text nur der literarische Rekurs auf die Geschehnisse in Algerien zwischen 1954 und 1962. Der Roman lässt vage erahnen, um wieviel grausamer die Kriegsrealität ist.
Doch das Buch ist nicht
bloß ein Erfahrungsbericht. Insgesamt wirft Guyotat die Frage auf, ob
moralisches Handeln im Angesicht der Bestialität des Krieges überhaupt möglich
ist. Zugegeben: Stellenweise ist das »Grabmal« unglaublich ekelerregend. Nicht
nur die Brutalität der Soldaten schockiert. Auch die Seiten, an mythologische
Erzählungen erinnernd, mit inzestuösen und sodomistischen Szenen sind degoutant:
Sexualität als Zwangshandlung. Aber Guyotat hat mit Tombeau pour cinq mille
soldats zweifellos ein unfassbares, schauerlich schönes Buch verfasst. Es
ist eine extrem schonungslose Gewaltreflexion wie man sie in der deutschen
Kriegs- und Nachkriegsliteratur nirgends findet. Holger Fock hat das Original
brillant übersetzt. |
Pierre Guyotat |
||
|
|
|||
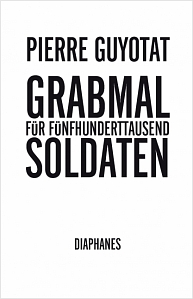 Aus
dem Inneren der Höllenmaschine
Aus
dem Inneren der Höllenmaschine