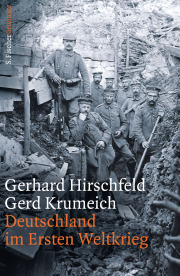|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 18.11.13 |
|
||
|
In zwölf Kapiteln erörtern die beiden erprobten Fahrensmänner der Historiographie des Ersten Weltkrieges Deutschlands Rolle in dieser so genannten Urkatastrophe Europas. Die beiden Autoren fühlen sich mit ihrem gemeinsamen Text der »neuen Militärgeschichte zivilen Zuschnitts« verpflichtet. Tatsächlich widmen sie daher auch nur zwei ihrer Kapitel den militärischen Operationen an den Kriegsschauplätzen, wobei es fast ausschließlich um die Ereignisse an den beiden Hauptfronten im Westen und in Russland geht. Ein Kapitel über den Seekrieg fehlt leider völlig und der von so vielen irrigen Hoffnungen auf deutscher Seite begleitete U-Bootkrieg wird schließlich nur im Zusammenhang mit der »Industrialisierung des Krieges« abschnittsweise erwähnt. Ebenso wird der Krieg in den Kolonien lediglich am Rande behandelt.
In einer zweckmäßigen
Mischung aus chronologischer und systematischer Betrachtung werden zunächst
Vorgeschichte, Julikrise und das »Augusterlebnis« in den Focus genommen und
dabei noch einmal die entscheidenden Katarakte wie Bündnispolitik, allgemeines
Wettrüsten sowie das Attentat von Sarajewo mit dem daran anschließenden
diplomatischen Tauziehen geschildert. Außer Frage steht für die Autoren
weiterhin die erhöhte Verantwortung der Reichsleitung für die Eskalation zum
europäischen Krieg, denn so sehr schienen die »deutschen Staatenlenker« (?) in
die Idee eines unvermeidlichen Krieges gegen Russland versponnen, dass sie nicht
bedachten, dass Russland erst durch ihr eigenes Verhalten zu jener Aggressivität
veranlasst werden konnte, deren man es ohnehin für fähig hielt. Es greift
allerdings eindeutig zu kurz, wenn Krumeich und Hirschfeld den Deutschen allein
ein »unverantwortliches Kalkül« vorhalten, dabei jedoch übersehen, dass die
erhöhte Konfliktbereitschaft in Berlin und Wien auch durch das gewaltige und von
Frankreich finanzierte russische Aufrüstungsprogramm provoziert wurde. Eine
ausgewogenere Darstellung zu dieser Problematik findet sich jetzt allerdings bei
dem Australier Christopher Clark (Die Schlafwandler). Das größte Versagen der deutschen Propaganda sehen die beiden Verfasser trotz erheblicher materieller Aufwendungen und Anstrengungen seitens der zuständigen Behörden in dem Unvermögen, die Leiden und Strapazen der Frontsoldaten in einen sinnvoll erscheinenden Kontext zu stellen. So ließen sich angeblich die individuellen Nöte der Familien und die Tragödien der gefallenen Väter, Söhne und Ehemänner, anders als bei den Briten, nicht in eine gesellschaftliche Verpflichtung gegenüber den »Helden« an der Front überführen. Zwischen Heer und Heimat klaffte somit eine immer größere Distanz. Der Diagnose wäre zwar zuzustimmen, doch wird die tatsächliche Ursache der Misere im Text nicht genannt. Denn im Gegensatz zu ihren Antipoden auf alliierter Seite vermochte die deutsche Propaganda zu keiner Zeit ein wirklich überzeugendes Kriegsziel benennen. Während Engländer und Franzosen die Befreiung Belgiens und Nordfrankreichs von den deutschen Aggressoren als Ziel aller Opfer und Entbehrungen anführen konnte und später sogar das verheißungsvolle Bild einer friedlichen Nachkriegsordnung demokratischer und selbstbestimmter Völker entwarfen, wollte die 3. Obersten Heeresleitung schlicht nur alles behalten, was sie gerade besetzt hielt. Damit aber war im fünften Kriegsjahr kaum noch ein deutscher Soldat zu motivieren.
Insgesamt bietet der vom
Fischer Verlag herausgebrachte Band eine sachliche und gut lesbare Darstellung
des Krieges aus rein deutscher Sicht, wobei fallweise auch auf alliierte
Verhältnisse eingegangen wird. Der aktuelle Forschungsstand wird handbuchartig
ohne besondere erzählerische Ambition präsentiert. Die einzelnen Kapitel werden
von ausführlichen Quellenzitaten, Karten, Plakaten und vergleichsweise seltenen
Abbildungen ergänzt und können einzeln gelesen werden, zumal sie auch mit
separaten Kurzbibliografien versehen sind. Eine zentrale These wird allenfalls
im letzten Kapitel angedeutet, wo die Autoren argumentieren, dass es im
Nachkriegsdeutschland nie gelang, zu einer gemeinsamen und verbindlichen Deutung
des Krieges zu gelangen, was den Aufbau einer friedlichen demokratischen Kultur
maßgeblich behinderte. Hierin schien die Dritte Republik nach ihrer Niederlage
1871 erfolgreicher gewesen zu sein, allerdings hatte Frankreich – anders als die
neue deutsche Republik - nach der Niederlage von Sedan den Widerstand noch fast
ein halbes Jahr fortgesetzt. Militärisch war das vielleicht sinnlos, politisch
jedoch verhalf es dem republikanischen Frankreich trotz aller inneren Gegensätze
zu einer Stabilität, zu der Weimar nie finden sollte. |
Gerd Krumeich,
Gerhard
Hirschfeld |
||
|
|
|||