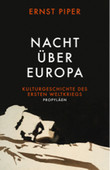|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 24.06.14 |
Ein ermüdender und ungeordneter Aufguss Von Klaus-Jürgen Bremm
|
||
|
Auf den ersten Blick mag Ernst Pipers Projekt einer Kulturgeschichte des Ersten Weltkrieges als ein Widerspruch in sich erscheinen. Bedeutet denn nicht jeder Krieg auch eine Entartung der Kultur, eine blutige Barbarei, die zunächst einmal jede Kulturleistung unterbricht oder sogar für lange Zeit beendet? Umso spannender wäre es natürlich gewesen, zu erfahren, was denn nun der Autor überhaupt als Kulturgeschichte verstehen will. Wer waren ihre Protagonisten und was waren ihre prägenden Elemente nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt in einem Europa, das trotz aller Gegensätze spätestens seit der Jahrhundertwende eine Art Protoglobalisierung erlebte. Allein schon auf Deutschland beschränkt wäre es eine Titanenaufgabe gewesen, sämtliche Facetten der Kultur, von Dichtung, Philosophie, Kunst, Politik, Wirtschaft, Religion, Vereinswesen, Arbeits- und Alltagswelt bis hin zur militärischen Parallelwelt der Kasinos und Kasernen zu erfassen.
Doch schon in seinem
Vorwort bremst Piper solche Erwartungen. Was im Untertitel noch als
»Kulturgeschichte des Krieges« erscheint, reduziert sich nun zu einer
»kulturgeschichtlichen Perspektive« und diese bleibt auf Deutschlands
Intellektuelle und Kunstschaffende beschränkt. Dem Verfasser geht es lediglich
um eine begrenzte Auswahl von Akteuren und deren diskursive Bemühungen, das
ungeheuerliche Geschehen zu erfassen oder gar zu legitimieren. Es sind also bei
Licht besehen, die so genannten Ideen von 1914 und damit die üblichen
Verdächtigen von Ernst Troeltsch über Johann Plenge bis zum unvermeidlichen
Thomas Mann, die nun wieder einmal die Bühne betreten. Alles dies ist nicht neu
und seit Hermann Lübbe bereits Dutzendmal und auch pointierter beschrieben
worden. Dabei erläutert Piper seinem schon bald Überdruss empfindenden Leser weder die gewählte Reihenfolge seiner Protagonisten noch arbeitet er eventuelle Gemeinsamkeiten heraus. Stattdessen verbreitet er etwa die sattsam bekannten Plattitüden über Deutschland als die zu spät gekommene Großmacht, die ihre Genese nicht einer bürgerlichen Revolution verdankte, sondern nur drei gewonnenen Kriegen: »Jetzt artikulierten sich die Inferioritätsgefühle einer verspäteten Nation im Postulat der Überlegenheit deutscher Kultur gegenüber der westlichen Welt.« Als Resümee klingt dies nicht nur dürftig, sondern ist auch schlicht falsch, denn in den Jahren unmittelbar vor Kriegsausbruch war Deutschland, das ehemalige Land der Dichter und Denker längst zu einer Nation der Ingenieure, Erfinder und Unternehmer geworden, das inzwischen als zweite Industrienation in der Welt (nach den Vereinigten Staaten) den ehemaligen Primus Großbritannien überholt hatte und sich damals durchaus berechtigt fühlte, sein scheinbar autoritäres politisches System über den von Klassenkämpfen und Revolten geprägten französischen Parlamentarismus zu stellen. Wenn Piper aber schließlich am Ende seines Kapitels über die Mobilmachung, das genauso gut auch anders hätte heißen können, schreibt, dass Deutschland und Frankreich nach drei Kriegen in nur 70 Jahren inzwischen das Herz des europäischen Einigungsprozesses bildeten und dies auch den größten Fortschrittsskeptiker zuversichtlich stimmen müssen, so ist dies noch nicht einmal eine karge Zusammenfassung, sondern eher ein politisches Glaubensbekenntnis, das zudem von den neuen Frontlinien in der EU längst widerlegt ist. Piper bietet in seinem Buch viel Material, hauptsächlich aus der einschlägigen Sekundärliteratur oder Tagebüchern, neue Quellen erschließt er nicht. Entscheidend ist aber, dass er weder einen schlüssigen Kulturbegriff liefert noch eine überzeugende zentrale These anbieten kann. So bleibt die Lektüre allenfalls für den mit der Materie weniger vertrauten Leser interessant, eine nette Narration ohne analytische Brillanz. |
Ernst Piper |
||
|
|
|||