|
Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Artikel online seit 09.10.13 |
Philosophie als Kultur der Nachdenklichkeit
Zwei Neuerscheinungen zur
Grundlegung und Einführung Von Dieter Kaltwasser |
||
|
Heutzutage ist der Glaube an den Systemkontext der klassischen Philosophie brüchig geworden, und mit ihm das philosophische Wissen. Jürgen Habermas schrieb vor einem Vierteljahrhundert den berühmt gewordenen Satz: »Wir haben zum nachmetaphysischen Denken keine Alternative.« Nachmetaphysisches Denken war ihm zufolge zunächst eine Antwort auf die Krisis des europäischen Geistes, insbesondere des Hegel’schen Denkens und mit ihm des gesamten deutschen Idealismus, dessen zentrale Denkfiguren durch gesellschaftliche, wissenschaftliche und philosophische Entwicklungen erschüttert wurden. Die Philosophie verlor ihr Privileg eines besonderen, extramundanen Zugangs zur Erkenntnis ebenso wie ihre Prinzipien, die detranszendentalisiert wurden. Immanuel Kant ist nach Habermas bereits der erste »nachmetaphysische« Denker, denn er beendet in der »Kritik der reinen Vernunft« den Fehler, die auf »innerweltliche Phänomene zugeschnittenen Verstandeskategorien auf die Welt als Ganzes« anzuwenden, den Schritt über die Erfahrungswelt unerlaubt hinauszugehen. In der heutigen nachmetaphysischen Philosophie treten an die Stelle des »transzendentalen Subjekts« die »nichthintergehbaren Strukturen der Lebenswelt«, dem neuzeitlichen wissenschaftlichen Denken sind die metaphysischen Ansprüche zum Opfer gefallen, wie man nun auch im von Habermas veröffentlichten zweiten Teil »Nachmetaphysisches Denken« nachlesen kann. Herbert Schnädelbach geht in seinem Buch erneut der Frage nach dem Wissen der Philosophen in vierzehn Kapiteln nach, die nach Themen und Problemlagen wie »Sinn und Bedeutung«, »Denken und Sprechen«, »Selbstbewusstsein« und »Naturalistischer Fehlschluss« gegliedert sind. Philosophen verfügen über einen »Kernbestand philosophischen Wissens«, so die These Schnädelbachs, hinter den nicht zurückfallen darf, wer heute ernsthaft am Dialog in der philosophischen Disziplin teilnehmen möchte. Für ihn steht fest, dass in einer wissenschaftlichen Zivilisation auch die Philosophie wissenschaftlich zu sein hat, sie mit solidem Wissen und Methoden aufwarten muss. Sie hat sich zwar ihrer Spezialisierung und Verwissenschaftlichung wegen institutionell fast zu einem »Orchideenfach« zurückgebildet, zur »Esoterik einer professionalisierten Fachdisziplin«, welche die »Orientierungsprobleme nachdenklicher Menschen« den »popularisierenden Bestsellerautoren und Großliteraten« überlassen muss, die in der medialen Öffentlichkeit mittlerweile als die eigentlichen Philosophen gehandelt werden. Doch jener Kernbestand an philosophischem Wissen kann nach Ansicht Schnädelbachs dazu beitragen, das disziplinäre Selbstverständnis der Faches weiterhin zu klären, vor allem bezüglich der Lehre, also dem, was man von den Philosophen lernen kann. Wie bei allen anderen Wissenschaften handelt es sich nämlich bei philosophischem Wissen eben nicht über jeden Zweifel erhabenes und unumstößliches Wissen: Es ist fehlbar, und dies kann an fehlender Begründbarkeit ebenso liegen wie am Scheitern unseres Wahrheitsanspruchs. Schnädelbach spricht von einer »Neutralisierung der Philosophie durch Verwissenschaftlichung«. Der disziplinäre Wissensbestand, der von Schnädelbach vorgestellt wird, hat sich in der neueren Philosophiegeschichte im kritischen Dialog mit dem Tradierten herauskristallisiert. So kann niemand in der gegenwärtigen Diskussion mehr ernst genommen werden, der immer noch mit den Modellen »Subjekt-Objekt« oder »Bewusstsein-Gegenstand« arbeitet, in der Semantik »Bedeutung« und »Gegenstand« gleichsetzt, bei metaphysischen Fragestellungen »das Sein für einen Gegenstand« hält oder in der praktischen Philosophie »Werte« und »Normen« miteinander vermengt. Dies führt Schnädelbach in brillanten Einzeluntersuchungen aus. Entscheidend ist für Schnädelbach die Verabschiedung der Philosophie von völlig überzogenen Wissens- und Letztbegründungsansprüchen, die heutzutage die Philosophierenden nur noch in die Resignation treiben. In allen anderen Wissenschaften ist akzeptiert, damit zu rechnen, dass wir uns geirrt haben könnten, und dass Irrtümer einzusehen einen Wissensfortschritt bedeutet. Auch Philosophen werden sich zu dieser Einsicht bequemen müssen. Herbert Schnädelbach hat eine unverzichtbare Einführung in das philosophische Denken geschrieben, die über den Kreis des akademischen Faches Aufmerksamkeit verdient.
Der Sonderweg der deutschen Philosophie, die nach Hösle auch eine spezifisch philosophische Form von Religiosität entfalte, beginnt für ihn im Mittelalter mit Meister Eckhart und Nicolaus Cusanus, führt über Jakob Böhme, Leibniz und Kant zur Gründung der Geisteswissenschaften durch Lessing, Hamann, Herder, Schiller und Wilhelm von Humboldt, und gipfelt schließlich in den Systemen des deutschen Idealismus Fichtes, Schellings und Hegels. Danach kommt es im 19. Jahrhundert zu Revolten gegen die christliche Dogmatik durch Schopenhauer, die bürgerliche Welt durch Feuerbach und Marx und gegen die universalistische Moral durch Nietzsche, die zur Auflösung der bisherigen Vernunftmetaphysik führt. Im zwanzigsten Jahrhundert werden von Hösle die bedeutenden Strömungen des Logischen Positivismus, des Neukantianismus und der Phänomenologie Husserls gewürdigt. Ein eigenes Kapitel deutet die »Philosophie des Nationalsozialismus« und die unrühmliche, aber wirkungsmächtige Rolle, die Heidegger, Gehlen und Schmitt einnahmen. Das vorletzte Kapitel widmet sich der »bundesrepublikanischen Anpassung an die westeuropäische Normalität«, speziell Gadamer, Horkheimer und Adorno, Apel und Habermas, sowie abschließend Hans Jonas, der sich im hohen Alter dazu entschied, obzwar er kein Remigrant war und in den USA lebte, wieder in seiner Muttersprache deutsch zu schreiben. Vittorio Hösle, der an der katholischen University of Notre Dame in Indiana Philosophie lehrt, ist skeptisch, was das Überleben und die Zukunft der deutschen Philosophie betrifft. Deren Niedergang verortet er im letzten Kapitel seiner Philosophiegeschichte in der »weltgeschichtlichen Situation«, dem »Ende des deutschen Geistes« und den »Sonderproblemen der deutschen Universitäten«, denen er nicht nur fehlende Wettbewerbsfähigkeit attestiert; institutionell spreche nicht viel für eine große Zukunft der deutschen Philosophie. Hösle hat eine höchst engagierte, pointiert wertende und zum Teil polemische deutsche Philosophiegeschichte verfasst, die deren Einbettung in europäische und globale Strukturen nicht vergisst. |
Herbert Schnädelbach
Vittorio Hösle
|
||
|
|
|||
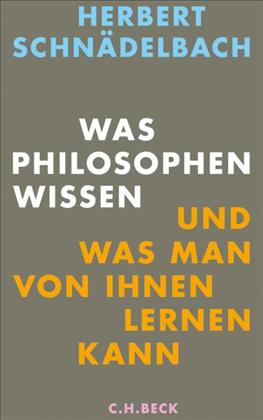
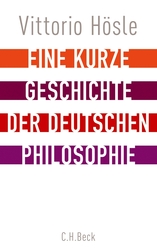 Eine
andere, der Tradition des objektiven Idealismus nahestehende philosophische
Position vertritt Vittorio Hösle, der der Gegenwartsphilosophie mit ihrem
Verzicht auf Letztbegründung skeptisch gegenübertritt. Er hat sich in seinem
neuen Buch »Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie«, das sich auch als
»Rückblick auf den deutschen Geist« versteht, der nicht einfachen Aufgabe
gestellt, einen deutschen Sonderweg vom Mittelalter bis in die Neuzeit zu
erkunden. Doch ist es überhaupt sinnvoll, von einer deutschen Philosophie zu
reden, wenn doch deren Vertreter nach ihrem Selbstverständnis einen »unendlichen
Dialog« über Raum und Zeit hinweg führen, und deren Erkenntnis in einem
(unendlichen) Prozess des gemeinsamen Forschens entsteht. Drängt sich nicht, so
fragt Hösle, der Verdacht auf, dass »deutsche Philosophie« ein artifizielles
Konstrukt ist, das nur philosophiefremden Bedürfnissen nachkommt. Allerdings ist
die Philosophie auf vielfältige Weise mit der jeweiligen Kultur als ganzer
verbunden, da, so Hösle, »eine Klärung der letzten Ziele des einzelnen Menschen,
aber auch des Kollektivs im Rahmen der Philosophie erfolgt.« Auch
Sprachbarrieren, noch verstärkt durch den Aufstieg der Nation zum bestimmenden
Identitätsfaktor, könnten in der »Ära der Nationalstaaten philosophische
Nationalkulturen hervorgebracht haben«. Die deutsche Philosophie teile zwar
gemeinsame Ziele mit der europäischen, habe aber eine spezifische Ausgestaltung
gewonnen, vor allem das Luthertum habe »den deutschen Geist geprägt wie kaum
etwas anderes«, alle »hegemonialen deutschen Intellektuellen« entstammten fast
alle dieser religiösen Konfession, dies sei noch einer der gemeinsamen Züge von
Kant und Nietzsche.
Eine
andere, der Tradition des objektiven Idealismus nahestehende philosophische
Position vertritt Vittorio Hösle, der der Gegenwartsphilosophie mit ihrem
Verzicht auf Letztbegründung skeptisch gegenübertritt. Er hat sich in seinem
neuen Buch »Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie«, das sich auch als
»Rückblick auf den deutschen Geist« versteht, der nicht einfachen Aufgabe
gestellt, einen deutschen Sonderweg vom Mittelalter bis in die Neuzeit zu
erkunden. Doch ist es überhaupt sinnvoll, von einer deutschen Philosophie zu
reden, wenn doch deren Vertreter nach ihrem Selbstverständnis einen »unendlichen
Dialog« über Raum und Zeit hinweg führen, und deren Erkenntnis in einem
(unendlichen) Prozess des gemeinsamen Forschens entsteht. Drängt sich nicht, so
fragt Hösle, der Verdacht auf, dass »deutsche Philosophie« ein artifizielles
Konstrukt ist, das nur philosophiefremden Bedürfnissen nachkommt. Allerdings ist
die Philosophie auf vielfältige Weise mit der jeweiligen Kultur als ganzer
verbunden, da, so Hösle, »eine Klärung der letzten Ziele des einzelnen Menschen,
aber auch des Kollektivs im Rahmen der Philosophie erfolgt.« Auch
Sprachbarrieren, noch verstärkt durch den Aufstieg der Nation zum bestimmenden
Identitätsfaktor, könnten in der »Ära der Nationalstaaten philosophische
Nationalkulturen hervorgebracht haben«. Die deutsche Philosophie teile zwar
gemeinsame Ziele mit der europäischen, habe aber eine spezifische Ausgestaltung
gewonnen, vor allem das Luthertum habe »den deutschen Geist geprägt wie kaum
etwas anderes«, alle »hegemonialen deutschen Intellektuellen« entstammten fast
alle dieser religiösen Konfession, dies sei noch einer der gemeinsamen Züge von
Kant und Nietzsche.