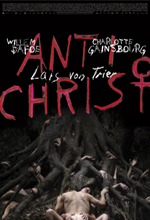|
Filme & Themen
Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Rubriken
Belletristik -
50 Rezensionen
Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen, Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Sprechblasen
Comics mit Niveau
Autoren
Porträts,
Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Berserker und Verschwender
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Literatur in
Bild & Ton
Literaturhistorische
Videodokumente von Henry Miller,
Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan
Rickman liest Shakespeares Sonett 130
Thomas Bernhard
 Eine
kleine Materialsammlung Eine
kleine Materialsammlung
Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen
gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen
Monologen über Gott und Welt.
Ja, der Bernhard hatte schon einen
Humor, gelt?
Hörprobe
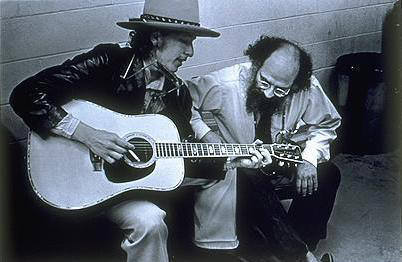
Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan
»Oh
my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/
Is called the Midwest.«
Ulrich Breth über die
Metamorphosen des großen Rätselhaften
mit 7 Songs aus der Tube
Glanz&Elend -
Die Zeitschrift
Zum 5-jährigen Bestehen
ist
ein großformatiger Broschurband
in limitierter Auflage von 1.000
Exemplaren
mit 176 Seiten, die es in sich haben:
Die menschliche
Komödie
als work in progress
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
Zu diesem Thema haben
wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás
Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter
Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den
besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.
Inhalt als PDF-Datei
Dazu erscheint als
Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«
von Christian Suhr & Herbert Debes
Leseprobe
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Neue Stimmen
 Die
Preisträger Die
Preisträger
Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge
reicht
von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.
Die prämierten Beiträge
Nachruf
 Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor
Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer
»Ich glaube nicht an Psychologie,
ich glaube an gute Züge.«
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«

|
 Eichelhagel
im Tannendunkel Eichelhagel
im Tannendunkel
Lars von Trier bleibt auch mit »Antichrist« seiner Flucht-Linie treu,
schafft diesmal aber vor lauter Kunstreligion kein Meisterwerk
Von Peter V. Brinkemper
Ist schon alles gesagt,
über diesen Film? Ja und
nein. »Antichrist« ist nicht das Meisterwerk, von dem die Kritiker uns auch in
denjenigen Medien vorschwärmen, die womöglich den Film mitproduziert haben. Auch
die haben nicht völlig Recht, die, wie Elfriede Jelinek durch ihre hymnische
Analyse in »Cargo« (http://www.cargo-film.de/)
auch endlich die Theater-Regie-Kooperation mit von Trier in eigener Sache
herbeisehnen.
»Antichrist«
ist aber nicht ganz so schlimm, wie der Titel oder manche raunende Kritik wegen
bestimmter kruder Einzelheiten vermuten lassen.
»Antichrist«
ist genau so wüst oder zahm, so misogyn oder philogyn, wie der Betrachter es
nach seinen eigenen Maßstäben und Lektüretechniken wahrhaben will. Lars von
Trier hat in diesem Werk weder jene stupende Radikalität von
»Dogville«,
noch die phantastische Imagination von
»Europa«
walten lassen, geschweige denn die improvisatorische Dogma-Frechheit der
»Idioten«
oder die gesellschaftliche Explosivität von Vinterbergs
»Fest«.
»Antichrist«
zelebriert ein verquastes Mittelmaß zwischen diesen angeführten Polen, garniert
mit einigen grauslichen symbolistisch-pornografischen Schockdetails, die für
eine mangelnde Handlungsdramatik und wackelige Wendepunkte einstehen sollen, wo
in Wahrheit dramaturgische Ratlosigkeit und Beliebigkeit herrschen.
 Von
Trier hat sich in einem verqueren Mischmasch verfangen, sozusagen in einem
zahmen Mischwald der Gattungen, ein Hauch
»Blair
Witch«,
zwischen Farnlichtung, Tannendunkel und ein bisschen Rest-Eichelhagel. Und dort
ist er am Mühlstein seines eigenen unentschiedenen Anspruchs in der
Zeit-Gedenk-Hütte von Tarkowskijs neoromantischem
»Nostalghia«
hängen geblieben. Und selbst diese Reverenz an das Traum-Erinnerungs-Prospekt
bei Tarkowskij, eine entrückte und berückende Vision eines bäuerlichen Anwesens
innerhalb einer toskanischen Klosterkirchenruine, funktioniert bei von Trier als
freigelegte, der religiösen Ummantelung entledigte Hütte nur zum Teil filmisch:
als computergesteuerte Postkartenvision im Zirkel von Mutter Natur und zugleich
als öde Realkulisse einer spätstudentischen Tramp-Zuflucht eines intellektuell
und seelisch zerrissenen Paares, das sein Kind und ganz sicherlich auch seine
gemeinsame Unbefangenheit (wenn es sie je besaß) verloren hat und damit sich
schon kaum mehr irgendeinen seelen-dramatischen Zündstoff mitzuteilen in der
Lage ist, der über eine trivialepische Melancholie und Endlos-Depression und
über die vermeintliche Verschiedenheit in der gemeinsamen Einfalt hinaus ginge.
Und in diesem Sinne sind auch der traditionell vorgepolte weibliche Wahnsinn
(der empfindsam über sich und ihr durch dunkle Jahrhunderte verfolgtes Geschlecht
nachsinnenden Frau) und die besserwisserische männliche Rationalität (des
therapeutisch auf Erfolg getrimmten Mannes) so dünn gesät, wie das bisschen
angedeutete Gras und Insekt auf dem Boden jener abgeschiedenen Gegend mit dem
bezeichnenden Titel
»Eden«.
Viele berühmte Namen und Vergleiche sind bereits gefallen, allen voran
Tarkowskij, dem der Film an seinem Ende ausdrücklich gewidmet ist. Aber das
Problem bleibt: Lars von Trier zitiert zwar viele Themen und Stilelemente
bekannter Bühnen- und Film-Autoren mit ihrem spät- und nachreligiösen Diskurs
zwischen 1900 und 1980: das volle Spektrum der Psychologie, Pathos,
Beziehungskrise, Ehedrama, Horrorfilm, Psychedelik und Naturmystik, ohne aber
die thematische Konzentration und Zuspitzung der angepeilten Vorbilder zu
erreichen. Das muss er ja auch nicht. Aber, warum werden sie dann bemüht? Als
Trophäen, oder als Reliquien einer gelungenen Dekonstruktion? Oder einfach als
Zeichen auf einer Flipchart-Skizze wie im Film? Von
Trier hat sich in einem verqueren Mischmasch verfangen, sozusagen in einem
zahmen Mischwald der Gattungen, ein Hauch
»Blair
Witch«,
zwischen Farnlichtung, Tannendunkel und ein bisschen Rest-Eichelhagel. Und dort
ist er am Mühlstein seines eigenen unentschiedenen Anspruchs in der
Zeit-Gedenk-Hütte von Tarkowskijs neoromantischem
»Nostalghia«
hängen geblieben. Und selbst diese Reverenz an das Traum-Erinnerungs-Prospekt
bei Tarkowskij, eine entrückte und berückende Vision eines bäuerlichen Anwesens
innerhalb einer toskanischen Klosterkirchenruine, funktioniert bei von Trier als
freigelegte, der religiösen Ummantelung entledigte Hütte nur zum Teil filmisch:
als computergesteuerte Postkartenvision im Zirkel von Mutter Natur und zugleich
als öde Realkulisse einer spätstudentischen Tramp-Zuflucht eines intellektuell
und seelisch zerrissenen Paares, das sein Kind und ganz sicherlich auch seine
gemeinsame Unbefangenheit (wenn es sie je besaß) verloren hat und damit sich
schon kaum mehr irgendeinen seelen-dramatischen Zündstoff mitzuteilen in der
Lage ist, der über eine trivialepische Melancholie und Endlos-Depression und
über die vermeintliche Verschiedenheit in der gemeinsamen Einfalt hinaus ginge.
Und in diesem Sinne sind auch der traditionell vorgepolte weibliche Wahnsinn
(der empfindsam über sich und ihr durch dunkle Jahrhunderte verfolgtes Geschlecht
nachsinnenden Frau) und die besserwisserische männliche Rationalität (des
therapeutisch auf Erfolg getrimmten Mannes) so dünn gesät, wie das bisschen
angedeutete Gras und Insekt auf dem Boden jener abgeschiedenen Gegend mit dem
bezeichnenden Titel
»Eden«.
Viele berühmte Namen und Vergleiche sind bereits gefallen, allen voran
Tarkowskij, dem der Film an seinem Ende ausdrücklich gewidmet ist. Aber das
Problem bleibt: Lars von Trier zitiert zwar viele Themen und Stilelemente
bekannter Bühnen- und Film-Autoren mit ihrem spät- und nachreligiösen Diskurs
zwischen 1900 und 1980: das volle Spektrum der Psychologie, Pathos,
Beziehungskrise, Ehedrama, Horrorfilm, Psychedelik und Naturmystik, ohne aber
die thematische Konzentration und Zuspitzung der angepeilten Vorbilder zu
erreichen. Das muss er ja auch nicht. Aber, warum werden sie dann bemüht? Als
Trophäen, oder als Reliquien einer gelungenen Dekonstruktion? Oder einfach als
Zeichen auf einer Flipchart-Skizze wie im Film?
 Für
August Strindberg oder Hjalmar Söderberg, Carl Theodor Dreyer und Ingmar
Bergmann spricht zwar die Parallele
»Beziehungsdrama«
und
»Ehekrise«
sowie
»Sinnverlust«,
aber die theaterpsychologisch konsequente Konstruktion der Charaktere und
Dialoge in deren besten, wirklichkeitsnäher verstehbaren, statt spätmetaphysisch
aufgeblähten Werken bleibt aus. Statt realistischer Agilität zwischen den
Figuren muss bei von Trier metaphysische Rissigkeit gleich der ganzen Welt im
Ausmaß von Sternbildern, tierischen Urgestalten und sündhaften
Seinsbefindlichkeiten herhalten. Die typisierende Differenz zwischen der
empfindsam-depressiven Frau und dem zunächst therapeutisch-optimistischen Mann
schafft keine elektrisierende Spannung heterogener Welten, sondern eine müde
Kopulation zwischen Stummheit und Rhetorik, Annäherung und Entfremdung,
Kuschel-Geborgenheit und gewaltsamen Ausgesetztsein. Mit einer kunstvollen
Spirale zwischen Eros und Thanatos, mit einem dynamischen Kampf der Geschlechter
hat das wenig zu tun. Eher mit Jenseits-Stümperei und Diesseits-Stolperei in
Konzept und Drehbuch. Für
August Strindberg oder Hjalmar Söderberg, Carl Theodor Dreyer und Ingmar
Bergmann spricht zwar die Parallele
»Beziehungsdrama«
und
»Ehekrise«
sowie
»Sinnverlust«,
aber die theaterpsychologisch konsequente Konstruktion der Charaktere und
Dialoge in deren besten, wirklichkeitsnäher verstehbaren, statt spätmetaphysisch
aufgeblähten Werken bleibt aus. Statt realistischer Agilität zwischen den
Figuren muss bei von Trier metaphysische Rissigkeit gleich der ganzen Welt im
Ausmaß von Sternbildern, tierischen Urgestalten und sündhaften
Seinsbefindlichkeiten herhalten. Die typisierende Differenz zwischen der
empfindsam-depressiven Frau und dem zunächst therapeutisch-optimistischen Mann
schafft keine elektrisierende Spannung heterogener Welten, sondern eine müde
Kopulation zwischen Stummheit und Rhetorik, Annäherung und Entfremdung,
Kuschel-Geborgenheit und gewaltsamen Ausgesetztsein. Mit einer kunstvollen
Spirale zwischen Eros und Thanatos, mit einem dynamischen Kampf der Geschlechter
hat das wenig zu tun. Eher mit Jenseits-Stümperei und Diesseits-Stolperei in
Konzept und Drehbuch.
 Auch
die Tarkowskij-Anleihen halten nicht, was sie versprechen, da die Rede der
Personen nicht jene artifizielle Stilisierung als Gegenmittel zur Natur und als
Brandsatz des angedeuteten Wahnsinns enthält, mit dem jeder eingebildete
männliche Heilige und jede angeblich sündhafte Frau bei dem russischen
Exil-Meisterregisseur ambivalent Hof halten und doch vergängliche Stalker
füreinander und vor dem verborgenen Gott sind. Auch die Todes- und Horrorspur
ist ein Dead-End, weil der anfänglich im traumhaft-kristallinen
»Europa«-Filmstil
inszenierte Verlust des Sohnes und die spätere Rekonstruktion seiner
Fehlentwicklungen in Sachen Erziehung (die Vertauschung der Schuhe an den Füßen
des Jungen durch die Mutter und die mangelnde Aufmerksamkeit durch den Vater)
keineswegs die Intensität der
Scheidungskind-und-Schauspieler-Tochter-Missbrauchs-Hysterie in
»The
Exorzist«
(Teil 1 von William Friedkin, 1973), der fatal-infantilen Boshaftigkeit in
»Omen«
(die ältere Fassung von Richard Donner, 1976) oder der blühend paranoiden
Familien-Schizophrenie im neonhellen
»The
Shining«
(die Kubrick-Version, 1980) erreichen. Filmen, in denen
die divergenten Familienpole im Kontext der 70er Jahre eine ganz andere
innerpsychische und sozial-»hygienische«
Fluchtlinienführung als bei von Trier erreichen: zwischen snobistisch gewordener
Aufklärung, brillanter Bild-Stilistik und lustvoll-verspielter Regression des
Kinos, die schwärzesten Rituale als konsumierbare Erfahrungen auf die Leinwand
zu werfen, um eine pubertär-sehnsuchtsvolle Nacht-Vorstellung eines wunderbar
kompakten und manifesten Bösen zu entwickeln und die ideologische Differenz der
Geschlechter herauszumodellieren, die längst in der Tages-Welt der etablierten
weißen Bürger soziologisch abhanden gekommen war, durch die emanzipatorische
Verkopplung oder ideologische Verwischung von Intelligenz und Emotionalität,
jenseits der überlieferten dumpfen Mann-Frau-Rollen. Auch
die Tarkowskij-Anleihen halten nicht, was sie versprechen, da die Rede der
Personen nicht jene artifizielle Stilisierung als Gegenmittel zur Natur und als
Brandsatz des angedeuteten Wahnsinns enthält, mit dem jeder eingebildete
männliche Heilige und jede angeblich sündhafte Frau bei dem russischen
Exil-Meisterregisseur ambivalent Hof halten und doch vergängliche Stalker
füreinander und vor dem verborgenen Gott sind. Auch die Todes- und Horrorspur
ist ein Dead-End, weil der anfänglich im traumhaft-kristallinen
»Europa«-Filmstil
inszenierte Verlust des Sohnes und die spätere Rekonstruktion seiner
Fehlentwicklungen in Sachen Erziehung (die Vertauschung der Schuhe an den Füßen
des Jungen durch die Mutter und die mangelnde Aufmerksamkeit durch den Vater)
keineswegs die Intensität der
Scheidungskind-und-Schauspieler-Tochter-Missbrauchs-Hysterie in
»The
Exorzist«
(Teil 1 von William Friedkin, 1973), der fatal-infantilen Boshaftigkeit in
»Omen«
(die ältere Fassung von Richard Donner, 1976) oder der blühend paranoiden
Familien-Schizophrenie im neonhellen
»The
Shining«
(die Kubrick-Version, 1980) erreichen. Filmen, in denen
die divergenten Familienpole im Kontext der 70er Jahre eine ganz andere
innerpsychische und sozial-»hygienische«
Fluchtlinienführung als bei von Trier erreichen: zwischen snobistisch gewordener
Aufklärung, brillanter Bild-Stilistik und lustvoll-verspielter Regression des
Kinos, die schwärzesten Rituale als konsumierbare Erfahrungen auf die Leinwand
zu werfen, um eine pubertär-sehnsuchtsvolle Nacht-Vorstellung eines wunderbar
kompakten und manifesten Bösen zu entwickeln und die ideologische Differenz der
Geschlechter herauszumodellieren, die längst in der Tages-Welt der etablierten
weißen Bürger soziologisch abhanden gekommen war, durch die emanzipatorische
Verkopplung oder ideologische Verwischung von Intelligenz und Emotionalität,
jenseits der überlieferten dumpfen Mann-Frau-Rollen.
Ein Teil der widersprüchlichen und etwas dümmlichen Anti-Dynamik im
»Antichrist«
ist darauf zurückzuführen, dass der Film unter einer dogmatischen
Kunstreligiosität in der Anlage der Handlung und in der Bildsprache leidet: die
hervorragenden und allseits präsenten Schauspieler Willem Dafoe und Charlotte
Gainsbourg (weit mehr als ein Ersatz für die barocke Eva Green) in ihrem Nah-
und Fernverhalten werden einer widersprüchlichen Inszenierung unterworfen,
zwischen relativ starrer Retro-Horror-und-Mystik-Ritualisierung und der
stellenweise immer noch dokumentarisch-befreiten dynamischen Dogma-Handkamera
mit wackeligen Plansequenzen und recht gewollten Avid-Computer-Schnitt-Rhythmen
zum Ambient-Katastrophen-Sound, welcher der anfänglichen metaphysischen
Larmoyanz der Händel-Arie aus
»Rinaldo«
ein erdiges Ereignisrelief verleihen soll. Zwar gelingen von Trier aufregend
wilde und paradox poetische Momente zwischen Mensch und Tier, Baum und Körper,
Himmel und Erde, Dachboden und Grab. Das Natur-Reich der exkommunizierten Frau
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des rationalistischen Mannes wird ein Stück
erschlossen. Die Höhle wird ausgegraben, aber dadurch auch beseitigt. Der Film
beansprucht eine Art der negativen Territorialisierung, der destruktiven
Inbesitznahme eines neuen Kontinentes, der längst nicht mehr unentdeckt ist,
aber es bleibt beim Tappen ins Unbekannte. Der Phallozentrismus der
Freudianischen Denkens wird, etwas platt, in eine Art Anti-Ödipus des weiblichen
Mille-Plateaux-Wurzel-Knollen-Kollektiv-Körpers verwandelt (vgl. die
entsprechenden Tricks im Film). In diesem Universum ist auch jede Form der
Kastration erträglich, weil es immer wieder krude, blutige Wurmfortsätze des
Lebendigen gibt. Der Plot ist auf das Scrap-Book einer schemenhaften Frau
bezogen, deren ausführliche Sammlungen und Abhandlungen zur Hexenverfolgung in
Wort und Bild in die Signatur der sich auflösenden Schrift im Stil von Cy
Twombly übergehen (auch die Graphik des Filmtitels) und zugleich als visuelles
Feld einer exzessiven naturhaften Selbstbefleckung als schuldbewusster Gestalt
zwischen klassischer Nymphe und merkwürdig konturlos bleibendem
maskulin-femininem Satyr am Ende münden. Dieser weibliche Pan, dieser alt-neue
herm-aphroditische Schrecken der undomestizierten und auf ihre Weise
vermännlichten Frau ist zugleich die Figur, die der Mann nicht zulassen kann.
Und Lars von Trier? Dies hätte der entscheidende Punkt für einen wirklich
gelungenen Film jenseits der verblassenden männlichen Ordnung werden können,
auch als wahrhaft gruselige Kontrafaktur zum geläufigen Horrorstreifen mit
seinen vielen Rollenklischees. Dennoch,
»Antichrist«
bleibt ein sehenswerter und diskussionswürdiger Film. Trotz seiner Kruditäten
und der Erstarrung in der selbst-verordneten Kunstreligion in der Manier eines
neo-satanischen 1900 plus 109.
|
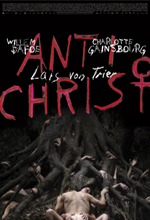 Regie: Regie:
Lars von Trier
mit Charlotte Gainsbourg,
Willem Dafoe
Deutschland 2009
104 Minuten
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac Eine
kleine Materialsammlung
Eine
kleine Materialsammlung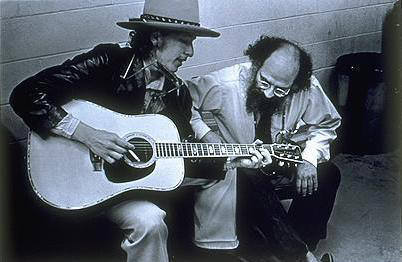
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend Die
Preisträger
Die
Preisträger

 Von
Trier hat sich in einem verqueren Mischmasch verfangen, sozusagen in einem
zahmen Mischwald der Gattungen, ein Hauch
Von
Trier hat sich in einem verqueren Mischmasch verfangen, sozusagen in einem
zahmen Mischwald der Gattungen, ein Hauch  Für
August Strindberg oder Hjalmar Söderberg, Carl Theodor Dreyer und Ingmar
Bergmann spricht zwar die Parallele
Für
August Strindberg oder Hjalmar Söderberg, Carl Theodor Dreyer und Ingmar
Bergmann spricht zwar die Parallele