|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Bücher & Themen Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré
de Balzac Honoré
de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
»Schönheit.
Wahrheit. Eros. Tod. Krieg. Macht.
Der Herausgeber hat sich in seiner Funktion als Autor das fraglos 'schönste' der zehn Themen ausgewählt: die „Schönheit". Liessmann stellt seine Einführung unter das Stendhalsche Motto von der Schönheit als Glücksversprechen und hebt schulmäßig an: „‚Schönheit‘ gehört zu den gleichermaßen umstrittenen wie unhintergehbaren Begriffen der europäischen Kultur. Es gibt kaum einen Bereich des Lebens, in dem Schönheit nicht eine zentrale Rolle spielte." Was dann folgt, ist ein philosophisch grundierter, eher bildungsbeflissen-fordernder denn leichtfüßig-tänzelnder Rundgang durch die Ideengeschichte, bei dem wir viele alte Bekannte (Plato, Plotin, Leonardo, Kant, Hegel, Freud oder Adorno) in nicht immer ganz neuem Gewande bei ihren Debatten über Natur-, Kunst- und Menschenschönheit antreffen. Am Ende jedoch überrascht Liessmann mit der Erkenntnis, das Postulat des Vorrangs der ominösen „inneren Werte" sei eine „christologisch [recte „christlich"?] fundierte Weisheit", die zusehends obsolet werde in einer Welt, „die einerseits am antiken Ideal der Kalokagathia [sog. Schöngutheit] festhält, aber das Strahlen der äußeren Schönheit nicht aus der Arbeit am moralischen Subjekt, sondern umgekehrt die moralische Qualität aus einem Erscheinungsbild ableitet, das zunehmend der Machbarkeit und damit der Verantwortung der Menschen zugewiesen wird."
Sind wir aber
wirklich so dumm geworden, jemanden, der schön ist oder sich vermeintlich schön
macht, deshalb schon für tugendhaft zu halten? Sind wir schon soweit, nicht mehr
zwischen „attraktiv" und „moralisch gut" unterscheiden zu können? Das glaubt
natürlich auch Liessmann nicht. Und freilich kannten die alten Griechen „innere
Werte". Schon Demokrit hatte geschrieben: „Leibesschönheit ist etwas Tierisches,
wenn nicht Verstand dabei ist."
Hierzu ist
erstens anzumerken, daß die „Agape“ in der paganen griechischen Literatur so gut
wie nicht existiert, so daß man sie – anders als die „inneren Werte“ – mit
einigem Recht als christliches Eigengut bezeichnen kann. In Konkurrenz zum
„Eros“ stand sie jedenfalls erst nach der Zeitenwende; und auch dieses
Konkurrenzverhältnis ist nicht so simpel strukturiert, wie uns die
Hochschulweisheit mitunter glauben machen will. Zweitens will nicht einleuchten,
wieso die deutsche „Liebe“ mit „Agape“ semantisch enger verschwistert sein
sollte als mit „Eros“. Kennen wir denn nicht gottlob das Liebesspiel auf dem
Liebeslager in einer schönen Liebesnacht?
Manfred
Füllsacks Text über den Begriff „Arbeit“ in historischer,
sozialwissenschaftlicher, ökonomischer und philosophischer Perspektive leidet an
sprachlichen Insuffizienzen, die das Verstehen manchmal doch sehr erschweren. Da
„beleuchtet“ ein „Umstand interessante Aspekte“; oder: „Erst mit der beginnenden
Neuzeit rückt die Arbeit als wertschöpfende Ressource im modernen Sinn in den
Fokus.“ Oder auch: „Die Reformation, wie sie gewöhnlich mit der Verkündung der
95 lutherischen Thesen im Jahr 1517 assoziiert wird ...“. Wie frisch, systematisch transparent und schnörkellos geht es hingegen in Birgit Reckis (Universität Hamburg) Schrift über „Freiheit“ zu! Das Buch ist ein Meisterstück luzider philosophischer Konzisität. Ausgehend von Augustinus‘ „De libero arbitrio“ („Vom freien Willen“) verfolgt Recki die lange Geschichte der – strukturell eigentlich gleichbleibenden – Diskussionen um die Willensfreiheit, würdigt die Argumente der Befürworter und Bestreiter bis hin zum aktuellen, von der Neurobiologie induzierten Diskurs; setzt uns die „Freiheitsantinomie“ Kants auseinander, erwägt Fragen der Freiheit in Kultur, Politik und Kunst und plädiert am Schluß im Hinblick auf die Unentscheidbarkeit des Zwistes zwischen Deterministen und Nicht-Deterministen für eine pragmatisch-vernünftige Gelassenheit, die sich Blaise Pascals „Wette“ zum Vorbild nimmt, indem sie auf „Freiheit“ setzt, weil der Gewinn viel in Aussicht stellt, der Verlust aber wenig kostet. In dubio pro libertate! Die beiden Bändchen über „Gerechtigkeit“ (von Elisabeth Holzleithner) und „Wahrheit“ (von Richard Heinrich) zeichnen sich aus durch die solide Nüchternheit eines engagierten Lehrbuchs für fortgeschrittene Semester. Man muß jedoch schon erstens gutgelaunt und zweitens sehr firm in der jeweiligen Materie sein, um diese zweifellos sachkundigen und didaktisch wohldurchdachten Texte „kurzweilig“ zu finden. Aber bitte: Weder in puncto Gerechtigkeit noch in puncto Wahrheit läßt sich ohne die antiken Säulen Plato und Aristoteles oder ohne zumindest rudimentäre Kenntnis des Aufklärungsgiganten Kant ideengeschichtlich Verbindliches sagen; wie ja überhaupt das ganze Liessmannsche Sammelwerk eher bezeugt, daß der Weg der Wissenschaft steinig ist. Dessen Verlauf ist, so betont Richard Heinrich unter etwas mysteriösem Rekurs auf Philip Kitchers Buch „Science, Truth, and Democracy“ (2001), immer wesentlich abhängig von interessierten wissenschafts- und wahrheitsexternen Instanzen, eben von den – nicht selbst wissenschaftlich legitimierten – „Beziehungen von Forschungspolitik, Demokratie und Wissenschaft“.
Man wird nicht
gänzlich fehlgehen, wenn man diese Andeutung Heinrichs als eine Erinnerung an
die einschlägige, in ihrer Deutlichkeit unschlagbare Äußerung Liessmanns zur
gegenwärtigen Forschungssituation aus der „Theorie der Unbildung“ versteht:
„Unbefangen etwa über Fragen der Ethnizität, Geschlechtlichkeit, Probleme der
Migration oder die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu forschen, ist nahezu
unmöglich geworden – die von der politischen Moral diktierten
Forschungsergebnisse stehen in der Regel vorab schon fest.“
Den „Krieg“
haben wir ebenfalls unter die zehn wichtigsten Wörter unserer Kultur zu
subsumieren. Der Wiener Rechtsphilosoph Christian Stadler nähert sich dem Krieg
„systemisch-dialektisch im Lichte seines Begriffs“ und stellt vorab klar: „Es
gilt, das gleichsam mit metaphysischer Unerbittlichkeit wesenden Kriegen
[sic] in den Wurzeln des abendländischen Denkens aufzuspüren und
Tiefenstrukturen der politischen Prozesse zu entfalten, die es erlauben, das
historische Phänomen ‚Krieg‘ auf sein geschichtliches Noumenon hin zu denken.“
Den Studierenden, denen dieses Programm noch nicht intrikat genug ist, hilft
Stadler dann wenige Seiten später weiter. Jene methodenexplizierende Stelle
unter der schlichten Überschrift „Die polemologische Reflexion als
transzendentaler Selbstvollzug“ sei in ihrer vollen Schönheit wiedergegeben; sie
lautet: „Leitstern des hier vorgeschlagenen Marsches durch die abendländische
Gedankenwelt kann nur ein idealistisches Grundverständnis vom Krieg
selbst sein. Die Anstrengung des zu verwirklichenden Begriffes weist über das
Physische stets hinaus ins Metaphysische, über das Faktische hinaus ins
Normative, über das Werthafte hinaus ins Prinzipielle; daher ist die
transzendental-synthetische Deduktion der entelechetisch-analytischen Induktion
als Methode der Seinslichtung vorzuziehen. Unser Unterfangen, das
Phänomen Krieg auf seine gleichsam platonisch-sonnenhafte idealitas hin
zu befragen – eine Ideenhaftigkeit, die ebenso existenz-wie erkenntnisbegründend
ist – , nötigt zur gebotenen Systemik des eigenen Seinsvollzugs, wie dieser sich
sowohl im Denken des späten Platon (‚Parmenides‘, ‚Sophistes‘) als auch der
neuzeitlichen System-Platoniker Spinoza, Fichte und Schelling andeutet.“ – Wir
erinnern uns, es geht um „Krieg“ oder, wie man heute vorzugsweise zu sagen
pflegt, um „kriegsähnliche Zustände“! Das Bemühen um eine entspannte Präsentation seiner Überlegungen zur variantenreichen Begrifflichkeit und zur schier uneingrenzbaren Ideengeschichte des „Glücks“ ist Georg Schildhammers Buch anzumerken, dessen Umschlagstext bereits flockig auftritt: „‚Das Glück is a Vogerl‘ sagt der Volksmund – kurz: Die Jagd nach dem Glück beschäftigt uns alle.“ Schildhammer bereitet akademisch gefordertes Wissen mit betont unakademischem Gestus auf: „Es wäre ein Missverständnis, Kant zu unterstellen, er wäre dagegen, dass die Menschen glücklich seien.“ Man kommt angesichts derartiger Leichtfüßigkeiten kaum umhin, den Erdnußbuttergeschmack englisch-US-amerikanischer Wissenschaftspopularsprache auf der Zunge zu spüren. Man liest etwas über diverse Amulette als Glücksbringer, über das Märchen von „Hans im Glück“, schlendert ein wenig durch die Gefilde der antiken Eudaimonia, stößt auf „Angebote aus der Religionsgeschichte“, lernt etwas über Utopien, Psychoanalyse, Drogen und Glücksspiele sowie sogar über das Oxytocin, „ein Neuropeptid, das in der Hypophyse produziert und von dort ins Blut abgegeben wird. Es löst bei Schwangeren die Wehen aus und fördert den Milchfluss der Mutter, wirkt sexuell stimulierend auf Männer und Frauen und ist bedeutsam bei der Paarbindung sowie bei jener zwischen Eltern und ihren Kindern.“ Nun denn, das mag alles so angehen, doch ist gewolltes „kurzweilig“ mitnichten per se das Gegenteil von „langweilig“. Den letzten der zehn Bände möchten wir unter Berufung auf Goethe („Den Tod aber statuiere ich nicht.“) übergehen; selbst auf die Gefahr hin, der ehrenwerten Autorin Katharina Lacina, die den schwersten Teil erwählt hat, Unrecht zu tun. Wir nehmen den zweiten Satz ihres Buches ernst und werden hinfort zu diesem Thema schweigen: „Das Misstrauen in die Tragfähigkeit der Sprache als Ausdrucks- und Erkenntnismittel sollte jeder philosophischen Beschäftigung mit dem Tod zu eigen sein, denn der Gefahr, nur ‚leeres Geroll von Silben‘ (Bachmann) zu erzeugen, ist jedes Sprechen über den Tod ausgesetzt.“ Will man ein Fazit über das Liessmannsche Sammelwerk ziehen, so hat man ein Urteil über dessen Tauglichkeit für Studienzwecke tunlichst der Praxis und den akademischen Lehrern zu überlassen. Strenge Wissenschaftlichkeit war jedenfalls kaum angestrebt, eher wohl ein essayistisch arrangiertes Propädeutikum. Wer als bildungshungriger Leser ein durch fachliche Instruktion bewirktes geistiges Stimulans erwartet, wird weder völlig enttäuscht noch euphorisiert sein.
Vorschlag des
Rezensenten: Man nehme sich ein Vierteljahr lang am Wochenende einige Stündchen
Zeit für die Lektüre eines der Bücher, mache sich ein paar Exzerpte ad usum
proprium und vertraue dem Beipackzettel des Verlags: „Denken bedeutete in
der europäischen Geschichte immer auch, sich mit diesen Begriffen
auseinanderzusetzen, sie immer wieder zu deuten, zu verwerfen oder im Rückgriff
darauf neue Perspektiven zu entwerfen.“ Nebenwirkungen: Gelegentliche leichte
Chasmen möglich. Kontraindikationen: Personen mit einer Idiosynkrasie gegen
universitätsdidaktisch aufbereitete Destillate sollten zu Alternativpräparaten
greifen; etwa zu der von Piper herausgebrachten „Trilogie“ Wenn die Lektüre der Liessmann-Kassette „Pflicht“ war, so handelt es sich bei dieser Trilogie gewiß um eine geisteswissenschaftliche Kür oder, um in diesem wintersportlichen Bild zu bleiben, um ein Gala-Schaulaufen von Koryphäen. Unter der Leitung des Philosophen Heinrich Meier hatte die Carl Friedrich von Siemens Stiftung hoch- und höchstrangige Repräsentanten unterschiedlicher Disziplinen zu Vorträgen eingeladen, die der Piper-Verlag in überarbeiteter und erweiterter Fassung dem breiten Publikum der Sucher nach dem Sinn des Lebens in erschwinglichem Taschenbuchformat anbietet.
Schon qua
Anwesenheit des – man sehe mir diese Vorliebe nach – Schweizer
Literaturwissenschaftlers Peter von Matt in allen drei Teilen ist diese
Veranstaltung nobilitiert. Nennen wir aus dem mittleren Teil der „Trilogie“
(„Der Tod im Leben“) lediglich Titel und Untertitel seines Beitrags: „Tod und
Gelächter. Der Tod als Faktor des Komischen in der Literatur“, und gehen über zu
Peter von Matts Vortrag aus dem Band „Über die Liebe“, der sich unter der
Überschrift „Versuch, den Himmel auf der Erde einzurichten“ dem „Absolutismus
der Liebe in Goethes ‚Wahlverwandtschaften‘“ zuwendet.
Neben den
beiden genannten finden sich im Symposionsband „Über die Liebe“ die folgenden
Autoren und Beiträge:
- David E.
Wellbery: „Prekäres und unverhofftes Glück. Zur Glücksdarstellung in der
klassischen deutschen Literatur“,
Zwei Beiträge
möchte ich am Ende herausgreifen: Erstens Camille Paglias (die
US-Kulturhistorikerin ist hierzulande vor allem durch „Die Masken der
Sexualität“, 1992, bekannt geworden) Apologie des – traditionell-alteuropäisch
verstandenen – künstlerischen Schaffens. Gegen die poststrukturalistische
Entlarvungspolemik, die in den kanonischen „Meisterwerken“ der heute
vielgeschmähten Dead White European Males („angefangen bei Homer“)
lediglich Dokumente von Ausschließungs- und Unterdrückungsprozeduren erkennen
möchte, insistiert Paglia auf dem Glück des Künstlers, im Werk einen
authentischen Gegenkosmos zu gestalten: „Damit sich Kreativität wiederbelebt,
muß die Kunst erneut verstanden werden als eine magische Verschmelzung des
Materiellen und des Spirituellen, deren Vereinigung sowohl dem Schaffenden wie
dem Rezipienten ein sie zutiefst veränderndes Glück bringt“, schreibt sie und
erinnert etwa an den Jazzmusiker Miles Davis: „Davis leugnete, daß Glücksgefühle
seine Motivation oder sein Ziel seien, doch paradoxerweise definierte er so das
Glück neu und gab es anderen.“
|
Konrad Paul
Liessmann (Hg.)
Heinrich Meier
und Gerhard Neumann (Hg.)
Friedrich
Wilhelm Graf & Heinrich Meier (Hg.)
Heinrich Meier
(Hg.) |
||
|
|
||||


 Hatte
nun Liessmann in seiner völlig zu Recht vielbeachteten Streitschrift „Theorie
der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft" (2006) noch mit einiger
Distanz auf Dietrich Schwanitz‘ „Bildung. Alles, was man wissen muß" geblickt
(„Auch bei Schwanitz regrediert Bildung zu jenem Gesellschaftsspiel ..."), so
hat es jetzt fast den Anschein, als wolle Liessmann sich mit dem vorliegenden
Projekt gerade auf jene beargwöhnte Bildungsschwundstufe begeben; vernimmt man
doch (wieder Presseinformation): „Die tiefgreifende Beschäftigung mit den
zugrunde liegenden Begriffen und Ideen ist nicht nur eine Schule des Denkens.
Sie gibt auch starke Argumente in Diskussionen und Gesprächen an die Hand."
Hatte
nun Liessmann in seiner völlig zu Recht vielbeachteten Streitschrift „Theorie
der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft" (2006) noch mit einiger
Distanz auf Dietrich Schwanitz‘ „Bildung. Alles, was man wissen muß" geblickt
(„Auch bei Schwanitz regrediert Bildung zu jenem Gesellschaftsspiel ..."), so
hat es jetzt fast den Anschein, als wolle Liessmann sich mit dem vorliegenden
Projekt gerade auf jene beargwöhnte Bildungsschwundstufe begeben; vernimmt man
doch (wieder Presseinformation): „Die tiefgreifende Beschäftigung mit den
zugrunde liegenden Begriffen und Ideen ist nicht nur eine Schule des Denkens.
Sie gibt auch starke Argumente in Diskussionen und Gesprächen an die Hand."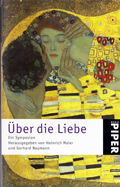 Von
Matt stellt die Essenz des Romans in die ideengeschichtliche Umgebung des
Magnetismus-Diskurses des frühen 19. Jahrhunderts, wo Phänomene wie Hellseherei,
Hypnose, Telepathie etc. antiaufklärerisch anfällige Gemüter zur
romantizistischen Esoterik verführten. Doch Goethe läßt es bei der schlichten
Anerkenntnis banaler Absonderlichkeiten nicht bewenden: Dem „eindringenden
Ungeheuren“ der Liebe in den „Wahlverwandtschaften“ eignet, so Peter von Matt,
„die absolute Gewalt des antiken Schicksals“. Wie der Magnet ist die Liebe
zwischen Mann und Frau ein „Urphänomen“, das „man nur zur Kenntnis nehmen, nicht
aber erklären kann“. Die Urgewalt der Liebe ist von sich selbst aus von einer
„radikalen Außersittlichkeit“ und steht dem Sittlichen als dem Produkt des nicht
minder urgewaltigen, ordnungserzwingenden Zivilisationsdrucks entgegen. Es ist
nun einmal das ureigenste Kennzeichen der Liebe, daß sie sich als ein
anarchisches Wesen behaupten will, welches sich jedem reglementierenden Zugriff
entzieht.
Von
Matt stellt die Essenz des Romans in die ideengeschichtliche Umgebung des
Magnetismus-Diskurses des frühen 19. Jahrhunderts, wo Phänomene wie Hellseherei,
Hypnose, Telepathie etc. antiaufklärerisch anfällige Gemüter zur
romantizistischen Esoterik verführten. Doch Goethe läßt es bei der schlichten
Anerkenntnis banaler Absonderlichkeiten nicht bewenden: Dem „eindringenden
Ungeheuren“ der Liebe in den „Wahlverwandtschaften“ eignet, so Peter von Matt,
„die absolute Gewalt des antiken Schicksals“. Wie der Magnet ist die Liebe
zwischen Mann und Frau ein „Urphänomen“, das „man nur zur Kenntnis nehmen, nicht
aber erklären kann“. Die Urgewalt der Liebe ist von sich selbst aus von einer
„radikalen Außersittlichkeit“ und steht dem Sittlichen als dem Produkt des nicht
minder urgewaltigen, ordnungserzwingenden Zivilisationsdrucks entgegen. Es ist
nun einmal das ureigenste Kennzeichen der Liebe, daß sie sich als ein
anarchisches Wesen behaupten will, welches sich jedem reglementierenden Zugriff
entzieht. 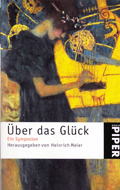 Der
Band „Über das Glück“ wird eingerahmt von einem Prolog und einem Epilog Heinrich
Meiers und vervollständigt die „Trilogie“ der Carl Friedrich von Siemens
Stiftung und des Piper-Verlags mit diesen Texten:
Der
Band „Über das Glück“ wird eingerahmt von einem Prolog und einem Epilog Heinrich
Meiers und vervollständigt die „Trilogie“ der Carl Friedrich von Siemens
Stiftung und des Piper-Verlags mit diesen Texten: Sehr
oft liegt eben das Glück im anderen Leben, wie die US-Wissenschaftshistorikerin
Lorraine Daston in ihrem beglückenden Aufsatz, der Freud und Leid des einsamen,
nur der Wissenschaft gewidmeten Daseins zum Thema hat, zu berichten weiß:
„Welcher normale Mensch würde schon 18 Stunden des Tages damit zubringen, tote
Sprachen zu rekonstruieren oder auf Raupen zu starren, und darüber vor
Begeisterung vergessen, sich anzuziehen oder zu essen? Wer um alles in der Welt
würde deswegen freiwillig bürgerliche, religiöse und familiäre Rechte und
Pflichten und sogar angenehme Geselligkeiten über Bord werfen? Wer Gesundheit,
Liebe und Vermögen vernachlässigen, um Wissen über Dinge anzuhäufen, das
niemandem nutzt und immer unvollkommen bleibt?“
Sehr
oft liegt eben das Glück im anderen Leben, wie die US-Wissenschaftshistorikerin
Lorraine Daston in ihrem beglückenden Aufsatz, der Freud und Leid des einsamen,
nur der Wissenschaft gewidmeten Daseins zum Thema hat, zu berichten weiß:
„Welcher normale Mensch würde schon 18 Stunden des Tages damit zubringen, tote
Sprachen zu rekonstruieren oder auf Raupen zu starren, und darüber vor
Begeisterung vergessen, sich anzuziehen oder zu essen? Wer um alles in der Welt
würde deswegen freiwillig bürgerliche, religiöse und familiäre Rechte und
Pflichten und sogar angenehme Geselligkeiten über Bord werfen? Wer Gesundheit,
Liebe und Vermögen vernachlässigen, um Wissen über Dinge anzuhäufen, das
niemandem nutzt und immer unvollkommen bleibt?“