|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Bücher & Themen Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré
de Balzac Honoré
de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Jean-Michel Palmiers monumentale Studie zu
Leben und Werk Walter Benjamins Walter Bendix Schönflies Benjamin (* 15. Juli 1892 in Berlin - † 26. September 1940 in Portbou) wird seit Jahrzehnten als Grenzgänger eines transgressiven Denkens bewundert, der auf vielen intellektuellen Märkten zu finden ist, um dort seine ewige Aktualität zu behaupten. Maßgeblich für diesen ungebrochenen, aber nicht weniger verdächtigen Kultstatus ist ein Werk, das mit höchstem Anspruch auftrat, auch heute noch experimentell und innovativ erscheint und so zahlreiche philosophische, theologische und mediale Strömungen verarbeitete, dass sich der Autor weitgehend seiner kategorialen Verortung im Bildungspantheon entziehen konnte. Auch wenn gegenwärtige Leser den Verdacht erheben mögen, dass der Autor an dieser oft enigmatischen Einzigartigkeit keinen geringen strategischen Anteil hatte, also sein Werk nicht zuletzt stilistisch prätentiös zu inszenieren wusste, so sind doch Benjamins kühne Motiv-Verschränkungen aus zahlreichen relevanten Denkgebieten so vielschichtig, dass diese Kritik zu kurz greift. Im Zentrum seiner Schriften, das mediale und messianische, romantische und marxistische Figuren bis hin zur Mickey Maus mit höchst unterschiedlichen Intensitäten kurzschloss, steht das unabschließbare und unabgeschlossene Passagen-Werk, das eben seinem beherrschenden Motiv darin treu ist, in einer flanierenden und zugleich grenzüberschreitenden Weise Passagen durch die geistigen Landschaften der irritierenden Großstadtmoderne zu schneiden, wie sie nie zuvor durchschritten wurden. Dieses Werk ist detailversessen bis zu dem Punkt, der ihm hier wie anderenorts Theodor W. Adornos harsche Kritik einbrachte, dieser Fixierung auf die Phänomene dialektisch nicht gewachsen zu sein. Adorno war zwar der größere Kenner der hegelianischen Geschichtsphilosophie, aber Benjamin gerade im Blick auf spätere Anverwandlungen Adornos einiger zentraler Begrifflichkeiten Benjamins der anregendere Denker. Benjamins Programmsatz zu seiner Recherche könnte dieser sein: »Der Chronist, welcher die Ereignisse hererzählt, ohne große und kleine zu unterscheiden, trägt damit der Wahrheit Rechnung, dass nichts was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist.« Dieser hohe Anspruch geht über Prousts Suche nach der verlorenen Zeit, die Benjamin faszinierte, insoweit hinaus, als der Denker diese Phänomene in einem Kontext zu ordnen versuchte, der weder vor den zahllosen Phänomenen noch vor einer geschichtsphilosophisch offenen, ja waghalsigen Deutung zurückschreckte. Jean-Michel Palmier strebte in seiner nun in Deutsch vorgelegten Biografie an, Walter Benjamin in diesen zahlreichen Bedeutungssedimenten zu erfassen und die oft nur als Andeutungen vorhandenen Elemente in ihrer Wechselbezüglichkeit und ihrem produktiven Fortschreibungsanspruch aufzuzeigen. Der Tod griff nicht anders als bei seinem Untersuchungsgegenstand auch in sein Werk ein. Palmier starb 1998 vor der Fertigstellung seines Werks, das im Blick auf mehr als 1300 Seiten indes kaum Fragment genannt werden kann.
© Suhrkamp Verlag Bei Benjamin gelten Denkbewegungen und Details mehr als das Ergebnis, das nicht darin bestehen kann, sich einen ideologisch gefestigten Zugang zur Geschichte zu schaffen. Vieles wurde von Walter Benjamin »angedacht« und – schon im Blick auf die höchst wechselvollen und schließlich katastrophalen Lebensumstände - nicht so entfaltet, wie es ihm selbst angelegen gewesen ist. Insofern hat Jean-Michel Palmier mehr als einen unvollendeten Versuch zurückgelassen, es ist ein notwendiges Werk der Aufklärung über die trotz vieler Interpretationen weiterhin provozierende Verschlungenheit der Benjaminschen Motive.
Angelus
novus ,
1920, 32 »Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der 'Ausnahmezustand', in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht.« Geschichte ist also zuvörderst Katastrophengeschichte. Walter Benjamin ist dabei im Gegensatz zu Ernst Bloch melancholisch bis pessimistisch, ohne deshalb das Projekt »Erlösung« aufzugeben. Von daher liegt es für Biografen nahe, Benjamins thematisch oft eigenwilligen Zugriff auf die Geschichte als eine Konvertierung dieser inneren Zustände zu objektiven Gestalten der Erfahrung zu deuten. Wie anders erklärt sich, dass seine nicht angenommene und zunächst auch publizistisch erfolglose Habilitationsschrift »Ursprung des deutschen Trauerspiels« fernab von aktuellen Diskursen ihr Thema im Barock sucht und festhält: »Ist doch die Einsicht in die Vergänglichkeit der Dinge und jene Sorge, sie ins Ewige zu retten, im Allegorischen eins der stärksten Motive.« Das Werk steht vor der Person Walter Benjamins, der seine stilistische Brillanz einmal damit erklärte, auf das Wort »ich« zu verzichten. So wie er Goethe bescheinigte, sich im Alter als »Kanzlist des eigenen Innern« zu verlautbaren, war Benjamin in seinen Selbstaussagen abstrakt und reserviert genug, um für Biografen schwer genug Rückschlüsse auf seine Befindlichkeiten herauszulesen. Er galt bei Freunden und Bekannten als schüchtern und selbstsicher zugleich, vor allem aber als traurig bis hin zu suizidalen Fantasien. Erst der erlösten Menschheit fällt nach Benjamin ihre Vergangenheit vollauf zu, wenn sie in einer Welt umfassender Instantaneität aufgehoben wird. »Die messianische Welt ist die Welt allseitiger und integraler Aktualität. Erst in ihr gibt es Universalgeschichte. Was sich heute so bezeichnet, kann immer nur eine Sorte von Esperanto sein. Es kann ihr nichts entsprechen, eh die Verwirrung, die vom Turmbau zu Babel herrührt, geschlichtet ist.« Es geht also um Erlösung der Geschichte und der menschlichen Kondition gleichermaßen: »Marx hat in der Vorstellung der klassenlosen Gesellschaft die Vorstellung der messianischen Zeit säkularisiert. Und das war gut so.« Gegenüber der marxistisch schneidigen Entwicklungsdynamik in ihrer Gewissheit eines vom Sein bestimmten Bewusstseins, reagiert Benjamin mit dem eigenwilligen, nicht marxistisch geerdeten Begriff »Dialektik im Stillstand« selbst dialektisch. Die Zeit steht still, das Jetzt tritt aus ihr heraus. Die schlechte Geschichte, der mythisch aufgeladene Fortschrittsprozess werden angehalten, um das Jetzt als erfüllte Zeitform zu erlösen und zugleich die Vergangenheit erinnernd zu bewahren und somit zu retten. Walter Benjamin fasst diesen Vorgang als dialektisches Bild auf, als ein Bild, das Vergangenheit und Gegenwart zu einer Konstruktion zusammenschließt. Dass es dazu kommt, beantwortet sich nicht in einem vorinstallierten Hoffungsprinzip, doch wenigstens gilt: »Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf die Erlösung verwiesen wird.« Benjamins exegetisches Hilfspersonal in seiner Geschichtsbetrachtung, von Jean-Michel Palmier an die prominenteste Stelle gesetzt, sind der Engel der Geschichte, das bucklicht Männlein und der Lumpensammler. Es sind dialektische Figuren, die auf der exklusiven Achse von Jetzt und Vergangenheit vom Bewahren und Vergessen, Retten und Verlieren künden. Der Engel der Geschichte folgt dieser historischen Logik: »Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.« Ein so prekärer messianische Rettungsdiskurs gegenüber der Geschichte, der an jede melancholische Disposition rührt, ist indes vielleicht nicht die einzige Methode, den Nutzen der Historie für das zu rettende Leben zu erweisen. Ein solcher Anspruch der Erlösung liegt wie eine schwere Hypothek auf diesem Geschichtsbild, während ein je ambivalenter Fortschritt gegenüber dem Benjaminschen Verständnis heißen könnte, auf kleine humane Fortifikationen gegenüber den Zumutungen dieser Welt zu bauen, ohne sich wie zu oft in totalisierenden oder eschatologischen Zumutungen zu verlieren. Hilft hier die Mickey Mouse, die Benjamin zufolge »den Traum der heutigen Menschen« verkörpert, weil sie als vollkommene Einheit von »Natur und Technik, Primitivität und Komfort« tabula rasa macht und sich lachend über die technischen Wunder erhebt.
Zur Auratisierung der
Medienwissenschaft Theodor W. Adorno beklagte Walter Benjamins vordergründige Fixierung auf die Technik, weil doch ein kritischer aufgefasster Begriff der Aura allein angemessen wäre, sich gegen die Ideologie der Kulturindustrie zu stellen, demgegenüber das Formgesetz vornehmlich die Kraft habe, sich kritisch gegen die »Aufklärung als Massenbetrug" zu wenden. »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit von 1935 wurde gleichwohl oder eben deshalb zur bekanntesten und wirkungsmächtigsten Schrift Walter Benjamins – »der kanonische Text schlechthin« (Inge Münz-Koenen). Die »Aura« ist mehr als ein Kontextualisierungsverlust des Kunstwerks. Die Entauratisierung in der technischen Reproduktion rührt an dessen Echtheit. Benjamin hielt das für ein epochales Signum, das weit über die Kunst hinausweist. Mit Marshall McLuhan hat er die Auffassung gemeinsam, dass die Sinneswahrnehmung des Menschen sich verändert und es folglich keine rein technischen Veränderungen zu beschreiben gibt, sondern immer um unabsehbare Wandlungen der »aisthesis« geht. Aura prägt die Sinneswahrnehmung, die Benjamin ausdrücklich an der Naturwahrnehmung demonstriert: die »Aura« eines Zweiges atmen. Dieses unmittelbare Welterleben, das sowohl in der Phänomenologie wie in Heideggers Ontologie eine prominente Rolle spielt, löst sich in der Welt der Apparaturen auf: »Der apparatfreie Aspekt der Realität ist hier zu ihrem künstlichsten geworden und der Anblick der unmittelbaren Wirklichkeit zur blauen Blume im Land der Technik.« Sicher war diese zeittypische Klage auch für Benjamin nicht ohne eigenen sinnlichen Anlass verfasst worden, da er nicht nur über Sammler schrieb, sondern auch selbst leidenschaftlich bibliophile Bücher, Spielzeug und Postkarten sammelte. Als Kenner der Frühromantik war ihm das exemplarische Zitat von Novalis geläufig: »Jeder geliebte Gegenstand ist Mittelpunkt des Paradieses.« Für Benjamin waren das keine peripheren Marotten, wenn der Sammler tief in die Dinge eindringt, »nicht nur im dürren Anundfürsich«, sondern wenn die Dinge »zusammenklingen«. Reproduzierbarkeit heißt Verfall dieser originären Sinnlichkeit, Verlust von unmittelbarer Wirklichkeit und ihren (bisher) nicht reproduzierbaren Erfahrungsmöglichkeiten. Das Einmalige verliert seinen Status. Der Gegenstand wird gleichsam herausgeschält aus seinem authentischen Erfahrungszusammenhang. Die Vermassung der Wahrnehmung durch die wahrnehmenden Massen wird zur folgenreichen Entfernung vom Erleben des originalen, traditionsgeprägten Kunstwerks und seiner bürgerlichen Rezipienten. Folgenreich bleibt seine Beschreibung der Choc-Wirkung des Films, der keine Assoziationsräume zwischen den Bildern in ausreichendem Maße eröffnet, sondern vor der Entstehung des Gedankens das Bewusstsein mit Bildern zuschüttet. Andererseits gewährt der Film eine »Vertiefung der Apperzeption«, geht also präziser, tiefer und intensiver mit seiner Wirklichkeit um, als es etwa die Malerei vermag. Doch in welchem Verhältnis stehen Film und Politik, Massenkunst und Gesellschaft zueinander? Georg Lukács, dem Benjamin in mancherlei Hinsicht verbunden war, beschrieb den Film als »Produkt des Kapitalismus« mit der Folge, »dass die ganze Filmproduktion den kapitalistischen Interessen bedingungslos untergeordnet ist«, ohne den Effekt der Massenrezeption zu verkennen. Walter Benjamin hat, fundamental anders als Adorno, den Film als Massenkunst verteidigt: »Zu keinem, wenn auch noch so utopischen Zeitpunkte, wird man die Massen für eine höhere Kunst sondern immer nur für eine gewinnen, die ihnen näher ist.« Film als Zerstreuung für die Massen plädiert aber nun nicht für die Kulturindustrie, sondern wird auf die »Apperzeption« zurückbezogen. Bestimmte Aufgaben könnten nur in der Zerstreuung geleistet werden, was Benjamin als Chance erkennt, mit dem Film Massen über veränderte Wahrnehmungsformen zu mobilisieren. Cyberspace, Simulacrum, Virtualität sind heute zu so selbstverständlichen wie unreflektierten Begrifflichkeiten geworden, die Benjamins Kritik weit über das hinaus tragen, was zuvor als technische Reproduzierbarkeit in Fabriken, Warenhäusern oder Filmpalästen paradigmatisch wurde. Andererseits liegt hier auch die crux des Ansatzes, der wesentlich vom Verfall von Erfahrungsweisen handelt, ohne die hinzutretenden Momente einer neuen, technisch zu generierenden Erfahrung immer schon hinreichend erkennen zu können. Gerade die technisch avancierte Virtualität will Erfahrungen aufschließen, die in ihrer ästhetischen Direktheit nicht hinter dem kontextgebundenen Originärerleben zurückstehen wollen. Wir erleben, dass nach der Demontage alter Authentizitäten neue Erfahrungs- und Erlebnisweisen wiederum deutlich machen, dass es immer um Vermittlung geht, was auch für Benjamins Beispiele des echten Naturerlebens gilt, die eben nur durch Sinne bzw. Sinnesorgane medialisiert, also apparativ wirksam werden. Füllt die Technik nicht diese Lücke, die sie schlägt, mit immer neuen technischen Möglichkeiten wieder? Der Benjaminsche Diskurs könnte dann selbst im Angesicht einer übermächtigen Technik antiquiert werden, was indes nicht ein bloßer Makel ist, sondern zum Stigma von später Theorie schlechthin wird: Die technisch generierten Phänomene gewähren keine notwendigen Eingewöhnungszeiten mehr, sondern vor ihrer gestischen Inbesitznahme durch Menschen verwandeln sich nicht nur ihr Gesicht, sondern Funktion und Anschlussmöglichkeiten. Mediale Aneignung steht unter diesem Veränderungsdruck, der jedenfalls drastisch vor Augen führt, dass die frühen Einschätzungen des Films durch Benjamin einer avancierten Medienwissenschaft allenfalls noch Anregungen bieten können, die vor allem darin bestehen, die polyvalenten Wirkungen eines Mediums nicht im vorschnellen Theoriediskurs einzuschmelzen. Selbst Theodor W. Adorno hat später einmal eingestanden, das Verdikt gegen die Kulturindustrie im Blick auf weitere Entwicklungen zu fundamentalistisch vorgetragen zu haben. Der eher tastende, offene Duktus des Benjaminschen Denkens, wie ihn Jean-Michel Palmier angemessen rekonstruiert, besitzt weiterhin die größere historische Strahlkraft als die blendende Rede vom »Verblendungszusammenhang« der selbst heute als Ausblendung von kulturellen Effekten zu lesen ist.
Warum Walter Benjamin? Es gibt bei Walter Benjamin und das demonstriert Palmier sehr schön, eine höchst eigenwillige Lektüreliste, die sich vielen Diskussionen der damaligen Zeit verschließt. So interessieren ihn die Neokantianer nicht, die Universitätsphilosophie hat bei ihm keinen prominenten Stellenwert und selbst die philosophische Beziehung zu Marx, Engels et alii ist nicht so intim, wie einige Begeisterungen Benjamins für diese weiland so unvergleichlichen Zugriffen auf die Geschichte signalisieren könnten. Benjamin ist deswegen als Denker attraktiv geblieben, weil er zahlreiche Pole für sein Denken schafft. Hier gerät die Spannung zwischen ihnen dynamischer als bei diversen zeitgenössischen Philosophen, die dann etwa in den Sog des Seins des Seienden geraten und ein Fetischobjekt der Philosophie zeugen, von dem nicht bekannt ist, wie es erlösungstechnisch probat anzubeten ist. Ohnehin liegt hier das Geheimnis philosophischer Produktivität. Die Wahrheit ist nicht überzeitlich um einen Gedanken herum zu fixieren. Die postklassische Wahrheitsliebe demonstriert sich vielmehr als Risikogeschäft, das mit vielen Denkfiguren betrieben eine bessere Chance hat, wenigstens vorübergehend plausibel zu sein.
Walter Benjamin ist – paradox formuliert - kein
dogmatischer Parteigänger seiner Gedanken geworden. So sind seine Optionen, ohne
je in die Beliebigkeit abzurutschen, nie von der Angst geprägt, Kohärenzen da
prätendieren zu müssen, wo sie einer materialistischen Theorie unabdingbar
erscheinen. Das Passagenwerk ist daher nicht Fragment geblieben, weil das Leben
in das Werk eingriff, sondern weil es unter den konkreten Bedingungen nicht zu
einem Ende gebracht werden konnte. Wer Lumpen sammelt, muss mit eigenartigen
Kollektionen leben. So mag es sein, dass der »Kreuzpunkt von Magie und
Positivismus« wie Adorno fand, »verhext« sei, aber das ergibt sich nicht nur aus
den Ingredienzien einer jener Zeit ungenießbaren Mischung, sondern aus Benjamins
Risikobereitschaft als Denker. Denn längst würden wir nicht mehr Adorno Glauben
schenken, dass alleine Theorie den Bann bricht, sondern viel eher Benjamin
folgen, dessen Werk weder die fatale Zuspitzung marxistischer Kategorien
vollzieht noch auf die provokante, sperrige Faktizität der Gegenstände
verzichtet. Hier wird der Hinweis Palmiers wichtig, dass Benjamin diesen Zugriff
der Theorie auf das Fundstück, das Fragment, die Monade oder den »Lumpen«
durchaus als gefahrbringend ansah, die Dinge zum Verstummen zu bringen, ihre
»Inkommensurabilität« zu liquidieren. Adornos Geschichts- und
Kunstinterpretationen erscheinen in all ihrer Feingliedrigkeit doch oft genug
wie Schaustücke einer philosophischen Risikovermeidungsstrategie, die im Vollzug
ihrer Methode höchst kommensurabel auftritt, während Benjamins heterogene
»Lumpensammlungen« ihren erratischen Charakter nicht leugnen. Das »Passagenwerk«
bleibt das beste Beispiel eines fruchtbaren Scheiterns, das darin zum Beweis der
Methode und ihrer längst nicht eingelösten Wahrheit wird. Die Totalität der Welt
wird von den Fragmenten und Monaden in Abrede gestellt, die aus
unterschiedlichsten Gründen (noch) nicht von der Kritik gerettet wurden. An
dieser Stelle bleiben metaphysische respektive messianische Hoffnungen bestehen,
die sich nicht auf ein reines Dasein als kritische Instrumente bescheiden
können. »Wahre Versöhnung gibt es in der Tat nur mit Gott«, heißt es in dem
Essay zu den Wahlverwandtschaften. Insofern hat Benjamin, auch und gerade in
seiner Auseinandersetzung mit kulturellen wie technischen Erscheinungen der
Massengesellschaft eine offenere Wahrheit präsent als diverse Ansätze der
kritischen Theorie, die sakrosankt das einfordern, was sie zuvor historisch
endgültig ratifiziert hatten. Hier liegt der genuine Grund für die weiter
bestehende Aktualität Walter Benjamins, die sich in einem Werk einlöst, das
zahlreiche, auch ambivalente Anschlussstellen bereithält, um selbst von ihm
nicht antizipierte Umstände mit der spezifischen Diskursivität des Benjaminschen
Denkens zu erfüllen. Auch und gerade nach dem Werk Palmiers wird es so bleiben,
dass jeder seinen eigenen Benjamin haben darf und dieser Denker viele Figuren
gleichen Namens neben sich duldet. Denn in der vorliegenden Darstellung wird
Benjamin nicht unwiderruflich in eine von vielen Geistesrichtungen, die mit
diesem Autor assoziiert werden können, verräumt, um dem Biografen ein ephemeres
heuristisches Erlebnis zu verschaffen, ohne in der nächsten Aktualisierung zu
überdauern. Palmier operiert biografisch, wandert über die Hauptachse »Ästhetik
und Politik« und lässt sich von den allegorischen Figuren Benjamins leiten, um
eben diese auch zu deuten. »Gerade jedoch weil Gewinn und Verlust eines solchen
Denkens inzwischen, nach Jahren der Apologie, viel kritischer betrachtet werden,
hätte der Interpret sich vor der allzu lange geübten Praxis hüten müssen,
Benjamin selbst mit seinen allegorischen Gestalten zu identifizieren«, merkt
Wolfgang Matz allerdings zu Recht in der FAZ an. Im Gegensatz hierzu scheint uns
aber nicht die »Entmythologisierung und strikte Historisierung Benjamins« einer
weiteren Forschung zuvörderst angelegen sein zu müssen, sondern die Frage, ob
das geschichtsphilosophisch und dialektisch produktive Verhältnis Benjamins zu
den Dingen nicht eine seltene Kunst ist, die unter veränderten Auspizien ihren
eigenen Geltungsanspruch behält. An Stelle der Aktualisierung Benjamins und
philologischer Eitelkeiten der Interpreten wäre die Lektüreerfahrung eines
gewitzten Denkers als Versprechen und Anregung zu bewahren, in diesen und
anderen Zeiten der eigenen historischen Wahrnehmung und ihren Idiosynkrasien
mehr zu vertrauen als großer Theorie. So mögen im Übrigen immer wieder neue
Passagen zu diesem Werk und seinem Bewohner gesucht werden, das somit schon im
Blick auf seine eigene Rezeptionsgeschichte seinen Anspruch einlöst.
Goedart Palm |
Jean-Michel Palmier |
||
|
|
||||

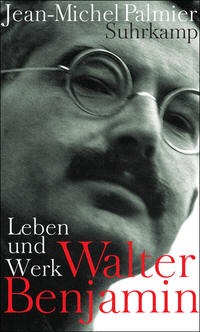


 Walter
Benjamin
Walter
Benjamin