|
Glanz & Elend Magazin für Literatur und Zeitkritik |
|
||
|
Home Das Beste Literatur Blutige Ernte Sachbuch Bilderbuch Zeitkritik Termine Preisrätsel Impressum Mediadaten Andere über uns | |||
|
Bücher & Themen Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Rubriken Belletristik - 50 Rezensionen Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Geschichte Epochen, Menschen, Phänomene Politik Theorie, Praxis & Debatten Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Sprechblasen Comics mit Niveau Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Film Neu im Kino Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré
de Balzac Honoré
de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Das paradoxeste aller paradoxen Lebewesen des alten Deutschlands nannte ihn die Zeitung „Die Republik“ in einem Artikel vom 19. Dezember 1918. Andere Spottnamen bezeichneten den 1867 als ältester Spross einer deutsch-jüdischen Unternehmerfamilie geborenen Walther Rathenau noch bissiger als einen modernen „Franziskus von Assisi“ oder sogar als den „Jesus im Frack“. Der österreichische Schriftsteller Robert Musil karikierte ihn in seinem Jahrhundertroman als „Mann ohne Eigenschaften“ und sein Landsmann Stefan Zweig sprach von einem „amphibischen Wesen“ zwischen Kaufmann und Künstler. Rathenau (alias Dr. Paul Arnheim) selbst fühlte sich zeit seines Lebens als verkannter Außenseiter, der am Ende des Ersten Weltkrieges resignierend einräumte: „Den Genossen meines Alters habe ich nicht mehr viel zu sagen.“ Viele hätten seine Schriften gelesen, so klagte er, die Gelehrten, um sie zu belächeln, die Praktiker, um sie zu verspotten und die Interessierten, um sich zu entrüsten. Nach der jetzt von dem Frankfurter Historiker Lothar Gall vorgelegten Biografie des intellektuellen Großindustriellen war Walter Rathenau zwar ein überaus vielseitiger Mann, aber in keiner Sphäre der sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ausdifferenzierenden Gesellschaft wirklich heimisch. Dass er nur halbherzig der Welt der Industriebarone angehören wollte, verzieh man ihm dort nicht. Wohl daher blieb ihm auch die vielleicht nie wirklich angestrebte Krönung seiner industriellen Laufbahn, der Vorstandssessel der bedeutenden Allgemeinen Elektricitäts Gesellschaft (AEG), versagt. In publizistischen Kreisen wiederum gelang es ihm trotz zahlreicher illustrer Kontakte und sogar Freundschaften zu Persönlichkeiten wie Harry Graf Kessler oder Maximilian Harden nie richtig Fuß zu fassen. Man bestritt dem gut situierten Verfasser mehrerer durchaus beachtlicher Schriften über die Umbrüche der Moderne die Ernsthaftigkeit seiner Absichten und schlimmer noch, den substanziellen Kern seiner Botschaften. Auch seine jüdische Herkunft bot dem rastlosen Wanderer zwischen den verschiedenen Subwelten keine emotionale Heimat, hatte er es doch in seiner ersten noch anonym verfassten Schrift „Höre Israel“ für richtig befunden, von einer asiatischen Horde auf märkischen Sand zu sprechen und seinen „Glaubensbrüdern“ dringend empfohlen, sich endlich der europäischen Kultur zu assimilieren. Der Mann mit den vielen Talenten war tatsächlich, wie es Gall treffend resümierte, der Mann ohne Eigenschaften. Der Autor skizziert das Bild einer Persönlichkeit, der sich wie viele in seiner Generation nicht allein von den glänzenden Leistungen ihrer Väter emanzipieren wollte, sondern auch gegen den plumpen Wilhelminismus der Hochbürokratie, Militärs und Großagrarier mit ihren auftrumpfend-hohlen Lebensäußerungen engagiert Stellung bezog. „Seelenlosigkeit“ war ein Schlüsselbegriff seiner Schriften. Rathenau betrachtete das Alte, das seiner scheinbar privilegierten Generation nur ein bequemes politisches Rentnerdasein verhieß, als überlebt und hinfällig. Doch welche konkrete Gestalt dieses so sehr ersehnte Neue annehmen sollte, vermochte er wie die meisten seiner Weggenossen nicht zu sagen. Der Sohn des AEG-Gründers bewegte sich damit genau auf dem viel zitierten Sonderweg der Deutschen, wenn er jenseits von Parlamentarismus, mechanisierter Lebenswelt und westlichem Materialismus einen Daseinssinn suchte, in dem sich Staat und Gesellschaft, ganz im Sinne Hegelscher Tradition zu einer wahren substanziellen Gemeinschaft formieren sollten. Doch der deutsche Gegenentwurf zum politischen Westen blieb eine Chimäre und mutierte schließlich zur Monstrosität des Faschismus. Wie seine ganze Generation, so schreibt Gall, war Rathenau auf tragische Weise zum Scheitern verurteilt. Der 1914 ausbrechende Weltkrieg erwies sich gerade für sie als Urkatastrophe und das Attentat, das dem Leben des Außenministers einer fragilen Republik am 24. Juni 1922 ein gewaltsames Ende setzte, war vielleicht schon eine resignierend in Kauf genommene Tat. In seiner recht knapp gehaltenen Biografie hat sich Gall auf die wichtigsten Lebensstationen seines Protagonisten beschränkt, um Rathenau als eine Persönlichkeit zu schildern, in der sich die zahlreichen Widersprüche seines bürgerlichen Zeitalters in besonderer Dichte gespiegelt haben. Als Leser war man durch den Untertitel, der vom Porträt einer Epoche spricht, bereits darauf eingestellt, dass nicht allein Rathenau im Focus der Betrachtung stehen würde. Gleichwohl irritiert es doch, wenn Gall weitgehend gelöst von Rathenaus Vita zunächst auf Dutzenden von Seiten im Stile einer propädeutischen Vorlesung über das bürgerliche Zeitalter gegen Ende des 19. Jahrhunderts doziert. Das alles liest man nicht unbedingt mit Gewinn. Nur wer sich mit langem Atem durch ein Konvolut von professoralen Bandwurmsetzen, gespickt mit unnötigen Wiederholungen, durchkämpft, gelangt schließlich in der zweiten Hälfte des Buches zu dem Punkt, wo der Autor endlich von seinem offenkundig thematischen Steckenpferd ablässt, um sich nun wirklich der Vita Rathenaus zuzuwenden. Hier wird der Text auch stilistisch deutlich besser und der Leser fühlt sich nun nicht mehr in einen Hörsaal versetzt, wenn es wie zuvor, zum wiederholten Male im Text heißt: „Wie schon gesagt“ oder „Davon wird noch die Rede sein“.
Am Ende der Lektüre kennt
man nun zwar die wesentlichen Aspekte dieses auf tragische Weise beschlossenen
Lebens, über die privaten Verhältnisse Rathenaus erhält man jedoch nur dürftige
Auskünfte. Eine echte Biografie, die zugleich immer auch fesselnde Narration
sein muss, ist Gall nicht gelungen. Vielleicht wollte sie der emeritierte
Professor, den man noch als Verfasser einer glänzenden Bismarck-Biografie in
Erinnerung hat, auch gar nicht schreiben, dem Leser hat er mit dieser
zwitterhaften und ganz offenkundig aus verschiedenen Manuskripten
zusammengeschusterten Publikation keinen Gefallen erwiesen. |
Lothar Gall |
|
|
Bookmark:
|
|||

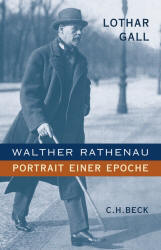 Der
Mann ohne Eigenschaften
Der
Mann ohne Eigenschaften