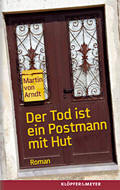|
Bücher & Themen
Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Rubriken
Belletristik -
50 Rezensionen
Romane, Erzählungen, Novellen & Lyrik
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Geschichte
Epochen, Menschen, Phänomene
Politik
Theorie, Praxis & Debatten
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Sprechblasen
Comics mit Niveau
Autoren
Porträts,
Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Film
Neu im Kino
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Berserker und Verschwender
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Literatur in
Bild & Ton
Literaturhistorische
Videodokumente von Henry Miller,
Jack Kerouac, Charles Bukowski, Dorothy Parker, Ray Bradbury & Alan
Rickman liest Shakespeares Sonett 130
Thomas Bernhard
 Eine
kleine Materialsammlung Eine
kleine Materialsammlung
Man schaut und hört wie gebannt, und weiß doch nie, ob er einen
gerade auf den Arm nimmt, oder es ernst meint mit seinen grandiosen
Monologen über Gott und Welt.
Ja, der Bernhard hatte schon einen
Humor, gelt?
Hörprobe
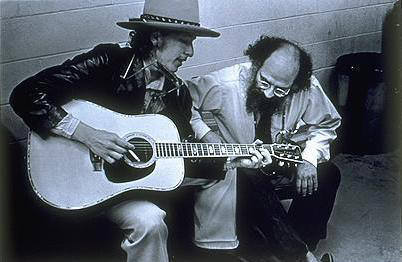
Die Fluchtbewegungen des Bob Dylan
»Oh
my name it is nothin'/ My age it means less/ The country I come from/
Is called the Midwest.«
Ulrich Breth über die
Metamorphosen des großen Rätselhaften
mit 7 Songs aus der Tube
Glanz&Elend -
Die Zeitschrift
Zum 5-jährigen Bestehen
ist
ein großformatiger Broschurband
in limitierter Auflage von 1.000
Exemplaren
mit 176 Seiten, die es in sich haben:
Die menschliche
Komödie
als work in progress
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
Zu diesem Thema haben
wir Texte von Honoré de Balzac, Hannah Arendt, Fernando Pessoa, Nicolás
Gómez Dávila, Stephane Mallarmé, Gert Neumann, Wassili Grossman, Dieter
Leisegang, Peter Brook, Uve Schmidt, Erich Mühsam u.a., gesammelt und mit den
besten Essays und Artikeln unserer Internet-Ausgabe ergänzt.
Inhalt als PDF-Datei
Dazu erscheint als
Erstveröffentlichung das interaktive Schauspiel »Dein Wille geschehe«
von Christian Suhr & Herbert Debes
Leseprobe
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Neue Stimmen
 Die
Preisträger Die
Preisträger
Die Bandbreite der an die 50 eingegangenen Beiträge
reicht
von der flüchtigen Skizze bis zur Magisterarbeit.
Die prämierten Beiträge
Nachruf
 Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor Wie
das Schachspiel seine Unschuld verlor
Zum Tod des ehemaligen Schachweltmeisters Bobby Fischer
»Ich glaube nicht an Psychologie,
ich glaube an gute Züge.«
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«
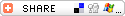


|
Wenn die Tage zappeln
Lothar Struck über Martin von Arndts lesenswerten neuen Roman »Der Tod ist ein
Postmann mit Hut«
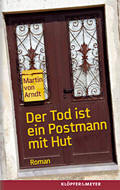 An
jedem ersten Mittwoch im Monat erhält Julio C. Rampf ein Einschreiben.
Die Zustellung ist inzwischen längst ritualisiert: das tragbare Terminal
mit dem Stift, der aussieht wie ein krumm geschlagener Zimmermannsnagel,
die gewagte…und doch für zu leicht befundene Unterschrift Julios, der
Zeigefinger des Postboten, der flüchtig an seine Kopfbedeckung, einen
Tirolerhut fährt, der Wachholderschnaps im Stamperl, das erneute
leichte Berühren des Hutes mit dem Zeigefinger und schliesslich die Drehung
auf der Schwelle beim Verlassen der Wohnung. Und auch der Inhalt dieses
anonymen Einschreibens ist stets gleich: ein einmal gefaltete[s] leere[s]
Blatt. An
jedem ersten Mittwoch im Monat erhält Julio C. Rampf ein Einschreiben.
Die Zustellung ist inzwischen längst ritualisiert: das tragbare Terminal
mit dem Stift, der aussieht wie ein krumm geschlagener Zimmermannsnagel,
die gewagte…und doch für zu leicht befundene Unterschrift Julios, der
Zeigefinger des Postboten, der flüchtig an seine Kopfbedeckung, einen
Tirolerhut fährt, der Wachholderschnaps im Stamperl, das erneute
leichte Berühren des Hutes mit dem Zeigefinger und schliesslich die Drehung
auf der Schwelle beim Verlassen der Wohnung. Und auch der Inhalt dieses
anonymen Einschreibens ist stets gleich: ein einmal gefaltete[s] leere[s]
Blatt.
Julio ist 40, Deutscher und lebt in Innsbruck mehr schlecht als recht als
Gitarrenmusiker. Paintner, der Musikproduzent mit den schlechten Witzen, nahm
ihn trotz oder vielleicht gerade wegen seiner roten, verschorften Hände für
seine skurrilen Projekte, wie zum Beispiel Klassiker der Unterhaltungsmusik
für chinesische Schnellimbisse zu bearbeiten. Nach mehr als 20 Jahren wurde
Julio von seiner Frau Ines verlassen, was ihn deprimiert und verstört. Und dann
auf einmal diese Einschreiben. Anfangs noch als einen harmlosen Irrtum
betrachtet, der sich schnell durch den "richtigen" Versand aufklären würde,
beginnt Julio die Impertinenz dieser anonymen Post zu beunruhigen aber auch zu
faszinieren. Und so nebenbei verändert sie sein Leben.
Der Ich-Erzähler Julio hat bei oberflächlicher Betrachtung zunächst durchaus
etwas von einer prekär-modernen Version eines Prinz Leonce oder Oblomows. Er
verbringt auch schon einmal seine Tage im Bett und zelebriert seine Langeweile.
Wiederkehrend und unversehens, fast anfallartig seine Mutlosigkeit.
Sie überkommt ihn beim Schuheputzen, bei häuslichen Kleinreparaturen. Alles
wird schwarz, alles wird schwer, unerträglich schwer, zu schwer für mich,
unerträglich für mich…ich halte dieses Leben, mein Leben schlechthin, nicht mehr
aus. Nach landläufiger Diktion würde man ihn als depressiv einstufen – und
auch wieder nicht, denn er stemmt sich sehr wohl gegen dieses Gehenlassen und
beginnt ein "Nächtebuch" zu schreiben, zaghaft, mit müden
Gedanken. Er versucht, die Zeit urbar zu machen und irgendwann
dreht sich die Welt nur noch um diese Zeilen.
Der zappelnde
Tag
Martin von
Arndt widersteht der Versuchung, über den Umweg des "Nächtebuchs" seinen
Protagonisten vor- und damit gleichzeitig auszustellen. So entgeht er der
Gefahr, Julio als exotischen Sonderling einzuplüschen (gewisse Parallelen zu den
melancholischen Voyeuren eines Wilhelm Genazino sind allerdings vorhanden) oder
einfach nur als eigenbrötlerischen Faulpelz mit Messi-Qualitäten zu denunzieren.
Charakterisiert wird die Hauptfigur indirekt durch dessen scharfe Wahrnehmung,
die manchmal jäh aufblitzt. Da starren dann die Berge zurück, ein Tag
zappelt wieder, es war so kalt, dass selbst de[m] Zug fröstelte, der
Sommer begann den Frühling aufzufressen oder die Fliegen unter der Decke
bilden Insektensütterlin.
Die Lebenserschöpfung wird unprätentiös erzählt und nicht nur behauptet. Sie
wird durch Ines' Verlassen nicht direkt ausgelöst, aber potenziert. Nur ein paar
Monate nach der Beerdigung von Julios Mutter (in feinen, kurzen Szenen wird das
fragile Mutter/Sohn-Verhältnis erzählt) trennte sie sich von ihm endgültig –
inklusive Scheidungsurkunde in mehreren Kopien. Seitdem zählt er die Tage, wann
sie zuletzt mit Rosenwasser die Blumen besprühte und behandelt ihre
zurückgebliebenen Gegenstände wie Fetische. Residuen eines Lebens, welches
ansonsten in zwei schwere[n] schwarze[n] Müllsäcken "ausgemistet" wurde.
Ines war die erste Frau in meinem Leben, die mich nicht nach meinem Vater
beurteilt hat. Julios Vater, der sich in der Lebensmitte, auf dem
Höhepunkt seiner Karriere erschossen hatte (seitdem ist Karriere Un-Wort und
Un-Möglichkeit zugleich), machte den damals 16jährigen mit einem Schlag für die
Mädchen "interessant".
Aber Ines war anders.
Nicht wie die Freundinnen vorher, die ihre Küsse nicht ohne Gegenleistung
erbringen wollten (um Informationen über den Tod des Vaters zu erhalten). Im
blonden Flaum auf ihren Armen verfingen sich die Sonnenstrahlen; sie
duftete nach Kakao. Auch nach dem Musikstudium bestritt Ines mit ihrem
Laborantinnengehalt weitgehend den Lebensunterhalt der beiden. Der inzwischen
entstandene Teufelskreis aus mangelndem Ehrgeiz Julios (gepaart mit eventuell
ungenügendem Talent) und hieraus fast zwangsläufig ausbleibendem Erfolg
(pekuniär wie künstlerisch) führte immer mehr zu Spannungen. Während Julio nicht
erwachsen werden kann (oder will), entwächst Ines dem Mikrokosmos ihres Mannes.
Und sie geht zu "ihrem" Juwelier. Aber mit Ines "verliert" Julio nicht einfach
"seine" Frau, sondern den Menschen, der ihm Nabelschnur zur Welt war und wenn er
von Ines und seinem Leben mit ihr erzählt, gelingt ein wunderbar melancholischer
Ton (mit oft sehr schönen Bildern) jenseits aller Trennungsschmerzklischees,
Jammereien oder vorwurfsvollem Nachkarten (und auch dann noch, wenn von Ines'
Idiosynkrasien die Rede ist, die sie zwischenzeitlich zu einem Therapeuten
führten).
Verdächtige und
Nachforschungen
Als die
Einschreiben regelmässig eintreffen, macht Julio eine Liste von verdächtigen
Personen, die für einen solchen Streich infrage kämen und ist überrascht, dass
er nur auf drei Namen kommt (Ines streicht er sofort wieder). Er sucht diese
Personen auf. Der Hausbesorger ist unbekannt verzogen. Hardy, Julios
Intimfeind, der ihm schon immer auf dem Schulweg auflauerte, ist dement und
dämmert in einem Heim vor sich hin. Ines' ehemaligen Therapeuten, damals ihr
Verehrer mit eindeutigen Angeboten, sucht er unter dem Vorwand einer
Mausphobie auf um dann schnell festzustellen, dass dieser Mann ebenfalls als
Täter ausscheidet.
Nachforschungen bei der
Post scheitern bereits an der Bürokratie der Behörde: Der offizielle Weg war
eine Sackgasse. Einer der Sätze in diesem Buch mit gewollt doppeltem Boden:
Beschreibung einer tatsächlichen Situation aber eben auch Allegorie. Schließlich
sucht Julio die Polizei auf. Aber die Angelegenheit wird nicht verfolgt: von
einem leeren Blatt gehe kein Bedrohungspotential aus. Der Polizist rät
ihm mit einem Pensionisten, dem Steinbichler Koloman, der auch noch in
der Nachbarschaft wohnt, Kontakt aufzunehmen. Der Steinbichler sei Spezialist
gewesen für "ungewöhnliche Fälle" und habe Zeit und vielleicht
Interesse.
Julio sucht Koloman, der
den Spitznamen Grantler hat und dessen Frau ihn gerüchteweise genau
deswegen verlassen haben soll, auf. Ein Hüne, ein Vier-Zentner-Mann mit zwei
schweren mütterliche[n] Brüste[n]…die in einem überreifen Bauch mündeten,
dem das Atmen hörbar schwer fällt und dessen Cocker Spaniel "Tadzio"
(sic!) auf Julios Bein fixiert ist. Koloman wird ein bisschen wie eine
brummend-austriakische Colombo-Persiflage skizziert (er trägt fast immer das
gleiche Hemd und fährt ein schrecklich altes Auto) und erinnert optisch
tatsächlich zunächst an die Karikaturen von Manfred Deix (insbesondere am
Stammtisch mit den Ehemaligen, den der Pensionär eigentlich meidet). Aber
Koloman ist ein Leser: "Vom Alkohol bin ich runter. Von Büchern noch nicht"
und es zeigt sich, wie schnell Äußerlichkeiten nebensächlich werden.
Der Pensionist ist dankbar um die Abwechslung, die der Fall in sein Leben bringt
und für Julio entwickeln sich die Ereignisse um die Einschreibebriefe immer mehr
zum Lebensmotor. Da spielt es auch keine Rolle, dass alle kriminaltechnischen
Methoden (Fingerabdrücke, Spuren- und Abdrucksuche auf dem Schreiben, Suche nach
Geheimtinte, Geschmacks- und Geruchsproben) nicht weiterführen. Koloman setzt
noch einen Freund auf das zu erwartende Postamt an (es gibt einen Turnus bei den
Abgabestädten) – aber der scheitert letztlich auch.
"Tät dir vielleicht auch
mal ganz gut"
Diese beiden
Versehrten finden über diesen Fall zueinander und erkennen, so unterschiedlich
Alter, Lebenslauf, Herkunft und Körperfülle auch sein mögen, Sympathie und
Respekt füreinander. Es entwickelt sich eine herzliche aber
unspektakulär-lakonische Freundschaft; man kocht und musiziert miteinander.
Julio will mit ihm sogar auf Tournee gehen (hierfür sagt er Paintners Pläne ab);
der Dicke spielt Posaune. Sein Lieblingsstück ist "Eleanor Rigby" von den
Beatles (eines der "18 Kostbarkeiten" Julios; einer Art persönlicher
musikalischer Bestenliste). Und Koloman zeigt ihm Akte und Vernehmungsprotokoll
seines letzten Falles, der ungelöst blieb (was gehörig an seinem Ego kratzt).
Von Arndt breitet in drei Phasen dieses Verhörprotokoll als Binnenerzählung aus.
Es wird in Form einer Tonbandtranskription (die Fragen der Polizei bleiben
ausgespart; man muss sie anhand der Antworten rekapitulieren) die Geschichte
einer zufälligen Straßenbekanntschaft zwischen Gregor B. und Anna aus der Sicht
Gregors entwickelt. Gregor B. zieht mit Anna, die enorme Mengen Alkohol
konsumiert und sich überall und im Laufe des Abends immer stärker verfolgt fühlt
in einer wahren Odyssee durch Bars und Restaurants. Irgendwann betreten beide
Annas Wohnung (oder das, was man dafür hält). Es kommt zu einem schrecklichen
Verbrechen. Gregor wird ebenfalls schwer verletzt. Die Tat kann ihm genauso
wenig nachgewiesen werden, wie die Theorie, Gregor habe sich zur Verschleierung
seine die Verletzungen selbst zugefügt oder einfach Selbstmord begehen wollen.
Koloman überlässt Julio dieses Verhörprotokoll mit der seltsamen Aussage "Tät
dir vielleicht auch mal ganz gut" und er sehe gewisse Ähnlichkeiten
zwischen dem Tatzeugen und das nicht nur, weil Gregor ein Deutscher
und wegen einer Frau nach Innsbruck gekommen war. Schliesslich hatte bei
Julio die Neugier gesiegt und er begann zu lesen. Danach wird zwischen
den beiden der Fall nicht mehr angesprochen. Der Wert der scheinbar willkürlich
in den Roman eingebrachten Szenerie erschließt sich dem Leser zunächst in der
Kontrastierung zur Julio-Geschichte. Koloman demonstriert durch die Übergabe
dieses Protokolls seine Freundschaft dem jungen Musiker gegenüber. Für Julio ist
die Lektüre nicht nur ein interessanter Einblick in einen fortgeschrittenen
Verfolgungswahn, sondern auch (und vielleicht vor allem) der Anfang von dem, was
man früher einmal "Seelenbildung" nannte (bevor dieser Begriff von esoterischen
Kitschkolumnisten usurpiert wurde).
Koloman, der Mann mit dem
manchmal strengen Geruch, der plötzlich neue Schuhe in der Wohnung einläuft, ist
krank. Die Symptome werden schlimmer, die Frequenz der Morphiumpflaster nimmt zu
und die Tournee rückt in weite Ferne. Aus dem Krankenhaus entlässt er sich
selber. Als Koloman…das Wasser endlich zum Herzen gestiegen war, hatte
das Gras auf den innerstädtischen Rasenflächen …längst aufgegeben, war grau,
hatte sich niedergelegt. […] Die Wespen wurden vor der Zeit böse. Und die
Menschen waren es und blieben es.
Julios zwischen dem Gefühl, ein Versager zu sein und dem befreienden Gedanken,
den Einschreiben nicht mehr ausgeliefert zu sein. Die Möglichkeit eines
"Lebens" spielt sich plötzlich zwischen den Einschreiben ab; ein Leben, das sich
mit Sinn erfüllen lässt. Die Briefe werden zu Motivationsschreiben;
die Bedrohung hat sich (in Zuversicht?) verwandelt. Und Julio mit Tadzio auf der
Strasse hinein ins Verheißungsvolle. Da ist man geneigt von einem
Entwicklungsroman zu sprechen, ihn mindestens zu ersehnen.
Beim Hören von James' "Getting away with it" der schönste Satz des Buches, vom
Grantler geschrieben, in seiner scheinbaren Nebensächlichkeit doch ins Mark
treffend: Gerade habe ich beim Fenster rausgeschaut. Ich glaube, es wird ein
guter Tag, obwohl ich ihn überhaupt nicht leiden mag.
Intensität und Ironie
Von Arndt
erschafft Bilder von großer Intensität und Schönheit. Um das gelegentlich
drohende Pathos zu bannen, ist der Roman (mit Ausnahme der Verhörprotokolle) von
einem feinen, kunstvollen Ironiefaden durchzogen. Julios Befindlichkeiten sind
bar jeder Larmoyanz; die Figur des Koloman wird in heiterer Gravität erzählt
(und ohne billige Klischees was den vermeintlichen österreichischen
Provinzialismus angeht). Ein glatter, idyllischer Schluß gibt es in diesem
Roman, der fast wie eine oppulente Novelle (die allerdings nicht linear erzählt
wird) erscheint, nicht. Vieles bleibt (absichtsvoll) schwebend und man ist
verblüfft, wie beim zweiten Lesen plötzlich immer weiter neue Facetten (und neue
Intertextualitäten) aufscheinen.
Die jeweilige Stimmung der Protagonisten, die von Arndt durch Setzung von Musik
(sei es zufällig aus dem Radio, in der Kneipe oder als aufgelegtes Musikstück)
verstärkt (oder auch konterkariert), sind in der "Playlist"
(die ominösen "18 Kostbarkeiten") nachvollziehbar. Hier kann man in die
Atmosphäre der Protagonisten noch einmal abtauchen; ein Einfall, der tatsächlich
verfängt.
Wie
schon in
ego shooter, der brillanten
Erzählung über den Proficomputerspieler Kovács, der Weltverzweifelte und
gleichzeitig so Bedürftige, zeigt von Arndt auch hier einen Angehörigen einer
Generation, die dem Leben nichts mehr abzuringen brauchte, weil schon alles da
war – außer das, was sie am meisten ersehnten: Menschlichkeit, Geborgenheit,
Miteinander – und das im Lichte des so vergötterten (und gepflegten)
Individualismus, der nur zu gerne mit "Glück" verwechselt wird. "Ah, look at all
the lonely people", die erste Zeile von "Eleanor Rigby", auch das Motto des
Buches: Wenn die Verheißung zum Fluch geworden ist. Die vorgefundene und
vorgegebene Welt ist seelen- und lieblos, ja kalt, wenn man nicht im Konsum oder
der vordergründigen Erlebnisbefriedigung die Erfüllung sieht.
Der Ausbruch aus der
"selbstverschuldeten" Isolation, die nicht in eine Anpassung an das bestehende
münden soll und Kovács vermutlich nicht gelingt, wird für Julio mindestens als
Möglichkeit vage angedeutet. So könnte es gehen, wenn sich die immer wieder
aufzeigende Resignation zur "köstlichen, unbegreiflichen Demut" (Roberto Bolaño)
entwickelt. Und so vermittelt dieses Buch – so ganz ohne Soziologenslang,
existentialistische Unterfütterung oder pädagogischem Impetus – als reine
Erzählung vor allem eines: Hoffnung. Oder genauer: die Hoffnung auf eine
Hoffnung. Lothar Struck
|
Martin von Arndt
Der Tod ist ein
Postmann mit Hut
Roman
Klöpfer & Meyer
2009, 206 Seiten, geb. mit Schutzumschlag
€ [D] 17,90 / [A] 18,40 / sfr 31,50
ISBN 978-3-940086-37-2 7
Die Playlist
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac Eine
kleine Materialsammlung
Eine
kleine Materialsammlung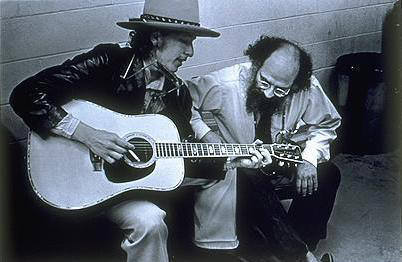
 »Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen«
»Diese mühselige Arbeit an den Zügen des
Menschlichen« Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend Die
Preisträger
Die
Preisträger