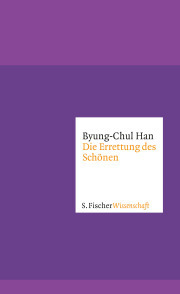|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
|
Goethe und Proust Hand in Hand
|
||
|
Das Schöne an dem Erfolgsautor Byung-Chul Han ist, dass er so schön, scheinbar einfach und klar, schreibt und seine Verbindungen einsichtig zieht. Er faltet, je nach Bedarf, seine philosophischen Leporellos effektiv aus oder wieder zusammen. Eine solche Bemerkung mag formal und inhaltlich selbst unschön klingen. Aber sie weist vorsorglich darauf hin, dass Han bei der »Errettung des Schönen« sich ganz in seinem Element wähnt. Man kann sich die Errettung des Schönen nicht anders als schön denken. Inwiefern ist die Errettung aber dann noch nötig? Droht sie nicht zu einer Tautologie im prästabilisierten Garten des Erlesenen zu werden? Doch so einfach macht Han es sich und uns dann auch wieder nicht. Zunächst einmal bleibt es auch in diesem Band bei Hans bekannter, relativ simplifizierender Doppelstrategie: der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Oberfläche (böse) und Transzendenz (gut). Auf der einen Seite beherrscht materialistische Konsumgesellschaft Mensch und Welt mit einem Fließband an Waren und Dienstleistungen in einer zurechtgestutzten Lebenswelt. Der Konsum nimmt die Schönheit als geschlossener, pseudoindividualisierter Oberflächen-Look in den Dienst – in einer völlig entleerten Form und Gestalt mit dem Zwang zur falschen Positivität zwischen Werbung, Massen(re)produktion und Absatz. Auf der anderen Seite steht der altehrwürdige Verweischarakter von Schönheit als eigenwilligem und zweideutigem Phänomen: Negativität, Mangel, Irritation für Wahrnehmen und Denken, überleitend in Erstaunen und in Erschütterung über etwas, was nicht fassbar, nicht nur immanent sein kann, sondern irgendwie transzendent. Der posttheologische Gottesbeweis einer Ästhetik, die aus der Simulation aktueller narzisstischer Selbstbezogenheit anachronistisch auszubrechen versucht. Han
greift das Unangreifbare an: die Ästhetik des Glatten, des Polierten als
vorprogrammierte Aussage über eine scheinbar bereits perfekt, jederzeit überall
hin versendbare Einheits-Welt, die, mit den Gesten von Like und Share, im chic
blinkenden Design der weltweit verbreiteten Smartphones eingerahmt wird.
Schönheit als pure Gefallsucht, als entlokalisiernde, disneyfizierende und
pornografische Werbeästhetik wie bei Jeff Koons, in der kompletten Entfernung
von Ort und Geschichte, von Rissen und Lücken, Spannungen und Widerständen, als
skulpturale Glätte von Bild, Kunst und Architektur, in der jede Unebenheit
wegrasiert und epiliert wird, in der noch das Haptische ins Orale eines
knallfarbenen Eindrucks, Bonbons oder Phallus übergeht. Es fehle diesem
selbstbezüglichen Minimal-Sensualismus und idiotisch un-sinnlichen Kurzgenuss
unter der hygienischen Event-Glocke die kritisch-sinnliche Distanz und
Differenzierung von Geschmack (Urteil), Auge und Ohr, die der Idealist Hegel als
Hauptsinne und Zeugen des Geistigen in einem Sinnlichen, entfaltet in Raum und
Zeit, auszeichnete. Welt, Wahrnehmung und Kunst verwandelten sich in Clicks und
Clips auf einem Touchscreen, in dem alle Dinge scheinbar unmittelbar als
beliebig zusammensetzbare Fassadenstücke aktiviert und wieder zurückgelegt
werden können. Mit solch digitaler Entzugs-Ästhetik können die
»Positiv«-Gesellschaften ihre Normen durchsetzen. Sogar das Nichtidentische,
Sich-Nicht-Fügen und Aufbegehren im Erleben von Ekel, Angst, Andersheit,
Entrückung, Konflikt, Anstrengung und Widerstand werde häppchenweise
konsumierbar gemacht in heruntergekürzten Szenarien, in denen das existentielle
Drama auf ein Minimum eingestampft würde. Han führt verschiedene Bestimmungsmomente des Schönen, wie es sein sollte, auf. Auch hierbei verfährt er recht historistisch, fragmentarisch und eklektisch. Er definiert das Naturschöne im Sinne von Adorno als Figur der Negativität gegenüber jedem einseitig systematischen Denken und stellt es erneut der kognitiv domestizierten Ästhetik der Neuzeit und der digital vermachteten Ästhetik entgegen. Ähnlich operiert er im Rekurs auf Goethe mit dem Paradigma der Ästhetik der Verhüllung (vergleiche Hans Attacke gegen die Ideologie der Transparenzgesellschaft und des Big Data Unwesens): Das Schöne sei nicht an sich transparent, sondern gerade eine Verheißung im Modus der Unzugänglichkeit. Ähnlich argumentiert Han mit der Ästhetik der Verletzung, im Rückgriff auf Roland Barthes: Ästhetik sei eine Prozess der mühevollen Abstraktion mitten im Konkreten, erkämpfte Distanz, um ein entscheidendes Detail, etwa auf einem Gemälde oder einer Fotografie zu entdecken, das alles andere in neuem Licht erscheinen ließe, ein Punctum, das das vorgegebene Thema und sein Studium unterlaufe. Hier geht es um nichts geringeres als um die Fähigkeit des eigenständigen Spurenlesens: um die Verarbeitung vorgegebener Daten durch kreative Wahrnehmung und individuelles Begreifen. Sodann votiert Han für eine Ästhetik des Desasters, dem destruktiven und produktiven Einbruch von Unordnung und Katastrophe in einen wohlgeordneten Kosmos, um Drinnen und Draußen in ein neues Verhältnis zu bringen (Rilke, Baudelaire). Damit könnte Han ansetzen zu einer differenzierten Begriffsbündelung eines systemkritischen Schönen am Rand und zunehmend im Innern der heutigen Netz- und Konsumwelt. Aber statt dessen holt er weiter philosophiegeschichtlich aus und glättet, was soeben noch schroff sich zu steigern schien. Mit Hegel wird »Schönheit«, besser: das Schöne, »als Wahrheit« gedacht, besser: als sinnliches Scheinen der Idee. Schon hier sind sowohl die allgemeine System- wie die spezielle Ästhetik-Diskussion viel zu ungenau. Die Dialektik von Schein und Wahrheit wäre bereits ein lohnenswertes Thema. Han bleibt eine Erörterung schuldig. Adorno würde den folgenden unwillkürlich identitätsphilosophischen Vereinfachungen widersprechen. In allzu gedrängter Form skizziert Han ein Zusammenspiel, das alle Gegensätze und Pole verknüpfen soll: Teil und Ganzes, Notwendigkeit und Freiheit, Zwang und Versöhnung, Begierde und Askese, Subjekt und Objekt, Theorie und Praxis werden in einer homöostatischen Vermittlung gedacht. Das Schöne ist struktureller Selbstzweck, negativer Motor und zugleich dialogisch verschwistert mit Wahrheit und Freiheit. Und dieses widerständig-dialektische Schöne bildet für Han auch das Rückgrat einer Politik des Schönen (oder sollte man mit Kant und Arendt Politik der reflektierenden Urteilskraft sagen?). Die Politik des Schönen entziehe sich den Zwängen der kapitalistischen Direkt- und Dauer-Verwertung. Am Ende läuft Hans Buch auf die alte Trias vom Guten, Wahren und Schönen hinaus, als Dimensionen spiritueller Unbestechlichkeit, Nachhaltigkeit und Entschleunigung. Verweile doch, du bist so schön, dann wirst du auch das Wahre und Gute erkennen, ohne es durch deine falschen Routinen zu verfehlen. Goethe und Proust Hand in Hand. Die Errettung des Schönen ist also die Errettung einer spirituellen Dimension, und mit ihr erfolgt die Errettung des echten Dialogs zwischen Selbst, Anderem und Welt. Byung-Chul Han will die Systemkritik und den Anstoß zur geistigen Revolution, er deutet das Negative und Nichtidentische an, aber er bleibt gerade beim Thema des Schönen im historischen Garten der wohlgeordneten, freilich auch etwas abgeschliffenen und unpräzisen Begrifflichkeiten, die er mit den Titeln und Thesen seiner letzten Werke (Transparenzgesellschaft) ziemlich lose verbindet. Sein neues Buch ist, auch im höheren Sinne, durchaus spirituell konsumierbar und lesenswert. Die Errettung des Schönen ist zwar nachgefragt, aber sie darf nicht zu ungemütlich ablaufen. Darunter würde das Schöne leiden. Als ästhetisches Erlebnis oder als dialogischer Zusammenhang fragiler politischer Problemlösungen. Vielleicht liegt darin ein Stück Weisheit. Die bewegt sich noch weit ab von der Realität.Artikel online seit 31.08.15 |
Byung-Chul Han
|
||
|
|
|||