|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
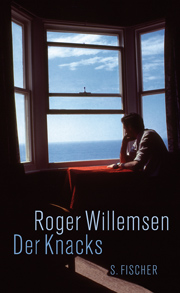 |
Grosse
Worte und Miniaturen |
||
|
Der Titel klingt
eigentlich harmlos: "Der Knacks". Und obwohl Roger Willemsen gleich am Anfang
vom Sterben und Tod seines Vaters erzählt (er ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre
alt), entsteht zunächst der Eindruck einer Art feuilletonistisch-aphoristischen
Phänomenologie. Die Sentenzen sind klingend, manchmal sogar luzide; gelegentlich
fast zu schön. Aber immer weiter wird man in den Sog des Phänomens des Knacks
gezogen.
Ermüdungsbruch Manchmal widerspricht sich Willemsen allerdings. Etwa wenn er, ein bisschen launig, vom beginnenden Alter spricht: Und dann kommt der Tag, an dem man sich das Alter vorstellen kann, seine Desillusion, seine Bitterkeit, den begrenzten Aktionsradius. An dem Tag beginnt man wirklich zu altern. Der Mensch in einer Flucht von ersten Tagen: Der Tag, an dem man ein Medikament verschrieben bekommt, das man bis ans Ende seines Lebens nehmen muss; der Tag, an dem man das Geländer braucht, um eine Treppe abwärts zu steigen…der Tag, an dem man im Zug den Koffer nicht mehr allein auf die Ablage bekommt…Dann kommt der Tag, an dem man "zu alt" für etwas geworden ist, und es ab jetzt dauernd für irgendetwas sein wird… An solchen Stellen, die wunderbar zitierbar sind (besonders der ebenfalls auf das Alter gemünzte Satz Man wird klüger, aber dümmer), verliert der Autor dann letztlich seinen Gegenstand zeitweilig aus dem Auge. Denn der Knacks, so Willemsen vorher, erscheint immer erst retrospektiv und als Prozess. Die geschilderten Einschnitte sind eher Zäsuren – in der Regel einem Datum zuzuordnen, direkt erlebt und nicht erst erinnert. Der Knacks ist komprimierte Zeit. Er bahnt sich an, tritt aus der Latenz ins Manifeste, und selbst der augenblickliche Schrecken eines Ereignisses hängt nicht so sehr mit seinem Eintreten als vielmehr mit seiner Anbahnung zusammen. Auf dem Kristallisationspunkt erscheint der Knacks. Und natürlich hat es mit der Beschleunigung zu tun: Der Knacks…ist etwas, das im Zeichen einer beschleunigten Zeit, einer, die Bewegung meint, nicht erscheinen kann. Man sieht aus dem Fenster und erkennt, schwimmend auf der Scheibe, sich selbst, sieht sich im Schrecken: das aller Geschwindigkeit entzogene Spiegelbild dessen, der man nie sein wollte. Die Beschleunigung verzögert nur diesen Blick auf sich selber und in der Geschwindigkeit verwischt der Knacks seine Spur. Und schon Casanova wusste, wie man das Leben "betäubte", in dem sein Verstreichen durch das Vergnügen unmerklich machte.
Grosse Worte und kleine
Miniaturen Zarter und eingänglicher sind da die Splitter, Miniaturen, Mutmaßungen und Andichtungen. Das Kreisende um und mit dem Knacks wird episodisch und gleichnishaft, wie zum Beispiel hier:
»Dufte nicht so«, sagt der
langjährige Freund, als die Freundin ausgehfertig aus dem Badezimmer kommt. Und es wird auch mit grossen und wuchtigen rhetorischen Mitteln Kulturkritik auf höchstem Niveau praktiziert. Man ist erstaunt, über welche Beobachtungs- und Urteilsgabe Willemsen verfügt, der im Gesicht einer Frau während einer Bahnreise nicht nur ihre aktuelle Lebenslage beschreiben kann, sondern auch zielsicher den Knacks zu orten vermag. Lässt sich der Leser aber auf diese literarische Allwissenheit ein, so kommt er in den Genuss sehr anregender und oft genug vergnüglicher Aperçus. Willemsen erkennt dabei durchaus das Dilemma des in der Moderne lebenden Menschen. Er soll ein Individuum sein, sich aber nicht unterscheiden. Er entdeckt, dass der grössere Schaden in der Gegenwart wohl nicht von dem aus[geht], was Menschen tun, sondern was sie geschehen lassen. Aber auch Glück oder Erfolg bleiben schal. Man scheitert vor dem Erfolg, erleidet in ihm seine Niederlage, vielleicht, weil es kein Ankommen gibt in der Umarmung. Was bleibt ist Hedonismus oder Zynismus oder Depression und schliesslich Selbstmord, denn gegen die Erosionen der Aufklärungs- und Bildungsideen, die den "neuen Menschen" suchten, setzt die Gegenwart den multiplen, den ironischen Charakter oder den schieren Menschen des Werbebildes, der in jedem Augenblick auf der Höhe seiner Vollkommenheit existiert. Es wird später erst klar, wie ernst es dem Autor damit ist.
Der Knacks, verkannt zu
sein In ihrer Schönheit zeigt diese Sentenz allerdings exemplarisch, worin manchmal das Problem des Buches, speziell dieser Stellen, liegt: Willemsen schreibt dies so, als möchte er Widerspruch provozieren. Wie alle Melancholiker hofft er auf den rettenden Einspruch, die zündende Widerlegung, die flammende Gegenrede – was aber unterbleibt. Plötzlich erscheinen all die literarischen Zeugen, mit denen sich Willemsen umgibt wie Vergewisserungen der eigenen Versehrtheit: natürlich Scott Fitzgerald ("The Crack-Up"), aber auch Josef Roth ("Flucht ohne Ende"), Joseph Conrad ("Schattenlinie") und Franz Kafka (die Gegenseite, beispielsweise Tennessee Williams, bekam keine Ladung; manchmal kann es ein Fehler sein, nur Freunde eingeladen zu haben). Leider wird nicht ausgeführt, ob der Knacks ein singuläres Phänomen ist oder ob im Laufe des Lebens mehrere "Knackse" (aus unter Umständen unterschiedlichen Lebensabschnitten kommend – Beruf, Partnerschaft, Umwelt) "erworben" werden können. Indem Willemsen den Knacks auch auf Gemeinwesen anwendet und sozusagen kollektiviert, werden mehrere "Knackse" im Laufe des Lebens denkbar. Aber ist dies auch gemeint? Oder ist DER Knacks DER richtungsweisende Ermüdungsbruch im Leben des modernen Menschen (meistens ist es übrigens ein Mann)? Und auch nur am Ende wird deutlich: Hier beschreibt jemand ein Phänomen der Moderne, des modernen (oder postmodernen) Menschen, der mit Glücksverheissungen und –versprechungen irgendwann überfordert zu sein scheint. Ein Tuarag oder ein Bewohner der mongolischen Steppe dürfte dieses Buch wohl höchstens als Science-Fiction-Roman lesen oder kopfschüttelnd beiseite legen. Und gelegentlich scheint der Knacks eine allzu voreilig eingesetzte Diagnose eines schwermütig-hypochondrischen Zustandes zu sein, etwa wenn davon die Rede ist, der Mensch erlebe im Knacks seinen Kurssturz oder mit der Katastrophe von Tschernobyl sei die Aussenwelt von etwas erreicht, das man als Knacks bezeichnen könnte. Das schlägt auch einmal in (unfreiwillige) Komik über, etwa wenn Konsumkritik dahingehend betrieben wird, dass Produkte eine apokalyptische Welt herbei [halluzinieren], die gleich hinter dem Knacks liegt. Das Buch ist ernst gemeint. Und es ist Ernst. Wunderbar allerdings die Ausführungen zum Knacks in der Kunst. Anhand der fortlaufenden Restaurierungen von Leonardos "Abendmahl" stellt Willemsen fest, dass man inzwischen ein Original sieht, auf dem es nichts Originales mehr gibt. Goyas berühmtes Diktum "Auch die Zeit ist ein Maler", mit dem er dem König von Spanien die Restaurierungsarbeiten von Gemälden ablehnte, führt Willemsen auf das "Abendmahl" fort: Wäre es also nicht der zumindest wahrhaftigste Zugang zu Leonardo gewesen, man hätte ihn der Zeit übergeben und sein Verschwinden als genuin künstlerischen Akt verstanden? Dann wäre Leonardo der Maler gewesen, der den Knacks gemalt und durch ihn den Tod in das Werk hätte eintreten lassen. Bei aller Lockerheit und auch obwohl Willemsen keine wissenschaftliche Schrift abliefert: Das Buch ist ernst gemeint. Beispielsweise dann, wenn ausgesprochen klug und empfindsam über die Todessehnsucht von Kindern geäussert wird: Einerseits wird…der Verlust antizipiert, den das eigene Verschwinden in der Mitwelt auslösen würde, andererseits überantwortet sich das Kind in der Idee des selbstgewählten Todes der Hoheit dieses Todes und wird darin souverän. Oder wenn er am Schluss des Buches in einem beeindruckenden Kapitel fern jeglichen Rührkitsches vom Krebstod einer guten Freundin erzählt. Mehrdeutig seine Erzählung von der Beerdigung der Frau und dem Zusammenstehen der Freunde am Grab: Wir tauchten aus Monaten der Tränen, des Mangels und der Angst auf und blickten uns immer noch ungläubig an, in der Hoffnung, der Wirklichkeit doch noch für eine Zeitlang ausweichen zu können. Und wenn nach all den vorher im Buch getätigten Thesen und Ausführungen über den Selbstmord (oder auch Freitod; Willemsen verwirft diesen Begriff allerdings) plötzlich ein Satz wie Der Tod ist zu wichtig, um sich ihm gegenüber auf das Gewährenlassen einzustellen zu lesen ist, dann stockt dem Leser der Atem und so manch saloppes Bonmot der zurückliegenden mehr als zweihundertfünfzig Seiten zoomt man sich nochmals heran, um es etwas genauer zu betrachten. Etwas, es ginge irgendwann nur noch darum, den Knacks zu kitten. Also im Kern handele es sich um Überlebensversuche.
Am Ende hat man den
Eindruck, Roger Willemsen führt uns zurück in die Welt des Fatums, des letztlich
unentrinnbaren Schicksals, denn dem Knacks entkommt man in unserer Zivilisation
nicht. Er ist zwar nicht dezidiert negativ konnotiert, aber er "programmiert"
uns und ist unwiderruflich. Die Kenntnis über ihn, die Selbstreflexion oder
Selbstvergewisserung, heben seine Wirkung nicht auf; lindern noch nicht einmal.
Er ist damit tückischer als alles andere, inklusive das, was man landläufig
Depression nennt. Die kursiv gedruckten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
Sie können
diesen Beitrag hier kommentieren:
Begleitschreiben |
Roger Willemsen |
||
|
|
|||