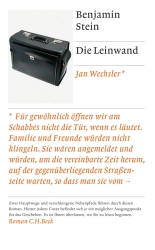|
Bücher & Themen
Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Weitere Sachgebiete
Quellen
Biographien, Briefe & Tagebücher
Ideen
Philosophie & Religion
Kunst
Ausstellungen, Bild- & Fotobände
Tonträger
Hörbücher & O-Töne
SF & Fantasy
Elfen, Orcs & fremde Welten
Autoren
Porträts,
Jahrestage & Nachrufe
Verlage
Nachrichten, Geschichten & Klatsch
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Berserker und Verschwender
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«

|
Ein
kühnes Paradoxon:
die Dekonstruktion mit den Mitteln der Spiritualität
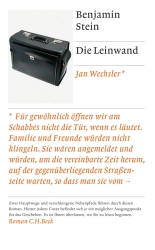 Lothar Struck über Benjamin Steins grandiosen Roman »Die Leinwand« Lothar Struck über Benjamin Steins grandiosen Roman »Die Leinwand«
Gar nicht so einfach, mit
dem Lesen dieses Buches anzufangen. Denn man hat unverhofft zwei Möglichkeiten.
Entweder man beginnt mit dem Teil von und über Amnon Zichroni oder man
wendet das Buch, dreht es um 180 Grad und beginnt mit Jan Wechsler. (Eine
andere Idee, die Kapitel sozusagen abwechselnd zu lesen, dürfte aus Gründen der
Praktikabilität fast ausscheiden; hierfür hätte man mindestens zwei Lesezeichen
einbinden müssen. Und außerdem bleibt das Problem, wo man beginnt.)
Beide
Teile sind fast paritätisch. Man ahnt: Wie man es auch beginnt – es bleibt eine
Entscheidung, die die Rezeption prägen wird. Man wird nie erfahren, wie es
gewesen wäre, wenn man anders begonnen hätte. Vielleicht werden einmal die Leser
von Benjamin Steins Buch "Die Leinwand" anhand ihres Anfangskapitels
unterschieden zwischen Zichroni- oder Wechsler-Einsteiger. Ob sich die beiden
Lager jemals miteinander verständigen können? Tatsächlich dürften sie zwei
unterschiedliche Bücher gelesen haben. Und dieses scheinbar so spaßige Spielchen
passt am Ende erstaunlich gut zu Atmosphäre und Intention dieses Buches.
Um es vorweg zu sagen: Ich
habe mit dem Zichroni-Kapitel begonnen. Dort steht schon auf der ersten Seite:
Erinnerung ist…unbeständig, stets bereit, sich zu wandeln. Man ahnt noch
nicht, wie stark diese Erkenntnis im Buch bestimmend wird. Und auch dieser
scheinbar harmlose Satz bekommt im Laufe der Erzählung eine große Dimension:
Unser Gedächtnis ist der wahre Sitz unseres Ich. "Unser Gedächtnis" - und
nicht unser Gehirn.
Heiliger Ernst und die
yevonnische Welt
Amnon Zichroni ist in Israel geboren und geht dort bis zu seinem 15.
Lebensjahr auf eine religiöse Schule. Aber da ist die Neugier auf das
abgeschlossene Zimmer der Eltern, in dem es auch noch andere Bücher als die
Torah gibt und die Faszination
für diese neue Welt. Der Junge nimmt heimlich ein Buch aus dem Regal (Oscar
Wildes "Das Bildnis des Dorian Gray"). Die Angelegenheit fliegt auf, als der
junge Amnon im Unterricht das Buch einfach über das Lehrbuch legt. Der Vater
schickt den Sohn zu einem "Onkel" Nathan Bollag (der in Wirklichkeit nicht sein
Onkel ist) nach Zürich. Die Hoffnung, hier ein "weltlicheres" Leben führen zu
können, zerstreuen sich rasch. Bollag ist Edelsteinhändler und führt einen
bescheidenen, jüdisch-religiösen, aber nicht orthodoxen Lebensstil. Nach der
Schule sorgt er dafür, dass Zichroni auf eine Talmudhochschule in die USA geht.
Dort lernt er den Mitschüler Eli Rothstein kennen, der ihn mit seinem
heiligen Ernst in religiösen Dingen imponiert. So will er einen Nierentumor
durch das Studium talmudischer Schriften und einem rituellen Tauchbad (der
Mikwe) in einem Wäldchen nahe
Yerushalayim bezwungen haben und dies, obwohl ihn die Schulmedizin schon
fast aufgegeben hatte.
Eli erinnert ihn an den
"Onkel", der am Tag vor dem Abflug in die USA nach Zichronis Lektüre von
Bulgakows "Meister und Margarita"
eine flammende Rede wider die Griechen und die (von ihnen erschaffenen)
bestimmenden Naturwissenschaften hielt: So kurz ihr Bandmaß auch sein mag,
sie vermessen alles. Es wird kategorisiert, sortiert, bewertet und in Tabellen
gepresst. Und das scheint vernünftig und sehr sinnvoll und ganz im Sinne des
Erkenntnisgewinns. Nur halten sie leider ihre ausschnitthaften Vermessungen für
eine Kartographisierung des Universums und bestehen darauf, ihre Theorien als
verbürgte Wahrheit zu betrachten, solange nicht eine neue Theorie daherkommt,
der es gelingt, sich zur nächsten verbürgten Wahrheit aufzuschwingen. Für
die Religionen, also für all das Phantastische, oder nennen wir es Magische,
das die Mystiker aller Religionen seit Jahrtausenden bewegt hat – für all das
ist dort draußen in der 'yevonnischen' Welt der vermeintlich exakten
Wissenschaften kein Platz. Man gebe sich heute dem Spott preis, wenn man
behauptet, dass es etwas über den anderen Menschen gibt und dass die Menschen
bestenfalls Partner des Ewigen sein können, aber sicher nicht die Steuernden,
die Lenker, jene mit dem allumfassenden Plan. Ihre kleinen
Erkenntnisse setzten sie als Wahrheit in den Schaukasten, aber, so der
alte Mann, es gibt diese Wahrheit nicht, denn wir alle halten nur
Bruchstücke davon in Händen.
Eli Rothstein lebt nun
diese andere, diese mystische Welt, von der Nathan Bollag schwärmte. Zichroni
ist davon fasziniert. Hinzu kommt Elis scharfer Intellekt. Als er den
Schabbes [Sabbat] zusammen mit
Elis Familie verbringt und ein Auge auf seine Cousine Rivka wirft, ereignet sich
zum zweiten Mal dieses merkwürdige Erlebnis, welches Zichroni in eine Art
Halluzination versetzt, in der er die Erinnerungen der ihm gerade zugewandten
Person wahrnimmt. Zum ersten Mal geschah dies als sein Vater ihn anlässlich
seines Vergehens zur Rede stellte. Als Zichroni nervös auf die Reaktion des
Vaters wartend in einen Apfel beißt (man beachte diese Symbolik!), überkam ihm
ein Sturm an Bildern, Tönen und Gefühlen; eine Art dreidimensionales
Erlebnis: Er kann seinen Vater bei seinen Erinnerungen zusehen und erlebt diese
Szene körperlich.
Die Gabe
Plötzlich hat er abermals eine solche Erscheinung: Er erkennt und fühlt die
Erinnerung an ein Liebesspiel zwischen Eli und Rivka. Dies ist auf doppelte
Weise prägend: Zum einen muss er seine eigenen Ambitionen auf die Dame
vergessen, es sei denn er wolle den Bruch der Freundschaft mit Eli riskieren.
Zum anderen zeigt sich ihm, dass er tatsächlich mit einer Gabe ausgestattet ist
und das Erlebnis am Küchentisch des Vaters kein einmaliges Phänomen war. Er
vertraut sich Eli an, der ihm rät, dieses Talent zu nutzen, daran zu
arbeiten und es zum Wohl der Menschen einzusetzen.
Eli heiratet Rivka und Zichroni beginnt an der
Yeshiva Universität in New York
ein Studium. Er glaubt, dass er als Psychoanalytiker sein Talent am besten
einsetzen könnte. Hierfür muss er jedoch zunächst einmal Medizin studieren. Und
einmal die Woche studiert er mit Eli, der Rabbi werden möchte, die Torah. Die
Bildungsbeflissenheit ist enorm. Mit dem Medizin-Studium begibt sich Zichroni
zum Schein in die so verteufelte Welt der Naturwissenschaften – aber da er
vorgibt, diese Erkenntnisse in das Torah-Wissen einzubetten, wird er von
seinem "Onkel" großzügig finanziell unterstützt. Gleichnishaft fügt Benjamin
Stein immer wieder die Konfrontation zwischen mystisch-religiöser und
naturwissenschaftlicher Welt in das Buch ein. So behandelt der
Anatomie-Professor der Universität in seiner vorlesungsfreien Zeit Patienten mit
alternativen Heilmethoden wie Akupunktur. Der Professor wie auch Zichroni
erscheinen fast wie Jekyll-/Hyde-Figuren, die sich zum Schein der
mechanistisch argumentierende[n] Medizin widmen, während sie andererseits
fest daran glauben, dass etwas anderes im Leben der Menschen Regie führt:
die mitunter grauenvolle, poetische Hand des Ewigen.
Unmittelbar nach Abschluss
des Studiums stirbt Nathan Bollag in Zürich. Zichroni nimmt dies als Zeichen. Er
glaubt, dass der "Onkel" just in diesem Moment gestorben war, damit ihm alle
nur denkbaren Möglichkeiten der Weiterbildung offen standen. Denn es stellt
sich heraus, dass Zichroni sehr früh als Alleinerbe eingesetzt wurde. Mit einem
beträchtlichen Vermögen ausgestattet, kann er sich in aller Ruhe eine Existenz
als Psychoanalytiker in Zürich aufbauen. Zwar hat er immer noch keine Ahnung
von seiner Mission, d. h. es erschließt sich ihm nicht, was der Ewige
(Gott) ihm zugedacht hatte und warum er mit dieser Gabe ausgestattet
wurde: Wieviele Verzweifelte musste ich heilen und in welcher Zeit? Aber
die Tatsache, einem Plan des Ewigen unterworfen zu sein, steht für ihn
unverrückbar fest.
Dennoch verzweifelt er fast und Geduld ist nicht eine Stärke. Hin- und
hergerissen zwischen unterschiedlichen psychoanalytischen Schulen (er neigt eher
Jung statt Freund zu), beschließt er erneut eine Weiterbildungsmaßnahme. Neben
einer über fünf Jahre (1500 Analytikerstunden) angesetzten Lehranalyse
übernimmt er eine Praktikumsstelle an einem (fiktiven) "Institut für
Parapsychologische Studien und Grenzgebiete der Psychologie" in Freiburg im
Breisgau (tatsächlich gibt es dort ein
Institut, welches
parapsychologische Phänomene untersucht; ein Hinweis auf den Humor des Autors).
Hier hofft er seine Gabe endlich anbringen zu können, wird jedoch
weitgehend desillusioniert und muss feststellen, dass er zwar die Erinnerungen
der potentiellen Patienten evozieren kann, dies jedoch nur äußerst schwierig in
den Therapieprozess einzubringen ist. Tatsächlich gelingt ihm eine Art Heilung
nur in einem Fall, den er ausführlich in einer Studie dokumentiert hat, aber
aufgrund seiner Singularität nicht zu veröffentlichen wagt.
Minskys Wahrheit - und
die reale Vorlage
Zichronis retrospektives Erzählen spielt mit der sich abzeichnenden
Katastrophe. Sie beginnt bei Minsky, dem Geigenbauer und Restaurateur von
Musikinstrumenten. Er lernt ihn kennen, weil er eine alte Violine aus Bollags
Nachlass reparieren und restaurieren lassen möchte. Minsky ist Experte aber ein
bisschen kauzig und lebt sehr abgeschieden. Er ist im Gegensatz zu Zichroni kein
observanter Jude. Im Laufe mehrerer Begegnungen kommen die Männer sich näher.
Minsky bedrückt etwas und er vertraut sich Zichroni an. Eines Abends erzählte er
mit vielen, langen Pausen von Auschwitz und Majdanek, vom Bild seines Vaters,
der in einem kleinen Ort bei Minsk, wo er geboren sei, vor seinen und den Augen
seiner Mutter von weißrussischen Milizen ermordet wurde. Er erzählte von den
Baracken des Lagers, vom allgegenwärtigen Tod und den Ratten, von seiner Rettung
und den Jahren im Kinderheim in Polen und schließlich in der Schweiz, in die man
ihn, wie er es ausdrückte, verschleppt hatte, um ihn seiner Vergangenheit zu
berauben.
Minsky erzählt dies im Gestus eines gebrochenen Mannes. Auch Zichroni ist
verstört. Gemeinsam beginnen sie Recherchen, um weitere Details zu erfahren. Man
fährt zu den Lagern und Minsky beginnt, diese Erinnerungen aufzuschreiben. Zwar
hatte der Freund ihn dazu ermuntert, aber mit großer Skepsis stellt er fest,
dass Minsky ein Buch begonnen hatte. Er macht sich nachträglich Vorwürfe,
nicht eindringlich vor einem solchen Schritt gewarnt zu haben. Immer noch tost
"Onkel" Nathans Rede im Kopf, nachdem Wahrheit immer eine Frage des
Standpunktes sei. Aber das Buch wird verlegt und ein großer Erfolg. Es wird
in vielen Sprachen übersetzt und Minsky erhält dafür Preise.
Nach drei Jahren erscheint plötzlich der erste gehässige Artikel von Wechsler.
Und Zichroni erwacht wie aus einer Trance. Wechsler berief sich auf die
Wahrheit. Aber wovon redete er? Fragen dieser Art verhindern den Sturz ins
Bodenlose nicht. Wechsler belegt, dass Minskys Geschichte, die er zu seiner
Geschichte gemacht hat, nicht stimmen konnte. Man warf Minsky vor, sich als
Opfer zu gerieren und mit dieser falschen Opfergeschichte Geld zu verdienen (das
Wort vom Leichenepos fällt). Wechsler legt mit einem Buch nach und man
beschuldigt Zichroni, seine Stellung als Arzt missbraucht zu haben. Nicht nur
Minsky wird intellektuell ruiniert, auch Zichroni wird zur persona non grata. Er
verliert seinen guten Ruf, die Praxis und [die] Forschungsstelle in Freiburg.
Beide ziehen sich
schließlich zurück. Zichroni versucht einen Neuanfang in Israel und kauft sich
ein Haus in Ofra, einer Siedlung inmitten der West Bank. Eine
Rehabilitation erachtet er als zu aufwendig und erreicht bei den israelischen
Behörden, dass er seinen Namen ändern darf, um vor Nachstellungen sicher sein zu
können. Ab und zu besucht ihn Eli, der inzwischen mit Rivka und seinen Kindern
auch in Israel lebt.
Spätestens hier ist dem Leser klar: Benjamin Stein paraphrasiert den
(sogenannten) Fall
Binjamin Wilkomirski und des 1995
erschienenen Buches "Bruchstücke". Bis in die Details vergräbt sich Stein in den
Skandal und fiktionalisiert ihn dennoch. Trotzdem vermag man zu sagen, dass es
sehr starke Übereinstimmungen zwischen der Figur Minsky und Wilkomirski gibt.
Die Figur des Ich-Erzählers dieses Kapitels, Amnon Zichroni, hat zweifellos
Gemeinsamkeiten mit dem Psychoanalytiker Elitsur Bernstein, einem Freund von
Wilkomirski. Auch andere Figuren und Fakten lassen sich einfach zuordnen. So
wird beispielsweise aus dem Historiker Stefan Mächler, der aus neutraler und
wissenschaftlicher Sicht Wilkomirskis Text untersuchen sollte (später erschien
diese Studie unter dem Titel "Der Fall Wilkomirski" als Buch) Hans Macht. Die
wenigsten Übereinstimmungen gibt es zwischen dem Daniel Ganzfried, der 1998 in
einem Artikel in der "Weltwoche" die Angelegenheit ins Rollen brachte und der
fiktiven Figur Jan Wechslers. Im Laufe des Romans wird deutlich, warum.
Suspense und die
verlorene Identität
Das Kapitel endet mit einer zufällig zu nennenden Begegnung zwischen
Zichroni und Wechsler. Durch Bekannte und Bekannte von Bekannten erhielt
er eine Anfrage, ob er einen jungen Deutschen zum Schabbes aufnehmen könnte.
Als der Deutsche eintrifft, stellt sich heraus, dass es sich um Jan Wechsler
handelt. Wechsler erkennt Zichroni nicht – umgekehrt freilich schon. Zichroni
lotst Wechsler an ein Gewässer, damit dieser dort einzutauchen kann (es ist wohl
das gleiche Gewässer, welches Eli die Heilung brachte). Dabei versucht er
Wechslers Kopf unter Wasser zu pressen und ihn zu ertränken.
Ein gelungenes Beispiel für "Suspense", die im Wechsler-Kapitel immer mehr
zunimmt und tatsächlich eine große, fortlaufende Spannung erzeugt. Wechsler,
1965 geboren, lebt in München mit Frau und Kindern. Er arbeitet gelegentlich als
Publizist und besitzt einen kleinen Verlag, ist aber finanziell nicht besonders
gut gestellt. Eines Tages bekommt er einen Pilotenkoffer zugestellt. Er kennt
diesen Koffer nicht, vermisst auch kein Gepäckstück. Merkwürdig nur, dass das
Adressetikett eindeutig seine Handschrift trägt. Er öffnet nach einigen Monaten
den Koffer und findet darin u. a. eine Studie über einen psychoanalytischen Fall
und mehrere Bücher, unter anderem eine Buch eines Gewissen Jan Wechsler mit dem
Titel "Maskeraden". Der Leser weiss sofort – es handelt sich um
Gegenstände von Amnon Zichroni. Aber wieso erinnert sich Wechsler nicht? Und
warum erkennt er sein eigenes Buch nicht mehr und vermutet einen Autor, der
zufällig den gleichen Namen trägt? (Es folgen über einige Seiten immer wieder
einmal aufgesetzt wirkende philosophische Betrachtungen Wechslers über das Thema
"Erinnerung"; derer hätte es nicht bedurft.)
Wechsler rekapituliert
sein Leben. Er ist im kleinen Land mit dem kleinen Horizont aufgewachsen
(der DDR). Als eine Sportlerkarriere mit 15 aus rein anatomischen Gründen vom
Staat nicht mehr gefördert wurde, entdeckt der leicht egozentrische,
pubertierende Junge (Ich hatte schon früh den Drang, im Mittelpunkt zu stehen)
Gott und sucht Halt im Judentum. Es gibt einen kurzen aber aufschlussreichen
Einblick über das Jüdisch-Sein in der DDR (und die Durchdringung der Gemeinden
mit Mitarbeitern der Staatssicherheit). Irgendwann bemerkt er dann, dass es ihm
weniger um Religion als um Identität geht. Das Zauberwort des postmodernen
Menschen kann und darf in einem solchen Roman natürlich nicht fehlen. Über die
Zeit nach der Wende erfahren wir, dass Wechsler einen hohen Lottogewinn erzielte
und eine kurze Zeit im Luxus schwelgte. Fehlspekulationen, der Zusammenbruch des
Neuen Marktes und Steuerhinterziehungen beenden diesen Boom. Seine Frau, die er
kurz vor dem Zusammenbruch kennenlernte, gibt sich mit den eingeschränkten
finanziellen Mitteln zufrieden. Schnell kamen die Kinder.
Wechsler lässt dieser
Pilotenkoffer und die Gegenstände nicht mehr los. Er schreibt einen Brief an den
Verleger der "Maskeraden", der ihn in der Antwort duzt und ein bisschen unwirsch
reagiert, da er ein kindisches Manöver Wechslers vermutet. Unterdessen wendet
sich seine Frau immer mehr von ihm ab; es finden offensichtlich
Persönlichkeitsveränderungen statt, die seine Umgebung durchaus wahrnimmt (und
sehr dezent dem Leser angedeutet werden).
Immer mehr gerät er in einen grüblerischen Zweifel. Kurz wird man an das
Schicksal des dicken Holzschnitzels aus Antonio Manettis gleichnamiger Novelle
aus dem 15. Jahrhundert erinnert, in der die Titelfigur infolge eines üblen
Scherzes seiner Freunde in den Wahnsinn getrieben wird, weil sie ihm durch ihr
Verhalten suggerieren, er sei nicht mehr er selbst und vermutet finstere Mächte,
die Wechsler übel mitspielen. Irgendwann verlässt ihn seine Frau mit den
Kindern. Das Buch wird jetzt wieder stark, weil es Benjamin Stein sehr gut
gelingt, diese labile Stimmung der Selbst-Verunsicherung zu erzeugen und zu
erhalten. Bisweilen wird der Leser zum Komplizen Wechslers und beginnt mit ihm
dessen Identität anhand von Indizien zu erforschen. Ein Treffen mit "seinem"
Verleger – unter einem Vorwand arrangiert - endet im Fiasko. Als er seine
DDR-Papiere als Nachweis hervorholen will, finden sich nur Schweizer Dokumente.
Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass er ein Schweizer Autor und
Journalist mit schillernder Vergangenheit an den Rändern des politischen
Spektrums ist. Nach seinem Enthüllungscoup im Fall Minsky ist er aus
seinem Leben geflüchtet.
Der dritte Weg und ein Selbstexorzismus
Wechsler wendet sich (stattdessen?) immer stärker dem Judentum zu, trägt
irgendwann öffentlich die Kippa und tritt schließlich in ein neues Leben
ein, symbolisch manifestiert durch eine Mikwe. Nichts würde mehr gelten von
dem, was gewesen war. Aus dem Wasser steigt man auf als ein neuer Mensch.
Der Namen wird gewechselt (nomen est omen!). Statt der Schweizer Identität (sie
ist weiterhin verschüttet und wird nur zähneknirschend akzeptiert) oder der
(imaginierten) DDR-Herkunft, gibt es einen "dritten Weg" – die Religion (hier in
Form des Judentums).
Mit diesem neuen Personalitätspanzer ausgestattet, versucht Wechsler die "ganze"
Wahrheit zu erfahren und fliegt mit dem Pilotenkoffer nebst Inhalt und nur
wenigen persönlichen Sachen als Handgepäck nach Tel Aviv. Gemäss Pass soll er
dort vor einigen Monaten (im Januar 2008) zum letzten Mal gewesen sein. Dort
angekommen, wird er von einem Sicherheitsbeamten in Zivil abgefangen und in
einen Verhörraum gebracht.
Dieses Verhör wird von
Stein als kafkaesk-beklemmendes Kammerspiel gekonnt inszeniert. Der arme
Wechsler, der bestimmte Dinge tatsächlich gar nicht mehr weiss, muss
improvisieren und verwickelt sich immer mehr in Widersprüche (auch hier wird
gezeigt, wie relativ Wahrheit sein kann). Schließlich wird er für die Nacht in
eine Zelle überführt. Dort ereignet sich dann eine Art Selbstexorzismus – alle
Bilder und Erinnerungen aus der (falschen [falschen?]) DDR-Zeit rufen
alptraumartige Halluzinationen hervor, die auf den Häftling physisch und
psychisch bedrohlich wirken. Wechsler sieht von Reptilien angegriffen, unter ihm
eine Schlangengrube. Diese Bilder kann er nur bannen, wenn er sich um
die "wahre" Erinnerung an seine letzte Israel-Reise bemüht und die
"Scheinidentitäten" ablegt, was schließlich gelingt (vielleicht ein bisschen zu
glatt inszeniert). Von dem Sicherheitsbeamten, der ihn verhört hatte, erfährt er
am nächsten Tag, dass er im Januar bei Amnon Zichroni war und dieser seitdem
vermisst wird. Wechsler hat plötzlich eine Befürchtung, von der er lieber nichts
erzählt.
Es ist schon ziemlich aufregend, wie Benjamin Stein den "Aufdecker" Jan
Wechsler, der auf einer absoluten Wahrheit besteht, selber Zuflucht in "seine"
eigene Wahrheit nehmen lässt – und zwar schlimmer und heftiger, als dies bei
Minsky der Fall war. Man rekapituliert als Leser des öfteren den Satz: Unser
Gedächtnis ist der wahre Sitz unseres Ich. Das ist natürlich mehr als nur
ein Statement des Autors zum "Fall Wilkomirski" – das ist fast schon ein
Plädoyer gegen die Art und Weise der Rezeption dieses Romans und der Behandlung
durch den (scheinbaren) Enthüllungsjournalisten. So eng sich Stein an die
"Realität" dieses Skandals anlehnt und diese für seinen Roman verwendet, so
wenig sagt er über die Behandlung dieses Vorgangs in den Medien aus. Stein
belässt es bei einer spirituellen Lesart dieses Werkes, welches kraft einer
Imagination heraus geschrieben ist. Dagegen steht die "rationale" Lesart, die
Authentizität einfordert (und daher den Autor fast "zwingt" eine Authentizität
fiktional herbeizuphantasieren, was jedoch – naturgemäss – nicht mehr akzeptiert
wird und zur Ächtung führt).
Die Leinwand-Utopie
Dabei geht es um deutlich mehr als die allzu häufig gestellte, banale Frage
nach den autobiografischen Teilen in einer sich fiktional gebenden Prosa.
Während normalerweise der fiktionale Text autobiografische Elemente hat (auch in
Steins Buch an vielen Stellen nachzulesen; insbesondere, was das jüdische Leben
in der DDR angeht), verfasste Wilkomirski einen sich autobiografisch gebenden
Text, der jedoch fiktionale Elemente enthielt. Für Wilkomirski wurde das
erfundene Leben zur Wahrheit. Stein zeigt, dass diese Kraft des Fiktionalen die
tatsächlichen Realitäten nicht nur überlagern, sondern verdrängen kann – und
das, ohne direkt eine betrügerische Absicht dabei ableiten zu wollen. Sehr gut
ist dies auf wissenschaftlicher Ebene in Alexandra Bauers Arbeit (mit dem etwas
reißerischen Titel) "My
private Holocaust – Der Fall Wilkomirski(s)" [pdf, ca. 355 kb]
nachzulesen.
So wird an Nathan Bollags
anti-naturwissenschaftliche Suada aus dem Zichroni-Kapitel angeknüpft. Die
Negation der "absoluten Wahrheit" (die in Wirklichkeit nur eine Negation der
"absoluten" Erkenntnismöglichkeit des Menschen ist), schafft auf diese Weise
plötzlich neue Freiräume: …weil wir nicht wissen, was wahr ist, müssen wir
uns entscheiden, was für uns zählt. Und ob etwas zählt oder nicht, das hängt
nicht von Messungen und Urkunden ab. Es wird auf anderen Waagen gewogen: Sinn
gegen Leere beispielsweise, oder die Idee eines ewigen Willens außerhalb von uns
gegen das blanke Nichts.
Zichroni ist mit der Versöhnung von talmudischem Spiritualismus (samt einer
Prise Mystik) und psychoanalytischer Lehre gescheitert. Einst war er angetreten
als Therapeut völlig in den Hintergrund zu treten und dem Patienten zu
helfen, sich selbst zu helfen – sich zu erinnern und im Prozess des Erinnerns
der Vergangenheit eine neue Bedeutung zu geben. In der Analyse wollte er den
Patienten das Gefühl der Ohnmacht nehmen und ihnen die Zügel wieder in die
Hand geben – oder vielmehr die Palette und den Pinsel, mit dem sie auf der
Leinwand ihrer Erinnerungen neue Akzente setzten. Dabei konnte man selbst ganz
zur Leinwand werden, zu einer Projektionsfläche, auf der die Patienten mögliche
Gegenentwürfe skizzierten und neue Möglichkeiten erprobten. Was im intimen
Gespräch zwischen Therapeut und Patient funktionieren kann, scheitert in einer
Verbreitung in Massenmedien, die auf Authentizität rekurrieren, furchtbar. Aber
auch der Antipode Wechsler vermag seinen "Erfolg" nicht auszukosten und wird –
nach landläufiger Meinung – wahnsinnig.
Benjamin Stein hat ein kluges Buch geschrieben. Es ist fast fehlerlos gebaut und
ungeheuer komplex. Die zahlreichen Exkurse – vor allen das Judentum betreffend –
sind farbig erzählt und bei aller Liebe zum Detail niemals ermüdend. Stein
schreibt leicht und virtuos ohne auch nur jemals in Gefahr zu laufen, ins
Seichte abzugleiten. Aber so imponierend die Haltung des Autors auch ist - das
Plädoyer für die mehreren Wahrheiten präsentiert irgendwann eine Rechnung. Eine
Rechnung mit dem Absender Religion - oder, genauer, ihrer gelegentlich
subversiv-antipodischen Konzerntochter, der Mystik.
Zichroni und Wechsler sind
exemplarische Figuren. Ihre Fluchten sind Rückzüge aus der modernen Welt, deren
Paradoxon darin besteht, einerseits multiperspektivische, pluralistische
Lebensentwürfe zu postulieren, andererseits jedoch in bestimmten Punkten
essentialistisch (bis hin zum autoritär- fundamentalistischen) agiert und
bedingungslose Konformität einfordert. Dagegen schlägt Stein die Religion als
eine Art antiideologisches Refugium vor - ein weiteres, allerdings anderes,
kühnes Paradoxon. Lieber einem Ewigen (also Gott) dienen, als ein Sklave
der Naturwissenschaft in einer sich nur liberal gebenden Moderne zu sein. Das
ist der Gegenentwurf, die Dekonstruktion mit den Mitteln der Spiritualität. Das
Vermächtnis von Amnon Zichronis "Leinwand"-Utopie. Nur, dass sie von einem
Schriftsteller kommt. Von wem auch sonst. Lothar Struck
Die kursiv gesetzten Passagen
sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
Webseite des Autors:
Turmsegler; "Tag" (Stichwort)
Die Leinwand; inklusive
Leseprobe(n).
|
Benjamin Stein
Die Leinwand
Roman
416 Seiten
Gebunden
C. H. Beck
ISBN 978-3-406-59841-8
19,95 €
Leseproben
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend