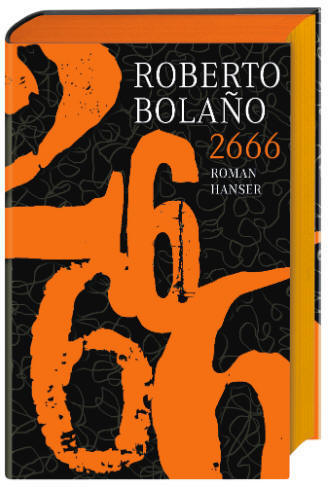|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Bücher & Themen Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Quellen Biographien, Briefe & Tagebücher Ideen Philosophie & Religion Kunst Ausstellungen, Bild- & Fotobände Tonträger Hörbücher & O-Töne SF & Fantasy Elfen, Orcs & fremde Welten Autoren Porträts, Jahrestage & Nachrufe Verlage Nachrichten, Geschichten & Klatsch Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Honoré
de Balzac Honoré
de BalzacBerserker und Verschwender Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
»2666«
lautet der kryptische Titel des grandiosen Romans des 2003 verstorbenen
chilenischen Autors Roberto Bolaño. Diese knapp 1.100 Seiten sind das
Vermächtnis eines meisterhaften Erzählers, der es mit den Granden der
Weltliteratur aufnehmen kann. Die fünf Bücher, die mich geprägt haben, sind in Wirklichkeit fünftausend. Ich will die folgenden nur als Speerspitze nennen: „Don Quichotte“ von Cervantes, „Moby Dick“ von Melville. Die gesammelten Werke von Borges, „Rayuela. Himmel und Hölle“ von Cortázar, „Ignaz oder die Verschwörung der Idioten“ von Toole. Ich sollte auch „Nadja“ von Breton erwähnen; die Briefe von Jacques Vaché. „König Ubu“ von Jarry; „Das Leben Gebrauchsanweisung“ von Perec. „Das Schloss“ und „Der Prozess“ von Kafka. Die „Aphorismen [und andere Sudeleien]“ von Lichtenberg, den „Tractatus“ von Wittgenstein. „Morels Erfindung“ von Bioy Casares, „Satyrikon“ von Petronius. „Römische Geschichte“ von Tito Livius. „Die Gedanken [über die Religion und andere Themen]“ von Pascal. (Roberto Bolaño im Interview mit Monica Maristain für die mexikanische Ausgabe des Playboy im Sommer 2003) Nur ein Autor von Weltrang kann diese Bibliothek zu seinem Grundstock literarischer Prägung erklären. Ein solcher Autor ist, besser gesagt, war der chilenische Schriftsteller Roberto Bolaño auch. Er starb im Sommer 2003, nachdem seine vom Hepatitis-Virus zerfressene Leber kollabierte. Zurückgelassen hat er Romane wie „Chilenisches Nachtstück“ oder „Die wilden Detektive“, für die er 1999 mit dem Premio Herralde de Novela und dem Premio Rómulo Gallegos zwei der renommiertesten Literaturpreise Lateinamerikas erhielt.
Sein größtes Werk, sein
literarisches Vermächtnis und ganz sicher ein Roman, der Bestand haben und in
den Kanon der Weltliteratur Eingang finden wird, hat er allerdings unvollendet
zurückgelassen. Es trägt den sperrig-technischen Titel „2666“. Einem enormen
editorischen Aufwand unter Berücksichtigung mehrerer Versionen des Romans („um
mögliche Auslassungen oder Fehler zu korrigieren und um eventuelle Hinweise auf
weiterreichende Absichten des Autors zu entdecken“, wie Bolaños Freund und
Editor Ignacio Echevarría in seinem Nachwort erklär) und der genialen
Übersetzung von Christian Hansen ist es zu verdanken, dass dieses 1.085 Seiten
starke „Romanfragment“ nun auf Deutsch vorliegt.
„2666“ scheint also eine
Anspielung auf eine Jahreszahl zu sein, ein Fixpunkt, dem alles entgegenstrebt.
Sofern dieser Zielpunkt tatsächlich dem Roman zugrunde liegt, erreicht er ihn
nicht tatsächlich. Zwar beschreibt Bolaño diesen Friedhof, von dem in „Amuleto“
die Rede ist, den Zeitpunkt seines Vergessens, also das Jahr 2666 erreicht er
jedoch nicht. Bolaños Roman bleibt ganz in der Gegenwart und der nicht allzu
fernen Vergangenheit. Sein Meisterwerk ist daher weder Utopie noch Dystopie,
sondern ein Tanz zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zwischen Geschichte und
Zukunft, zwischen Leben und Tod. Das nun als geschlossener Roman vorliegende Werk war ursprünglich auf Einzelbücher angelegt. Bolaños Erben beschlossen gegen seinen letzten Willen, die existierenden fünf Einzelteile als Gesamtwerk zu editieren. Sie taten gut daran. Die fünf voneinander völlig unabhängigen Fragmente nehmen einzelne Details aus den anderen Teilen auf, spielen auf Ereignisse der vorhergehenden Seiten an und leisten ihren Beitrag, um Erzählstränge fortzuführen oder verständlich zu machen, so dass sie in der tiefen Struktur des Gesamtwerkes nicht nur in Kontakt stehen, sondern elementar miteinander verbunden sind. Das Buch beginnt mit dem „Teil der Kritiker“. Darin erzählt Bolaño die Geschichte von drei Philologen und einer Philologin, die sich intensiv mit dem Werk des zwar verschollenen, aber wichtigsten deutschen Nachkriegsautoren Benno von Archimboldi (ein Thomas Pynchon seiner Zeit) auseinandersetzen. Auf Kongressen und wissenschaftlichen Tagungen lernen sie sich kennen und schätzen. Die Engländerin Liz Norton geht auf die Avancen des Franzosen Jean-Caude Pelletier ein und beginnt mit ihm eine leidenschaftliche Affäre. Zeitgleich kommt sie dem Spanier Manuel Espinoza näher und lässt sich auch mit ihm auf ein amouröses Abenteuer ein. Espinoza und Pelletier erfahren von dem jeweiligen Konkurrenten, tolerieren aber die ménage à trois mit der leidenschaftlichen Britin. Der querschnittsgelähmte Piero Morini ist zunächst nur Zaungast in diesem bunten Spiel der Lust, welches Bolaño im ersten Teil entwirft und den Leser in einer unheilvollen Sicherheit wähnen lässt. Die eigentliche Erzählung der gemeinsamen Suche nach Archimboldi kulminiert in einer Reise nach Mexiko, die Pelletier, Espinoza und Norton unternehmen, da Archimboldi dort gesehen worden sein soll. Sie landen in der mexikanischen Grenzstadt Santa Teresa, in der sich ihre Suche im sprichwörtlichen Sande der mexikanischen Steppe verläuft. Liz Norton beschließt, nach Europa zurückzukehren, während Pelletier und Espinoza weiter nach Archimboldi suchen wollen. Der zweite Teil, der kürzeste des ganzen Buches, widmet sich dem fünfzigjährigen chilenischen Professor Amalfitano. Dieser tauchte bereits im ersten Teil als Begleiter und Touristenführer der drei Archimboldianer in Santa Teresa auf. Amalfitano ist über Spanien nach Santa Teresa gekommen und seinerseits als Archimboldi-Experte an der dortigen Universität gelandet. In der Figur scheint Bolaño Teile seiner Biografie verarbeitet zu haben, denn auch er lebte als Exilchilene zeitweilig in Spanien und Mexiko. Amalfitanos Geschichte ist schnell erzählt. Er ist eine gescheiterte Existenz, von seiner (geisteskranken) Frau verlassen und allein gelassen mit seiner Tochter Rosa. Es war eher der Zufall, der ihn nach Santa Teresa getrieben hat. Nun vegetiert er in dieser Stadt des Übergangs, ohne Perspektive, weder für sich noch für seine Tochter. Zumal in der nordmexikanischen Stadt, die der Ciudad Juárez nachempfunden ist, rätselhafte Frauenmorde stattfinden, die kein Ende nehmen und er so seine Tochter in permanenter Bedrohung sieht. Dieser kurze Teil ist lediglich ein literarisches Zwischenspiel, ein Intermezzo vor dem Gemetzel, und stellt die sprachliche Brücke in Dantes Inferno dar, in das Bolaños Erzählung in den Folgekapiteln verlagert wird. Denn der Abgrund namens „Santa Teresa“ wird nun für fast 500 Seiten nicht mehr verlassen. Der dritte Teil widmet sich dem Journalisten Oscar Fate, der nach Santa Teresa fährt und von dort über den Boxkampf eines amerikanischen Newcomers berichtet. Fate interessiert sich aber mehr für die Frauenmorde und weniger für den Boxkampf – doch steht er damit ziemlich allein da. Denn für die schreibende Zunft ist der Fall der Frauenmorde glasklar. Santa Teresa ist Drogengebiet und „mit Sicherheit gebe es dort nichts, was nicht auf die eine oder andere Weise mit dem Drogenhandel zusammenhängt.“ Der Amerikaner lernt die junge Rosa, bekannt als die Tochter Amalfitanos aus dem zweiten Teil, kennen. Der chilenische Professor bittet den Journalisten, seine Tochter in die USA und damit in die Sicherheit zu bringen, aber Sicherheit ist in Bolaños Welt nicht vorgesehen. Der Abgrund Mexikos, den er ins Zentrum des vierten Teils rückt, öffnet hier erstmals seinen Schlund – und der Leser tappt zwangsweise in die Falle.
Im „Teil der Verbrechen“
beschreibt Bolaño auf 350 Seiten in kriminologischer Akribie mehr als einhundert
Morde an Frauen in Santa Teresa. Nahezu alle werden missbraucht und auf die
abscheulichsten Arten geschändet. Der Chilene lässt nichts aus, schont seine
Leser hier auf keiner einzigen Seite. In dem Playboy-Interview kurz vor
seinem Tod sagte er, dass er lieber Kriminalbeamter als Schriftsteller geworden
wäre. Diese heimliche Leidenschaft lebt er in diesem Kapitel aus. Gefühlte
Hundertschaften an Frauen aus allen Schichten kommen in diesem Kapitel ums
Leben. Hier ist er, der Friedhof im Jahr 2666, der am Ende vergessen sein wird. Der letzte „Teil von Archimboldi“ widmet sich zunächst einer Figur mit dem Namen Hans Reiter, der als Wehrmachtssoldat während des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa im Einsatz ist. Reiter wird Zeuge und Täter der unzähligen Verbrechen der Wehrmacht. Und was er nicht selbst erlebt oder vollzieht, liest er in den verwirrenden autobiografischen Dokumenten eines gewissen Ansky, der in der russischen Armee seinen Dienst geleistet hat. Bolaño stellt hier der gerade gelesenen Grausamkeit der Gegenwart in Mexiko die Abscheulichkeit der Geschichte in Europa gegenüber. Denn irgendwie hängt alles zusammen. Das muss der Leser inzwischen vermuten. Nach dem Krieg entkommt Reiter den Säuberungen durch die Amerikaner, ob aufgrund seines nicht allzu hohen Dienstgrads oder aus lauter Zufall, wird nicht geklärt. Er beginnt zu schreiben, doch um mit seinem Namen bei den Verlagen nicht doch vielleicht unnötig aufzufallen, wirkt er unter dem – der Leser kann es sich inzwischen denken – Pseudonym Benno von Archimboldi. Mit wachsendem literarischem Erfolg zieht sich Archimboldi immer weiter zurück, bis schließlich nur noch die Gattin des Verlegers eine Ahnung davon hat, wie und wo man ihn erreichen kann. In diesem letzten Teil fügen sich die einzelnen Bruchstücke der übergreifenden Erzählung wie bei einem Puzzle zusammen. Klaus Haas, der in Mexiko als Hauptverdächtiger einsitzende Deutsche, ist der Sohn von Reiters bzw. Archimboldis Schwester. Lotte Reiter heiratete nach dem Krieg den Mechaniker Werner Haas, Klaus ist ihr gemeinsamer Sohn. Ihren geliebten und großen Bruder sah Lotte Reiter nach dem Krieg nie wieder, ging davon aus, dass er im Kampf gefallen ist. Jahrzehnte nach dem Krieg erkennt sie bei der Lektüre eines Archimboldi-Romans ihre eigene Geschichte und macht sich auf die Suche nach ihrem Bruder. Es kommt zu einem Wiedersehen – hier ist Bolaño geradezu wortkarg – und Archimboldi macht sich auf nach Mexiko zu seinem Neffen. Hier endet der Roman und beginnt zugleich wieder von vorn, bei den Kritikern, die ihr Leben seinem Werk widmen und sich auf die Suche nach dem einflussreichsten Nachkriegsschriftsteller Deutschlands machen, der irgendwo in Mexiko zu sein scheint, in diesem Nirgendwo voller Gleichgültigkeit und Grauen. Kein anderer Roman trifft die Realität des mittelamerikanischen Staates derart passgenau, wie Bolaños Meisterwerk. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn Roberto Bolaños Opus Magnum Juan Rulfos Totentanz „Pedro Paramo“ als Mexikos Nationalroman ablösen wird. Wenn große Literatur Flügel hätte, dieser 1.085 Seiten starke und knapp 1,2 Kilo schwere Roman könnte sich spielend in die Lüfte erheben. Dass dieser Eindruck entsteht, ist auch der grandiosen Übersetzung von Christian Hansen zu verdanken, der Bolaños Mix aus chilenischem, katalanischem und mexikanischem Slang passend in deutsche Soziolekte übertragen hat und den Figuren so ihre Individualität und Identität erhalten hat. Bolaños Erzählstil ist ihm aus den früheren Romanen des Chilenen vertraut und dennoch muss diese Mischung aus überbordender Informationsflut bei größtmöglicher Detailverliebtheit, die doch nichts anderes will, als die großen Linien zeichnen und Grenzpfähle aufstellen, immer wieder eine ungemeine Herausforderung für Hansen sein. Eine weitere der Herausforderungen ist die Perspektivenfülle, die Bolaño in „2666“ an den Tag legt. So ist sein Erzähler nicht einfach nur ein auktorialer Draufblicker und Berichterstatter, sondern er ist der Kameramann, der dem Leser die Bilder liefert, die er zum Verständnis braucht. Diese sprachlichen Bilder, Bolaños Bilder, sind von seltener Ausdruckskraft und Konkretheit. Der Chilene (und Christian Hansen in der Übersetzung) lässt uns das Erzählte derart konkret und greifbar vor die Augen treten, dass es physische Gestalt annimmt: „In dieser Nacht fand Reiter keinen Schlaf, und der Vollmond drang durch die Zeltleinwand wie kochender Kaffee durch eine als Filter verwendete Socke.“ Zugleich überlässt Bolaños Erzähler einzelnen Figuren immer mal wieder das Terrain und lässt sie ihre Geschichte erzählen. Die Personalausstattung des Romans macht dabei deutlich, dass Bolaño Zeit seines Schriftstellerlebens weniger an verschiedenen Romanen, sondern vielmehr an einem Gesamtkunstwerk gestrickt hat, denn seine Romanfiguren, Themen und Schauplätze ziehen sich über die Grenzen der Buchdeckel hinweg durch seine verschiedenen Romane und Erzählungen und tauchen immer wieder auf. Sein Roman ist außerdem mit selten zu lesenden Metaphernketten gefüllt, die nicht einfach nur die Textmenge vergrößern, sondern eine dramaturgische Wirkung haben. „Kitsch“ ist dann nicht einfach nur Kitsch, sondern „Sentimentalität“, „Zärtelei“, „Affektiertheit“, „Schwulst“, „das Gekünstelte“ und „Kindische“, gegen das man schon immer angekämpft hatte. Derlei Aneinanderreihungen von sinnverwandten, nicht sinngleichen (!) Worten verwendet Bolaño in „2666“ immer wieder, um seine Sätze Höhepunkten entgegen zu treiben und auf das Wesentliche seiner Aussagen zu kommen. Ein ähnliches Mittel, dass er immer wieder einsetzt, sind Teilsatzketten, die dem Leser die größtmögliche Aufmerksamkeit abverlangen. Bereits am Anfang des Romans zieht sich ein Satz über mehr als fünf Seiten, der den Leser kaum zu Atem kommen lässt. Dieser Satz reißt ihn fort auf eine Rückwärtsreise durch Zeit und Raum (Robert Zemeckis „Zurück in die Zukunft“ lässt grüßen), angefangen im Amsterdam des Jahres 1995 und endend im Buenos Aires der 1920er Jahre – über fünf Seiten. Auch wenn dies zugegebenermaßen der längste Satz des Romans ist, sind ähnliche, wenn auch etwas kürzere Satzketten keine Seltenheit. All diese Herausforderungen hat Hansen als Übersetzer nicht nur angenommen, sondern grandios bewältigt. Es wäre alles andere als verwunderlich, wenn er für diese Leistung mit dem Übersetzerpreis auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse ausgezeichnet würde. Bolaños schier endlose Aneinanderreihungen von Teil- und Halbsätzen führen immer tiefer hinab in die verschiedenen Ebenen des Romans und entlassen den Leser nicht mehr. Vielmehr verstricken sie ihn in das Geschehen, lassen ihn fast physisch am Erzählten teilhaben und die Bilder, die dies wiederum evoziert, in den Roman einfließen. Insofern ist Roberto Bolaño nicht nur ein Erzähler ersten Ranges, sondern ein schreibender Menschenfänger, der seinen Lesern nahezu unbemerkt mit den allerschönsten Mitteln der Literatur sanft die Handschellen anlegt und sie zum Teil seines Romans macht. Daher
muss an dieser Stelle eine abschließende Warnung ausgesprochen werden, die
vorzubehalten einer Fahrlässigkeit gleichkäme. Wer diesen Roman liest, wird zum
Bolañoaner, zum Anhänger vielleicht des genialsten und faszinierendsten
Erzählers der Gegenwart. |
Roberto Bolaño |
||
|
|
||||