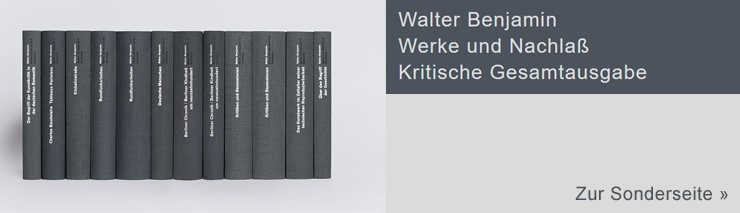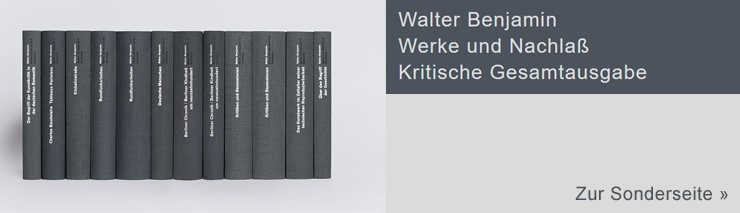|
Walter Bendix Schoenflies Benjamin
*15.07.1892 in
Berlin, †26. 09.1940 in Portbou
 »Spur und Aura. Die Spur ist Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag, was
sie hinterließ. Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was
sie hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft; in der Aura bemächtigt
sie sich unser.« »Spur und Aura. Die Spur ist Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag, was
sie hinterließ. Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was
sie hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft; in der Aura bemächtigt
sie sich unser.«
Walter Bendix Schoenflies Benjamin wurde am 15. Juli 1892 als Sohn des
Antiquitäten- und Kunsthändlers Emil Benjamin (1856-1926) und dessen Frau
Pauline (1869-1930) (geb. Schoenflies) in Berlin-Charlottenburg geboren.
Seine Kindheit erlebte Benjamin überwiegend in Berlin. In den Jahren 1905 bis
1907 war er Schüler der Hermann-Lietz-Reformschule Haubinda in Thüringen. Sein
Abtur legte er 1912 an der Kaiser-Friedrich-Schule ab und begann ein Studium der
Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität
in Freiburg. Dort freundete er sich mit dem Dichter Christoph Friedrich Heinle
an, dessen Freitod im August 1914 Benjamin hart traf. Er widmete Heinle mehrere
Sonette. Sein Versuch, für dessen hinterlassenes Werk einen Verleger zu finden
scheiterte jedoch.
1915 lernte Benjamin den Mathematikstudenten Gershom Scholem kennen, mit dem ihn
eine lebenslange Freundschaft verband.
1917 heiratete Benjamin Dora Kellner. Aus der Ehe ging der Sohn Stefan Rafael
(11. April 1918 - 6. Februar 1972) hervor.
Im gleichen Jahr ging Benjamin nach Bern. Dort schrieb er zwei Jahre an seiner
Dissertation Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, die er am
27. Juni 1919 mit der Bestnote summa cum laude bestand.
Nach seiner Rückkehr nach Berlin betätigte sich Benjamin als freier
Schriftsteller und Publizist.
1921 wurde seine Übersetzung von Baudelaire-Gedichten veröffentlicht. In diesem
Jahr erwarb er auch das berühmt gewordene Bild von Paul Klee mit dem Titel
Angelus Novus. Aus seinem ambitionierten Versuch, eine Zeitschrift gleichen
Namens herauszugeben, wurde jedoch aus finanziellen Gründen nichts, und Benjamin
ging 1923/24 mit der Abdsicht nach Frankfurt am Main, sich dort zu habilitieren.
Er lernt Theodor W. Adorno und Siegfried Kracauer kennen. Seine umstrittene
Habilitationsschrift Ursprung des deutschen Trauerspiels fand jedoch nicht die
erwartete Zustimmung der Verantwortlichen; und Benjamin zog sein
Habilitationsgesuch zur Vermeidung einer offiziellen Ablehnung 1925 zurück.
Von 1926 bis 1927 hielt Benjamin sich in Paris auf, wo er mit seinem Freund
Franz Hessel an der Übersetzung von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit arbeitete.
Von Dezember 1926 bis Februar 1927 besuchte er seine Freundin Asja Lacis in
Moskau. Ein Aufenthalt, der für ihn in jeder Hinsicht enttäuschend verlief und
in seinem Moskauer Tagebuch sehr eindrücklich beschrieben wird.
Neben feuilletonistischen Arbeiten und dem freundschaftlichen Kontakt zu Brecht,
fällt auch das Erscheinen seines Buches Einbahnstrasse in diese publizistisch
fruchtbare Lebensphase.
1932 begann er an dem Buch über seine Kindheit und Jugend, Berliner Kindheit um
Neunzehnhundert, zu arbeiten, von dem zu Lebzeiten allerdings nur einige Kapitel
in der Frankfurter Zeitung erschienen sind.
Nach der Machtergreifung der Nazis drängten ihn Freunde, Berlin zu verlassen.
Benjamin ging im September 1933 nach Paris ins Exil. Dort machte er u.a. auch
die Bekantschaft mit Hannah Arendt, die den fast mittellosen Benjamin
unterstützte.
Seinen bescheidenen Lebensunterhalt bestritt Benjamin durch ein kärgliches
Mitarbeitergehalt, das ihm das längst nach New York emigrierte Institut für
Sozialforschung überwies.
Benjamin war von 1937 bis 1939 Mitglied des von Georges Bataille, Michel Leiris
und Roger Caillois ins Leben gerufene Collège de Sociologie sowie Batailles
Geheimgesellschaft Acéphale.
1939 wurde Benjamin mit vielen deutschen Flüchtlingen für drei Monate in dem
Sammellager bei Nevers interniert.
Seinen letzten Text, die Thesen Über den Begriff der Geschichte, schrieb
Benjamin im November 1939. Nach dem Überfall der Deutschen auf Polen und dem
Bekanntwerden des Hitler-Stalin-Paktes flüchtete der mittellose und herzkranke
Benjamin zunächst nach Lourdes und schließlich über Marseille nach Portbou an
die Grenze zu Spanien. Im September 1940 versuchte er mit Hilfe von Lisa Fittko
vergeblich nach Spanien zu gelangen. Als er mit seiner Auslieferung an die
Deutschen unmittelbar am nächsten Tag rechnen mußte, nahm er sich wahrscheinlich
in der Nacht vom 26. auf den 27. September 1940 mit Morphin das Leben. Es gibt
allerdings auch von dieser herrschenden Auffassung abweichende Meinungen, die
belegen wollen, dass Benjamin ermordet worden sei.
|

Angelus
novus ,
1920, 32,
Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton, 31.8 x 24.2 cm
Collection of the the Israel Museum, Jerusalem, Schenkung John
und Paul Herring, Jo Carole und Ronald Lauder, Fania und Gershom Scholem
Walter Benjamin
und die
europäische Moderne
Ein kurze Einführung in sein Denken von Jürgen Nielsen-Sikora
Die europäische Moderne
bietet kein einheitliches Bild. Ihr Prozessverlauf muss angesichts der
verschiedenen Zeit-, Raum- und Gesellschaftshorizonte als heterogen bezeichnet
werden. Im Zentrum dieser Heterogenität steht eine Idee von Fortschritt, die es
näher zu bestimmen gilt. In diesem Kontext ist insbesondere das
Interdependenzverhältnis von Progression und Bedrohung, von Entwicklung und
Krise zu bedenken. Es spiegelt sich nicht zuletzt im dialektischen Spannungsfeld
von Fortschrittsideologie einerseits und Archaik und Mythos andererseits wider.
weiterlesen
Nomade auf Sammlerschaft
Ein literarischer Parcours für neugierige Nachgeborene.
Von Herbert Debes
Nachdem Walter Benjamins Flucht vor den Nationalsozialisten 1940 mit seinem Tod
am 26. September im französisch spanischen Grenzort Portbou jenes tragische und
bis heute von Verschwörungstheorien umschwirrte Ende genommen hatte, war
keineswegs abzusehen, welche Bedeutung Walter Benjamins Werk & Persönlichkeit
für die Nachwelt einmal haben würde.
weiterlesen
Der Kampf um die Armbinde
Von Friedhelm Lövenich
Walter Benjamins allegorische Wissenschaft
»Der
Intellektuelle ist der geborene Feind des Kleinbürgertums, weil er es ständig in
sich selbst überwinden muß.«
Kaiserpanorama
Reise durch
die Deutsche Inflation
Von Walter Benjamin
Artikel
lesen
I. In dem
Schatze jener Redewendungen, mit welchen die aus Dummheit und Feigheit
zusammengeschweißte Lebensart des deutschen Bürgers sich alltäglich verrät, ist
die von der bevorstehenden Katastrophe - indem es ja »nicht mehr so weitergehen«
könne - besonders denkwürdig.
Linke
Melancholie
(1931)
Ein rhetorisches Glanzstück:
Benjamins Tirade gegen:
»...Die
linksradikalen Publizisten vom Schlage der Kästner, Mehring oder
Tucholsky sind die proletarische Mimikry
des zerfallenen
Bürgertums.«
Kritik lesen
Walter Benjamin
Die
Kunst der Kritik
Von Jürgen Nielsen Sikora
Artikel lesen
Über
Band 13 der Kritischen Gesamtausgabe,
welche die Kritiken und Rezensionen Walter Benjamins versammelt.
»Benjamin bringt mit seinen Kritiken und Rezensionen die Kulissen
zum Einsturz. Es ist mehr als überfällig, sie zu einer ebenbürtigen
Form der Literatur zu promovieren.«
»Bei Kafka schweigen die Sirenen.«
 Der
große Essay: Der
große Essay:
Franz
Kafka
Zur zehnten
Wiederkehr seines Todestages
Von Walter Benjamin
Potemkin
Es wird erzählt: Potemkin litt an schweren
mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrenden Depressionen, während deren sich
niemand ihm nähern durfte und der Zugang zu seinem Zimmer aufs strengste
verboten war. Am Hofe wurde dieses Leiden nicht erwähnt, insbesondere wußte man,
daß jede Anspielung darauf die Ungnade der Kaiserin Katharina nach sich zog.
Eine dieser Depressionen des Kanzlers dauerte außergewöhnlich lange.
weiterlesen
|