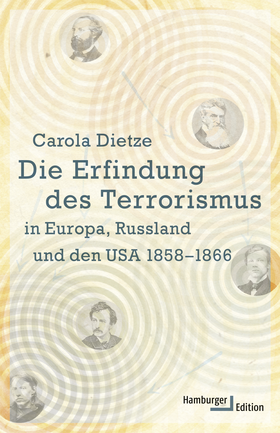|
Termine Autoren Literatur Krimi Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme |
|||
|
|
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendEin großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Ex. mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
|
Die Verwandlung der Welt
durch den modernen Terrorismus |
||
|
Carola Dietzes Studie liefert eine Theorie des Terrorismus, die sie anhand von
fünf Fallbeispielen auf die Probe stellt: Felice Orsinis Attentat auf Napoleon
III., John Browns Überfall auf Harpers Ferry (West Virginia), Oskar Wilhelm
Beckers Attentat auf Wilhelm I. sowie die Ermordung Abraham Lincolns durch John
Wilkes Booth und schließlich Dmitrij Karakozovs Anschlag auf Zar Alexandr II. Ziel und Aufbau des Buches Die
gekürzte und überarbeitete Fassung einer ursprünglich als Habilitationsschrift
verfassten Studie zum Terrorismus möchte die gängigen wissenschaftlichen
Narrative zur Geschichte des Terrorismus überprüfen, neue Zusammenhänge
aufzeigen und ein besseres Verständnis zur Gegenwart des Terrorismus
herausarbeiten. Mit den Fallbeispielen sollen die Anfänge des Terrorismus
erklärt werden, um nicht zuletzt die Gegenwart des Terrors besser
nachvollziehbar zu machen. Die
„Erfindung des Terrorismus“ berücksichtigt in den oben genannten Fallbeispielen
sowohl den historischen Kontext der Taten als auch die politischen Dynamiken,
die Vorbilder der Terroristen, deren Weltbilder, ihre Ideen und Netzwerke. Der Angriff auf politische und öffentliche Personen als Vertreter der sozialen und ökonomischen Ordnung unterscheidet sich, so eine der Thesen des Buches, grundlegend von vormodernen Varianten des Terrorismus wie man sie bei den jüdischen Sacarii, den Assassinen oder den indischen Thugs vorfindet: Der moderne Terrorismus ist ein abstrakter Kampf gegen die gesellschaftliche Ordnung, doch keine Wiederherstellung der Ordnung durch Gewalt oder Beseitigung bestimmter Personen. Die Wirkung der Taten auf Dritte wird wichtiger als die Tat selbst. Das Buch arbeitet dies heraus und zeigt die veränderten Vorzeichen auf. Die terroristische Forderung lautet fortan: Politische Partizipation und nationale Souveränität, persönliche Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde und versteht sich als Fortsetzung der großen Revolutionen mit anderen Mitteln. Die politischen Ideale der Französischen Revolution sowie deren Umsetzung und Verbreitung sind maßgeblich für alle terroristischen Aktivitäten zur Jahrhundertmitte. Die revolutionären Prinzipien Demokratie, Nationalismus und persönliche Freiheit leiten die Ideen der Attentäter. Theoretische Prämissen Dietze geht zunächst auf die Problematiken einer Begriffsbestimmung des Terrorismus ein und konstatiert, es gäbe einen kleinsten gemeinsamen Nenner aller Definitionen, die Peter Waldmann bereits herausgearbeitet habe. Demzufolge ist Terrorismus als planmäßig vorbereitete, schockierende Gewalttat gegen die politische Ordnung zu verstehen; eine Tat, die das Ziel verfolgt, einerseits Schrecken zu verbreiten, andererseits Sympathien hervor zu rufen. Moderner Terrorismus sei die spektakuläre Gewaltanwendung mit dem Ziel, einen starken psychischen Effekt wie Angst in der Gesellschaft zu erzeugen, um eine politische Veränderung herbeizuführen. Insofern sei der Terrorismus des 19. Jahrhunderts eine Abart der Emanzipationsbewegungen und in verschiedenster Ausprägung nachweisbar: Entweder ist er sozialrevolutionär, ethnisch-nationalistisch oder rechtsradikal (heute unter Umständen auch religiös) motiviert. Die Französische Revolution bildet in allen drei Varianten stets den Vorraum dieser Formen des modernen Terrorismus. Hinzu
kommt, dass einige gesellschaftliche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen: Die
Existenz sozialer Bewegungen, die Komplexität moderner Gesellschaften, die
Urbanisierung, Massenmedien und verbesserte Kommunikations- und
Transportbedingungen. Es bedarf zudem des Vorhandenseins gesellschaftlicher
Missstände und der Vorstellung, die Zustände seien veränderbar. Auch ein Mangel
an politischen Partizipationsmöglichkeiten sei ebenso eine Voraussetzung wie
aufständische Traditionen und die Unzufriedenheit mit der gesellschaftlichen
Elite. Fallbeispiele Die von Carola Dietze umfangreich skizzierten fünf Fallbeispiele sollen zeigen, dass der moderne Terrorismus um 1860 erfunden wurde. Den Auftakt terroristischer Gewalt macht hierbei Felice Orsini
Orsini ist ein Anhänger der revolutionären italienischen Bewegung, seine Familie
ist Teil eines weit verzweigten Adelsgeschlechts. Anfangs ist er Mitarbeiter
Giuseppe Mazzinis, wird jedoch später aus der Bewegung verbannt. John Brown John Brown stammt aus Conneticut. Die Familie übt die Berufe des Gerbers, des Schuhmachers und Farmers aus. Brown ist Mitglied der abolitionistischen Bewegung. Sie fordert gleichberechtigte Teilhabe an der amerikanischen Gesellschaft für alle Afroamerikaner, ein Ende der Sklaverei und der Diskriminierung. Es ist eine vom messianischen Protestantismus inspirierte moralische Bewegung, die sich die Fortsetzung und Vollendung der amerikanischen Revolution als Ziel gesteckt hat. Für sie ist die Sklaverei die Summe aller Verbrechen. Die
Radikalisierung Browns erfolgt laut Dietze um 1839. Brown glaubt, Gott habe ihn
beauftragt, die Sklaven zu befreien. Aus diesem Grunde greift er mit
Unterstützung einiger Gleichgesinnter die Stadt Harpers Ferry mit dem Arsenal
und den Waffenmanufakturen des US-Militärs an. Sein Überfall auf eine
militärische Einrichtung kalkuliert ganz bewusst mit der öffentlichen Wirkung. Weiterentwicklung des Terrors durch Nachahmer
Weitere drei Anschläge interpretiert Dietze als terroristische Nachahmer, die
jedoch zugleich den Terror weiterentwickelt hätten. Artikel online seit 01.02.17 |
Carola Dietze
|
||
|
|
|||