Die Beschreibung von Sex in der Literatur ist ein Sujet, an dem sich viele Autor*innen, auch solche, die ansonsten sprachlich gewandte Stilist*innen sind, die Zähne ausbeißen. Nicht umsonst gibt es den Bad Sex in Fiction Award, der jedes Jahr an die schlechteste literarische Beschreibung von Sex vergeben wird und der besonders häufig Männern zu gesprochen wird. Nominiert war im vergangenen Jahr unter anderem der ewige Nobelpreisanwärter Haruki Murakami mit einer Szene aus Killing Commendatore
My ejaculation was violent, and repeated. Again and again, semen poured from me, overflowing her vagina, turning the sheets sticky. There was nothing I could do to make it stop. If it continued, I worried, I would be completely emptied out.
„Befremdlich“ wäre noch eine wohlwollende Umschreibung für diese Darstellung und man fragt sich zwangsläufig, warum gute Schriftsteller gerade an diesen Stellen ihr Talent zu verlassen scheint. Denn unter den Preisträger*innen der letzten 25 Jahre, solange existiert der Preis, befinden sich 22 Männer und darunter durchaus so renommierte Autoren wie Jonathan Littel, Norman Mailer und Tom Wolfe. Wenn es Männern also offenkundig schwerfällt, gut über Sex zu schreiben und man genügend Beispiele dafür findet, stellt sich die Frage, ob Frauen es einfach besser können oder ob sie schlicht weniger über Sex schreiben.
Dafür dass natürlich auch Frauen über Sex schreiben, ist die französisch-marrokanische Autorin Leïla Slimani (*1981) ein aktuell viel diskutierter Beweis. Die 2016 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnete Schriftstellerin ist aktuell der Shootingstar der französischen Literatur und ihr Debütroman All das zu verlieren (Original: Dans le jardin de l’ogre, 2014) erschien gerade in deutscher Übersetzung. Ein neues weibliches Schreiben über „die düsteren, dreckigen, brutalen Abgründe der Sexualität“ sei das, behauptet Mara Delius in der WELT, aber ist es das oder besteht nur der dringliche Wunsch nach einem solchen Schreiben?
All das zu verlieren handelt von Adèle, Mitte 30 und Journalistin in Paris, sie ist verheiratet mit Richard, einem Arzt, mit dem sie einen kleinen Sohn, Lucien, hat. Die Stadtwohnung ist eigentlich zu klein und Paris zu laut und zu eng, deswegen plant Richard schon länger irgendwann ein Haus auf dem Land zu kaufen. Eine derart angelegte Szenerie der spießigen Bürgerlichkeit im zentralistischen Frankreich, wo der Gegensatz von Landhaus in der Provinz und Stadtwohnung in Paris in wohlhabenderen Kreisen dem Klischee des deutschen Reihenhauses gleichkommt, baut bereits eine Fallhöhe auf, die auf einen dramatischen Verlauf hindeutet. Doch der Roman endet nicht mit der Katastrophe, er steigt mitten in sie ein. Adèle ist nämlich nichts weniger als die gewissenhafte Journalistin, umsorgende Mutter und liebende Ehefrau, das alles bildet lediglich die Fassade für ihre zerstörerische Sexsucht, deren Zwänge, Neurosen und Ekstasen Slimani in filmischer Hatz beschreibt:
Allein in der Küche tritt sie von einem Fuß auf den anderen und raucht eine Zigarette. Unter der Dusche würde sie sich am liebsten die Fingernägel in die Haut bohren, sich entzweireißen. Sie schlägt die Stirn gegen die Wand. Sie will, dass man sie packt, dass ihr Kopf gegen die Scheibe prallt. Sobald sie die Augen schließt hört sie die Geräusche, das Stöhnen, die Schreie, das Klatschen der Körper. Ein nackter, keuchender Mann, eine Frau, die kommt. Sie will nur ein Objekt in Mitten einer Meute sein. Gefressen, ausgesaugt, mit Haut und Haaren verschlungen werden. Sie will in die Brust gekniffen, in den Bauch gebissen werden. Sie will eine Puppe im Garten eines Ungeheuers sein.
Sex so beschreiben, dass es nicht zu einer peinlichen Erfahrungen beim Lesen wird, auch wenn der Sex mal brutal, mal leidenschaftlich und mal enttäuschend ist, gelingt Slimani, das sei an dieser Stelle schon gesagt. Während diese Szene als die Sehnsucht einer Frau nach leidenschaftlichem, zuweilen schmerzhaftem Sex gesehen werden kann, wird über den Verlauf des Romans mehr und mehr deutlich, dass Adèle die Zwänge ihres bürgerlichen Familielebens nur durch die Zwänge eines ausschweifenden Sexuallebens, das weniger aus Lust als aus Sucht genährt wird, ersetzt. Die One-Night-Stands mit fremden Männern, die Quickies in nächtlichen Hofeinfahrten und die Affären mit Kollegen und Bekannten sind selten Quell der Befriedigung und der erfüllenden Ekstase, sondern meist der erzwungene Versuch, dem ätzenden Alltag eine verbotene, rauschhafte Alternative gegenüberzustellen. Entscheidend ist, dass der Versuch hilflos bleibt. Die Grundausrichtung des Romans mit einer Frau, die aus den familiären Zwängen ausbricht und ihre Sexualität heimlich und verboten auslebt, könnte die Basis für eine Emanzipationsgeschichte sein. Adèle jedoch begibt sich von einem Gefängnis in das nächste. Was sie nicht findet, sind Vergnügen und Freiheit.
Bekannten sind selten Quell der Befriedigung und der erfüllenden Ekstase, sondern meist der erzwungene Versuch, dem ätzenden Alltag eine verbotene, rauschhafte Alternative gegenüberzustellen. Entscheidend ist, dass der Versuch hilflos bleibt. Die Grundausrichtung des Romans mit einer Frau, die aus den familiären Zwängen ausbricht und ihre Sexualität heimlich und verboten auslebt, könnte die Basis für eine Emanzipationsgeschichte sein. Adèle jedoch begibt sich von einem Gefängnis in das nächste. Was sie nicht findet, sind Vergnügen und Freiheit.
Darin gleicht sie dem Protagonisten Brandon in Steve McQueens Film Shame (2011), gespielt von Michael Fassbender. Der erfolgreiche New Yorker Geschäftsmann kann seine Sexsucht nur mühsam hinter dem gut sitzenden Anzug und dem perfekten Körper verstecken, seine Nächte sind ein verzweifelter Versuch Körper und Geist zu befriedigen, sei es durch Pornographie, mit Prostituierten oder mit Frauen, die er in Bars anspricht. Der gezeigte Sex ist das Gegenteil einer befriedigenden und leidenschaftlichen Erfahrung, was in der Verkrampfung und der Wut in Brandons Gesicht beeindruckend deutlich wird – sein ganzes Leben ist auf den kurzen, immer wiederkehrenden sexuellen Akt reduziert, alles andere verschwindet hinter dieser Sucht. Auch wenn Brandon am dramatischen Höhepunkt des Films aufgrund seiner Sexsucht mitansehen muss, wie seine Schwester, deren Hilferufe er über die gesamte Handlung nicht bemerkt, einen Suizidversuch begeht, ist Adèles Fallhöhe dramatischer. Und gerade darin ist All das zu verlieren lehrreich und seltsam konservativ.
Adèles Ehemann, Richard, ist ohne Zweifel kein feministischer Traumpartner, sondern eher ein verunsicherter Ehemann, der seine Position zwischen klassischer Rollenverteilung mit männlicher Stärke und seiner eigenen Unsicherheit nicht findet, weil er einerseits das etablierte Rollenklischee erfüllen will, andererseits aber eben nicht der souveräne Patriarch ist, der er meint sein zu müssen. Und auch deswegen wird er zum Kollateralschaden der Sexsucht seiner Ehefrau – das erste Opfer ist Adèle selbst. Brandons zerstörerisches Verhalten in Shame hat weniger Konsequenzen für die Menschen um ihn herum, auch wenn er eine moralische Verantwortung für seine Schwester hat, der er nicht nachkommt. Als alleinstehender Mann wird ihm weniger gesellschaftliche und vor allem familiäre Verantwortung auferlegt als der Ehefrau und Mutter Adèle. An dieser Stelle wird der Vergleich von All das zu verlieren und Shame interessant, weil deutlich wird, worin sich die Situationen von Brandon und Adèle unterscheiden.
Auch wenn Brandon von seiner verzweifelten Suche nach Sex innerlich zerstört wird und seine Schwester in Gefahr bringt, ist er selbst sein größter Gegner. Zum einen ist der gesellschaftliche Anpassungsdruck an Adèle größer und zum anderen bringt sie sich während des zwanghaften Sexes konsequent selbst in Gefahr, an einen gewalttätigen Mann zu geraten, vergewaltigt zu werden oder die Kontrolle anderweitig zu verlieren – damit befindet Adèle sich als Frau in einer strukturell bedingten Gefahr, in die Brandon gar nicht geraten kann. Das zeigt sich deutlich am Vergleich zweier ähnlicher Szenen. Während Brandons Schwester sich in seiner Wohnung die Pulsadern aufschneidet, hat Brandon Sex mit zwei weiblichen Prostituierten. Sein Gesicht drückt in diesem Moment verzweifelte Wut und Aggressivität aus. Beängstigend erkennt man in seinem Gesicht den schmerzhaften Zwang zum Orgasmus kommen zu müssen, bei dem die beiden Frauen auf erschreckende Weise nur Mittel zum Zweck sind. Adèle hingegen lädt sich, während ihr Mann schwerverletzt im Krankenhaus liegt, zwei männliche Prostituierte in die Wohnung ein und fordert sie auf, gewalttätigen Sex mit ihr zu haben und sie zu verletzen:
Sie hat es so gewollt. Sie kann es ihm nicht übelnehmen. […] Fünfmal, vielleicht zehn, hat er ausgeholt und sein spitzes, knochiges Knie auf ihre Scheide krachen lassen. Am Anfang war er noch vorsichtig. Er hat Antoine einen verblüfften, leicht spöttischen Blick zugeworfen, hat das Knie gehoben und mit den Achseln gezuckt. Er verstand nicht. Und dann hat er Geschmack daran gefunden, als er sah, wie sie sich wand, ihre Schreie hörte, die nicht mehr menschlich waren.
Sowohl Adèle als auch Brandon bestrafen sich letztlich auf psychisch schmerzhafte Weise selbst, der entscheidende Unterschied ist, dass Brandon als Mann immer noch in der aggressiv-dominanten Position ist, während Adèle sich der Gefahr schwerwiegender körperlicher Verletzungen aussetzt, allein, weil es Männer gibt, die ihren Wunsch nach Gewalt auch erfüllen und dabei weitere Grenzen überschreiten.
In dieser Hinsicht ist Slimanis Roman dann aufschlussreich, weil er aufzeigt wo, bei aller Parallelität der Situation, der entscheidende Unterschied zwischen einem sexsüchtigen Mann und einer sexsüchtigen Frau ist. Darunter fällt auch Adèles Verhältnis zu ihrem Sohn Lucien. Für Adèle als Frau und in diesem Fall Mutter ist im Angesicht traditioneller Rollenbilder ihre Vernachlässigung des Kindes ein weitaus größerer moralischer Skandal, als es das im umgekehrten Fall wäre. Aussagen wie „Lucien ist eine Last, eine Verpflichtung, an die sie sich einfach nicht gewöhnen kann.“ (S. 34) sind an sich schon ein Aufbrechen eines Tabus, weil solche Aussagen, ja bereits die Gedanken, von Müttern gesellschaftlich nicht akzeptiert werden. An dieser Stelle blitzt dann das emanzipative Potential des Perspektivenwechsels auf, verschwindet aber schnell wieder hinter der Erkenntnis, dass Adèle in erster Linie als eine Süchtige dargestellt ist.
Hier schwelt im Hintergrund stets die Frage, was die Alternative zu Adèles zerstörerischen sexuellen Eskapaden ist. Die bürgerliche Kleinfamilie ist das offensichtlichste Gegenüber, mit dem die Sexsucht kontrastiert wird und stellt aus Adèles Perspektive nur eine andere Form von Gefängnis und Zwang dar. Eine tatsächlich alternative Vision eines besseren Lebens bietet ihre Freundin Lauren. Die Distanz, die Adèle aber gegenüber ihrer Freundin an den Tag legt, deutet darauf hin, dass sie einerseits zwar diese Alternative erkennt, sie andererseits für sich selbst aber nicht als umsetzbar ansieht.
Da zeigt sich auch, warum der französische Titel besser ist als der deutsche. Der Originaltitel in wörtlicher Übersetzung ist Im Garten des Monsters oder der Bestie. Die Anspielung an einen Garten der Lüste, der sich aber als von einem Monster bewohnt entpuppt, entwirft eine Interpretationsambivalenz, ob ihre Sucht der gefährliche und zerstörerische Garten der Lüste ist oder ob das scheinbar sichere bürgerliche Familienleben ein trügerisches Paradies ist. In beiden Interpretationen jedoch steckt die Ambivalenz einer zerstörerischen Gefangenschaft in einer Situation, die theoretisch Befriedigung und Glück ermöglichen könnte. Der deutsche Titel hingegen legt mit der Angst all das zu verlieren den Fokus auf die Verluste, die durch ihre Sucht entstehen, und baut somit die traditionelle Familie als erstrebenswertere Alternative auf. Tatsächlich aber bleibt Adèle gefangen zwischen zwei Lebensentwürfen, die ihr beide keine Hoffnung ermöglichen.
Leïla Slimanis Debütroman ist also in gewisser Hinsicht ein guter Roman. Der flüssige Stil, der sich auch auf die Übersetzung überträgt, gepaart mit einer rasanten Erzählweise macht ihn zu leichtem Lesestoff mit schwerer Kost. Auch zeichnet Slimani die französische bürgerliche Oberschicht mit ihren konservativen Familienträumen und ihrer Pariser Dekadenz scharf in Szene gesetzt nach und kontrastiert sie gekonnt mit der zerstörerischen Sexsucht der Protagonistin. Die sexuellen Ausschweifungen Adèles stellen jedoch keine befreiende Alternative zu ihrem einengenden bürgerlichen Familienleben dar, sie sind letztlich nur Ausdruck eines ebenso zwanghaften und suchtgetriebenen Verhältnisses zu Sexualität. Damit fällt es schwer in All das zu verlieren einen emanzipatorischen Ansatz festzustellen, vielmehr handelt es sich um eine bedrückende Darstellung einer Sucht. Die Sucht als Grund für das Sexualverhalten der Protagonistin und die psychologisierende Andeutung dass Adèles zwanghaftes Sexualverhalten letztlich in ihre Kindheit zurückzuführen scheint, machen die Figur eher eindimensionaler als interessanter. Slimani hat bestimmt keinen Roman über die sexuelle Befreiung einer Frau geschrieben, aber sie macht deutlich, wo die gravierenden Unterschiede zu Männern in einer vergleichbaren Situation liegen, das ist dann zumindest teilweise lehrreich.





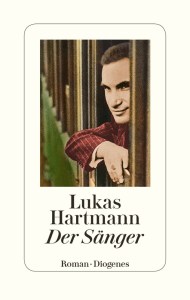





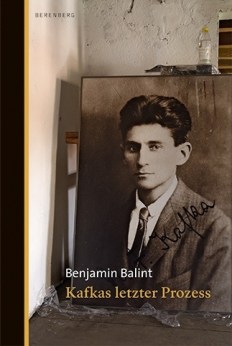
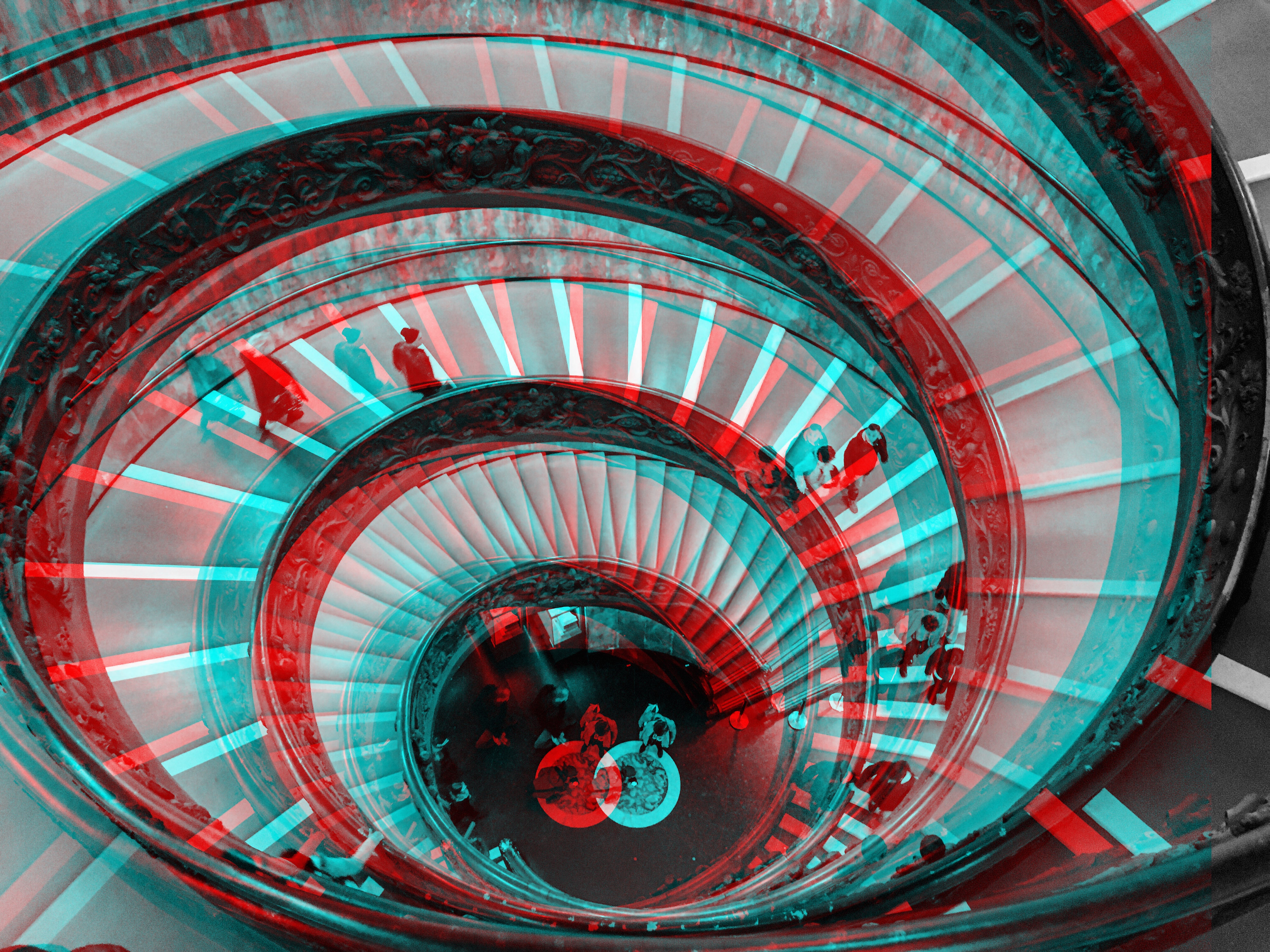
 so zu er
so zu er
