|

Alina Mazilu
mazilu.alina [at] gmail.com
geboren 1981; Studium
der Germanistik und
Romanistik in Temeswar.
Veröffentlichungen
in
rumänischen und
deutschen Medien,
Dramaturgin am Deutschen
Staatstheater Temeswar.

(c) Sonja Rothweiler

(c) Sonja Rothweiler

(c) Sonja Rothweiler
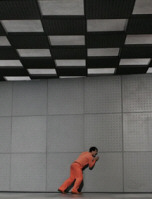
(c) Sonja Rothweiler

(c) Sonja Rothweiler
Linktipp
www.staatstheater.
stuttgart.de
Aurora-Tipp
Schwarze Jungfrauen
|
|
Für Volker Löschs
"Medea" am Stuttgarter Staatstheater gestaltete
Carola Reuther die Bühne als eine Drehscheibe mit einer metallisierten
beweglichen Trennwand, die geschoben wird und in ihrem Wirbel die Gestalten
mitnimmt, zerquetscht, wegdrückt oder bewegt – eine Trennwand, die zwei
Parallelwelten, zwei Kulturen, zwei Weltanschauungen separiert. Auf dieser
Drehfläche spielt sich die Handlung ab.
Die Geschichte ist
allgemein bekannt. Seit Euripides haben sich mehr als 200 Autoren von Ovid,
Seneca über Corneille, Anouilh bis hin zu Heiner Müller und Christa Wolf mit
diesem Stoff auseinandergesetzt. Medea ist eine der faszinierendsten
Gestalten der Weltliteratur: Die Außenseiterin, die Fremde, die Barbarin,
die die gut geregelte, steife, sterile, begrenzte zivilisierte Gesellschaft
durch ihre Alterität in Frage stellt.
Volker Löschs
Inszenierung wendet den antiken Stoff auf das Hier und Jetzt an. Die
Produktion beginnt mit türkischer Musik und Tanz. Der Regisseur stellt sich
vor, dass Medea unsere Zeitgenossin ist, aus der Türkei kommt und zurzeit in
Deutschland lebt. Diese Gedanken liegen dem Regiekonzept zu Grunde. Dafür
hat Lösch, zusammen mit seiner Dramaturgin Beate Seidel, den Euripides’schen
Text auf das Wesentliche reduziert und durch aktuelle Berichte türkischer
Frauen ergänzt.
Eine der ersten Szenen
präsentiert uns den Privatier Jason, einen molligen Teddybär (Sebastian
Nakajew ist sehr überzeugend in dieser Rolle), der mit seinen Söhnen Fußball
spielt. In der Folge wird er mal von Medea auf Türkisch angeschrieen, mal
klammert sich diese an ihn fest, mal bettelt sie. Mal gibt er seines
Gewissens wegen vor, ihr helfen zu wollen. Kreon (Florian von Manteuffel),
der Staatsmann mit Aktenkoffer, hält Diskurse über Freiheitskämpfer und
Terroristen, führt Einbürgerungstests durch. Er repräsentiert die
Öffentlichkeit. Medea ist sein Opfer. Ein Opfer, das bald zum Täter wird,
indem es zum Schluss seine Söhne umbringt – aus Wut, aus Eifersucht, aus
Verzweiflung.
Medea wird von
insgesamt neunzehn Frauen gespielt – die Hauptgestalt ist bei Lösch ein
neunzehnköpfiger Chor, gebildet aus drei Schauspielerinnen (die sich der
Reihe nach von der Gruppe lösen, zu Protagonistinnen in direkten
Auseinandersetzungen mit Kreon oder mit Jason werden, um sich dann wieder im
Chor aufzulösen) und sechzehn Laien – Frauen, die in Stuttgart und
Umgebung wohnen und türkischen Ursprungs sind. Frauen, die ihre eigenen
Lebenserfahrungen auf die Bühne bringen: "Ich bin
Muslimin, bin ich deshalb auch Terroristin?" Solche Fragen werden laut in
den Saal gebrüllt. Souverän alternieren Stille und Schreie der Verzweiflung.
Der Regisseur nimmt den
Puls der Gesellschaft in seine Inszenierung hinein. Sie polarisiert und
hat in den Medien heftige Kontroversen ausgelöst. Die Gründe sind vermutlich
darin zu suchen, dass viele Theatergänger die Institution Theater mit einem Museum verwechseln. Und eben dieses Museale vermeidet Volker
Lösch. Darin besteht die Stärke der Inszenierung.
Aktualität,
Brisanz, Unmittelbarkeit prägen Löschs "Medea". Ob man sich empört oder
begeistert, man kommt nicht umhin, Stellung zu beziehen, weil der
Spielleiter die Achillesferse der Gesellschaft trifft, die Stelle, an der
die Bürger mit einem blasierten "Das kenn ich
schon seit zwanzig Jahren" wegzuschauen versuchen. Doch das Wegschauen
funktioniert hier nicht. Was macht Lösch? Er zeigt, dass bei einer solchen
Strategie die Katastrophe heranreift. Eine Katastrophe, die immer dort
fruchtbaren Boden findet, wo zwei Kulturen mit unterschiedlichen
Überzeugungen und Wertesystemen aufeinanderprallen – heute genau so wie vor
zweieinhalb Jahrtausenden. "Medea" ist kein
spezifisch antiker Stoff, zumal das Motiv der Kindermörderin immer wieder in
der Literatur (man denke nur an die Dramen des Sturm und Drang) und
periodisch auch in den Tageszeitungen auftaucht.
Unbeholfen wohnen wir der
Tragödie bei. Medea wird von der Gesellschaft als Andersdenkende
stigmatisiert. Zerrissen zwischen zwei Kulturen, zwischen Hier und Dort,
zwischen Bleiben und Gehen, ist sie nirgendwo zu Hause. Ab einem gewissen
Punkt weiß sie selber nicht mehr, wer sie ist, oder mit wem sie sich
überhaupt identifizieren kann. Wenn Medea von ihrem Mann betrogen und
verlassen wird und sie zusammen mit ihren Söhnen aus Deutschland verbannt
wird, dann bricht für sie eine Welt zusammen und es gibt plötzlich nichts
mehr, wofür es sich zu leben lohnt.
Durch seinen
kollektiven Charakter legt der Chor nahe: Medea ist kein Einzelschicksal,
keine Ausnahme, nicht die von der Norm Abschweifende. In einem bestimmten
Kontext, wenn zwei Kulturen unter schwierigen Voraussetzungen miteinander
umgehen müssen, könnte ein jeder von uns zu einer Medea werden.
Löschs
"Medea" ist Teil einer Bewegung im internationalen Theaterbetrieb,
die eine Kongruenz zwischen der Ebene des Realen und der Ebene des
Imaginären anstrebt. So lässt der Regisseur Andrei Şerban in seiner
Hermannstädter "Möwe"-Inszenierung Arkadina und
Treplev von Mutter und Sohn spielen (Maia Morgenstern und Tudor Aaron
Istodor), Alexander Hausvater inszeniert den "König
Lear" mit einem krebskranken Hauptdarsteller (Joe Cazalet) und Volker Lösch
bringt für seinen Chor Bürgerinnen mit türkischem Hintergrund auf die Bühne.
In diesen Fällen ist Theater mehr als Unterhaltung – panem et circenses
–, dann ist es (zumindest für die am Projekt Beteiligten, und das ist auch
nicht wenig) eine authentische Lebenserfahrung.
Durch den Einsatz
des Laienchors demonstriert Lösch auch, dass Theater die Möglichkeit
eröffnet, sich künstlerisch auszudrücken, Gefühle und Emotionen zu
vermitteln, das Leben zu zelebrieren, auch wenn man kein Bühnenprofi ist.
Die Grenzen des Theaters werden überschritten oder für Augenblicke
aufgehoben, und das Resultat ist in diesem Fall ein aufreizendes,
sehenswertes Regietheater. Warum Lösch "Medea"
inszeniert hat? Weil die Gesellschaft, in der er lebt, eine starke
Auseinandersetzung mit der Alterität nötig hat. |
|
