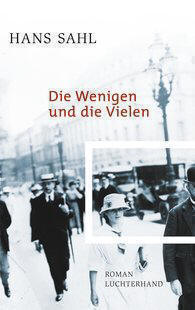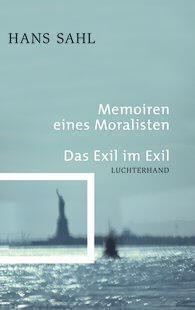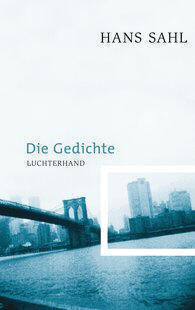|
Bücher & Themen
Jazz aus der Tube
Bücher, CDs, DVDs & Links
Schiffsmeldungen & Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Weitere
Sachgebiete
Tonträger,
SF &
Fantasy,
Autoren
Verlage
Glanz & Elend empfiehlt:
20 Bücher mit Qualitätsgarantie
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
Berserker und Verschwender
 Honoré
de Balzac Honoré
de Balzac
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Anzeige
 Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & Elend
Martin Brandes
Herr Wu lacht
Chinesische Geschichten
und der Unsinn des Reisens
Leseprobe
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«


|
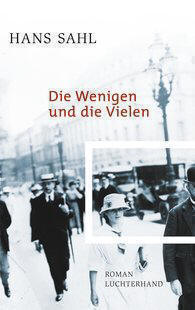 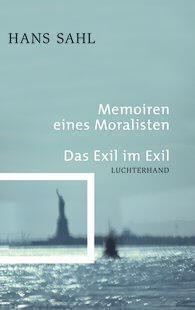 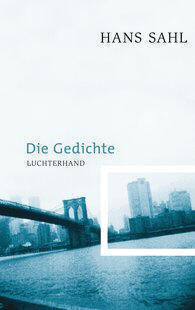
Du bist das Schlimmste
von Michael Rohrwasser
Hans Sahl, ein Mann des
»Jahrgangs 1902«

Hans Sahls berühmt gewordenes, noch nicht zwanzig Jahre altes Gedicht Die
Letzten fordert dazu auf, ihn und seine Zeitgenossen des Exils als »die
Zuständigen« und als »die Trödler des Unbegreiflichen« auszutragen: »Greift zu,
bedient euch. Wir sind die Letzten.« Die wenigen, die ihn 1973 beim Wort nahmen,
und die immer noch nicht vielen, die ihn heute besuchen, wurden und werden
Zeugen eines Rollentauschs. Der Autor wird zum Fragenden, der sich nach Wegen
und Auswegen erkundigt und seine Gesprächspartner nach Lösungen befragt. Seine
eigenen Erfahrungen und Antworten tragen Buch und Essay-Titel: Die Wenigen
und die Vielen, Gast in fremden Kulturen, Das Exil nach dem Exil,
Memoiren eines Moralisten, Exil im Exil.

Er sei Pessimist geworden, meint Sahl, und widerspricht sich doch auch, indem
er, kein bißchen müde, Kritik und Widerspruch sucht oder indem er selbst von
einer jungen Generation spricht, »mit der ich mich verstehe und die mich
versteht«. Aber Sahls Ton ist bitter und mischt sich mit Angriffslust. »Zu
spät«, antwortet der erst 1989 nach Deutschland zurückgekehrte Emigrant auf die
Bemerkung, daß in den letzten Jahren etwas wie eine Wiederentdeckung des
vergessenen Schriftstellers, Kritikers und Übersetzers Hans Sahl stattgefunden
habe; und wer nach den Gründen für die Isolation dieses Autors sucht, kommt
seiner Heiterkeit auf die Spur. »Zu spät« heißt auch die Schlußzeile seines
Gedichts Exil, in dem Sahl keine Fragen mehr beantwortet:

»Es ist so gar nichts mehr dazu zu sagen.
Der Staub verweht.
Ich habe meinen Kragen hochgeschlagen.
Es ist schon spät.«

Das Schattendasein, das Sahl über Jahrzehnte in der deutschen Kulturlandschaft
gefristet hat und das sich auch in der Geschichtsschreibung der Exilliteratur
widerspiegelt, ist zuallererst auf ein literarisches Werturteil zurückzuführen.
Denn um ein solches zu gewinnen, müssen die Bücher wenigstens verfügbar sein,
und das ist in den letzten Jahren erst halbwegs geschehen. In Sahls
autobiographischem Roman Die Wenigen und die Vielen sagt der Protagonist
von sich selbst: »Meine Arbeiten sind über die halbe Welt verstreut; meine
Gedichte erschienen in Zeitungen, die von mutigen Männern ohne Geld gedruckt
wurden, links unten, in der Ecke, zwischen Greuelnachrichten und den Meldungen
von den Martern meiner ermordeten Freunde.«

Wenn Sahl von seinem zweifachen Exil spricht, liefert er die Stichworte für sein
Schattendasein und Hinweise zu einer genauen Datierung. Er gehörte zu jenen
Emigranten, die nach dem Kriegsende nicht nach Deutschland zurückgekehrt sind.
Keiner hat ihn gerufen; und die ihn fragten, warum er nicht heimkehre,
»erkundigten sich zugleich höflich nach dem Termin meiner Abreise« (Befreiung
des verlorenen Sohnes).
Dahinter verbirgt sich mehr als das anrührende Schicksal eines Einzelnen. Es ist
vielmehr die typische Episode einer nicht oder zu spät stattgefundenen
Remigration.

Die Liste der nicht nach Deutschland Heimgekehrten reicht von Georg Glaser und
Günther Anders bis zu Thomas Mann und Walter Mehring. Die deutschen Emigranten
haben zuvor beim Wiederaufbau der Bundesrepublik, nicht nur durch ihren Einfluß
auf die westlichen Alliierten, Entscheidendes geleistet, sind aber, bis weit in
die 60er Jahre hinein, das Opfer einer globalen Amnesie geworden. So wie sich
die zurückkehrende Marlene Dietrich in Berlin 1960 ein vielstimmiges »Go home«
anhören mußte, so bekam Willy Brandt von Herrn Strauß die Frage zu hören: »Was
haben Sie im Exil eigentlich getrieben?« Wer an französischen Badeorten saß,
hatte kein Recht, über das mitzureden, was in Deutschland geschehen war, so der
Topos, den Gottfried Benn als Erster verwendet hatte.
Das »zweite Exil«, in das Sahl sich getrieben fand, hatte noch langfristigere
Konsequenzen. Den Moment der Trennung der Wenigen von den Vielen, im Jahr 1937,
hat er im zweiten Band seiner Erinnerungen, die den prägnanten Titel Exil im
Exil tragen, eindringlich beschrieben, und er kommt in Gesprächen immer
wieder auf die gespenstische Szene zurück, die die Polarisierung der Emigration
in den Jahren zwischen 1937 und 1939 versinnbildlicht. 1933 war Sahl als »ein
Mann der Linken« ins Exil gegangen; er sah sich nicht als vertriebener Jude,
sondern wollte von außen »für ein besseres Deutschland« kämpfen.

1937, zur Zeit der Moskauer Schauprozesse, war er wie viele felow-traveller von
Zweifeln geplagt; man machte sich gegenseitig Mut, diese Zweifel zu verdrängen.
»Beruhige dich«, sagte ihm Egon Erwin Kisch, »Stalin denkt für uns.« Als
Vorstandsmitglied des SDS, des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller, hatte
Sahl 1937 dann eine Erklärung gegen Leopold Schwarzschild zu unterschreiben, den
Herausgeber der Exilzeitschrift »Das Neue Tage-Buch«, in dem die Stalinschen
»Säuberungen« bekämpft wurden, ganz im Gegensatz zum Tenor der KP-nahen »Neuen
Weltbühne«, wo die erpresserische Formel galt, nach der jede Kritik an Stalin
Hitler stärke.
Im Kampf der KP gegen diese Kritiker sollte Schwarzschild nun zum »Goebbel-Agenten«
erklärt werden. Sahl »nahm seinen Hut«, er verweigerte die Unterschrift.

»Ich dachte an die Lebensmittelpakete, die uns kürzlich von unseren russischen
Kollegen aus Moskau zugesandt worden waren, an den Speck, den Schinken, den
Kaviar, den sie enthielten, ich dachte an die Eßkarten, die der Schutzverband an
seine parteitreuen Mitglieder verteilte, und ich dachte, was mir passieren
würde, wenn ich diese Erklärung nicht unterschriebe, und ich dachte an
Schwarzschild, den ich im Grunde nicht mochte.« Sahl wird »bearbeitet« von Anna
Seghers (»sie war die Therese Konnersreuth der KP«), von Hans Marchwitza und
Manès Sperber; letzterer droht ihm gar mit einem »Unglück«, das ihn treffen
könnte. – »Du kennst ja die Partei«. Doch Sahl mag nicht lügen, er folgt seinem
»kleinbürgerlichen Gewissen«, wie er selbstironisch hinzufügt. Kisch zieht kurz
darauf im Café das Resümee: »Du bist das Schlimmste, was einer Partei passieren
kann, du bist ein ... ein ... Wahrheitsfanatiker.« Sahl heftet sich diesen Namen
als Ehrentitel ans Revers. Er steht für einen der wenigen, die, vom
Nationalsozialismus vertrieben, sich ihren »Antifaschismus« nicht von einer
anderen mörderischen Diktatur diktieren ließen.

So hat er nicht nur die Ausblendung durch eine am Phänomen der Emigration
desinteressierte frühe Bundesrepublik erfahren, sondern auch die Ausgrenzung
jener, die sich in ihrer Kritik des Antikommunismus nicht beirren lassen
wollten. Sahl entdeckte im Verhalten der Intellektuellen der Adenauer-Jahre eine
Wiederholung der Situation von 1937: Ihre Kritik an der Adenauer-Ära verband sie
mit Blindheit gegenüber dem »DDR-Sozialismus«, den sie als positives
Projektionsfeld benötigten. In den Jahren, da Exilliteratur mit Lion
Feuchtwanger und Arnold Zweig, mit Bertold Brecht und Anna Seghers gleichgesetzt
wurde, war Hans Sahl tatsächlich Außenseiter: ein Hitler-Gegner, der nicht
gemeinsame Sache machte mit einer Stalin-hörigen »Volksfront«.

Jahrgang 1902; der Titel des vielgelesenen Romans von Ernst Glaeser (Sahl
hat den Autor und seinen Roman 1928 im Tagebuch zum Kleist-Preis
vorgeschlagen), liest sich heute wie ein Begriff für die zornigen alten Männer,
die in diesem Jahr 90 Jahre alt werden: neben Hans Sahl sind es beispielsweise
die Emigranten Günther Anders und Albert Drach. Ihnen gemeinsam ist, dass sie,
über politische Verfremdungen hinaus, die Einordnung nicht leicht machen, den
vorgefertigten Schablonen entfliehen und daher auch erst allmählich Eingang in
die Autorenlexika halten. In zwei Büchern über die jüdischen Emigranten in New
York taucht nicht einmal Sahls Name auf. Über lange Jahre war man auf
Antiquariate und Bibliotheken angewiesen, um Hans Sahls Bücher und verstreute
Arbeiten zu finden. Inzwischen ist es vor allem der Initiative der Darmstädter
Akademie für Sprache und Dichtung zu verdanken, daß der Luchterhand Verlag eine
ganze Reihe der früheren Texte wiederaufgelegt hat – eine späte verlegerische
Wiedereinbürgerung (die noch nicht abgeschlossen ist).

Nun ist die Gelegenheit, auf Entdeckungsreise zu gehen: auf ein Meisterwerk wie
seine 1926 entstandene Erzählung Tragödie im Schlangenkäfig zu stoßen,
auf Sahls Gedichte Mit Schicksal, auf seine Essays in Stefan Grossmans
Zeitschrift »Tagebuch«, auf die frühen Entdeckungen von Anna Seghers und Franz
Kafka durch den Literaturkritiker Sahl, vor allem aber auf den erstmals 1959
erschienenen Roman Die Wenigen und die Vielen, der von Fritz Martini mit Grund
als »der Roman des Exils überhaupt« gelobt worden war und der in den folgenden
Jahren kaum Käufer gefunden hat.
Nun, wo Gelegenheit ist, auch die gesammelten Gedichte daraufhin zu prüfen, wo
Brechts Spuren sichtbar sind und wo sie verschwinden, nun, wo man Sahls
zweibändige Memoiren eines Moralisten lesen kann – ein großartiges
Beispiel dafür, wie sich die Meisterschaft der Komposition hinter der
bescheidenen Rolle des Anekdotenerzählers verbirgt –, ist auch offensichtlich,
dass der Autor keine anderen Fürsprecher als ebendiese Bücher braucht.
Das gefährliche Wort von der Wiedergutmachung an einem Autor sollte man, auf
Sahls Werk bezogen, tunlichst vermeiden. Welcher Leser möchte schon aus
Pflichtschuldigkeit lesen? Es gibt freilich einen legitimen Grund, zu Hans Sahls
Büchern zu greifen: Der liegt in ihrer Qualität.
Michael Rohrwasser, »Du
bist das Schlimmste«, Erstveröffentlichung im Tagesspiegel aus Anlaß des 90.
Geburtstag von Hans Sahl, Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.
|
Hans Sahl
Die Gedichte
Luchterhand Literaturverlag
336 Seiten
19,95 €
978-3-630-87288-9
Leseprobe
Hans Sahl
Memoiren eines Moralisten (1983)
Das Exil im Exil (1990)
Neuherausgabe 2008 in einem Band
Luchterhand Literaturverlag
512 Seiten
ISBN 978–3–630–87278–0
21,95 Euro
Rede von Hans Sahl
Was ist eigentlich Exilliteratur?
»Wir sind zuständig«
Ein
Tauchgang in eine Welt, die es nicht mehr gibt
Über die Memoiren und Gedichte des Moralisten Hans Sahl
|
 Honoré
de Balzac
Honoré
de Balzac Edition
Glanz & Elend
Edition
Glanz & Elend