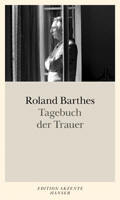|
Andere über uns
|
Impressum |
Mediadaten
|
Anzeige |
|||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | ||||
|
Bücher & Themen Jazz aus der Tube Bücher, CDs, DVDs & Links Schiffsmeldungen & Links Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Weitere Sachgebiete Tonträger, SF & Fantasy, Autoren Verlage Glanz & Elend empfiehlt: 20 Bücher mit Qualitätsgarantie Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett Berserker und Verschwender  Honoré
de Balzac Honoré
de BalzacBalzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen«, über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.« Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.« |
Nicht ohne meine Mutter Von Jürgen Nielsen-Sikora Roland Barthes war 61 Jahre alt als im Oktober 1977 seine Mutter starb. Sein ganzes Leben hat der vaterlos aufgewachsene Kulturkritiker und Literaturwissenschaftler mit dieser Frau verbracht, mit der er bis zuletzt auf engstem Raum in einer Pariser Wohnung zusammenlebte. Sein Vater fiel bereits im Ersten Weltkrieg - kurz nachdem Barthes das Licht der Welt erblickt hatte. Das Trauerbuch setzt einen Tag nach dem Tod der Mutter ein und reflektiert nahezu zwei Jahre lang die Gefühlswelt eines der faszinierendsten französischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Kleine Zettel, auf denen selten mehr als zwei, drei Sätze niedergeschrieben sind, spiegeln Barthes´ Seelenleben wider. Vom Tod des Autors, den er in den späten 1960er Jahren heraufbeschwor, um die Geburt des Lesers zu ermöglichen, kann in den sehr persönlichen Notizen nicht mehr die Rede sein. Denn in diesem niemals zur Veröffentlichung bestimmten Buch ist der Autor sehr lebendig und gewährt dem Leser Einblicke in die von Trauer durchtränkte Privatsphäre. Nein, Barthes ist nicht überwältigt von Trauer; vielmehr ist er selbst diese Trauer, die den Schutzpanzer der Theorie von sich geworfen hat. Schon der erste Satz des Tagebuchs ist bemerkenswert: „Erste Hochzeitsnacht.“ Mit wem hat sich der Autor, der zeitlebens nur Männer liebte, vermählt – nun, da die Mutter, die einzige Frau in seinem Leben, ihn verlassen hat? Wird ihm die Trauer zur Braut? Ist eine Heirat erst möglich, nachdem seine Mutter hierfür den Weg freigemacht hat? Und ist es letzten Endes nicht doch eine Art Zwangsheirat, die Barthes auf den folgenden rund 250 Zetteln skizziert? Die Trauer scheint alles zu sein, was ihm von der Mutter bleibt: „Von nun an und für immer bin ich meine eigene Mutter.“ In dieser Rolle hofft er auf ein neues Lebens und beginnt – fast panisch, wie er feststellt – Zukunftspläne zu schmieden, immer wieder verfolgt von einer Angst vor dem, was bereits stattgefunden hat. Bei seiner Beschreibung einer solchen Angst beruft er sich auf den britischen Psychoanalytiker Donald Winnicott und dessen Untersuchung über die „Angst vor dem Zusammenbruch“ von 1957 (Fritz Riemann hat die Angst vor Endgültigkeit vier Jahre später gar als eine von vier „Grundformen der Angst“ charakterisiert). Winnicott ist auch aus einem zweiten Gesichtspunkt heraus für Barthes interessant. Denn Winnicotts Thesen, in den ersten Monaten sei das Neugeborene mit seiner Mutter zu einer Einheit verschmolzen, und das Baby nehme die Mutter als Teil von sich selbst wahr, werfen nicht zuletzt ein Licht auf das Verhältnis von Barthes und seiner Mutter, die diese Symbiose nie ganz aufgelöst zu haben scheinen: „Ich denke an die Tage, an denen ich krank war, nicht zur Schule ging und das Glück hatte, morgens mit ihr (der Mutter) zusammenzusein.“ Er erfährt den Verlust des geliebten Menschen deshalb in erster Linie als Absterben eines Teils seines Selbst, als „matte Einsamkeit, die nun kein anderes Ende mehr haben wird als meinen eigenen Tod.“ Derweil ruft diese Einsamkeit in ihm etwas hervor, das er in seinen Notizen (auch über „das Neutrum“) als „Präsenz der Abwesenheit“ bezeichnet. Zumindest zu Hause in Paris aber spürt er, obwohl sie in Urt begraben liegt, noch die Anwesenheit der Mutter. Es fällt ihm allerdings zusehends schwer, zu reisen: „Warum ertrage ich es nicht mehr zu reisen? Warum will ich die ganze Zeit, wie ein verlorenes Kind, >nach Hause< – wo doch Mam. nicht mehr ist? … Reisen heißt, mich von ihr zu trennen – jetzt noch mehr, da sie nicht mehr da ist – da nichts weiter mehr ist als das im Alltag am engsten Vertraute.“ Dennoch bereist er in dieser Zeit vor allem Marokko, und er arbeitet an seinem Essay zur Photographie mit dem Titel „Die helle Kammer“ (1980). Darin spielt der Tod der Mutter ebenfalls eine Rolle.
Roland Barthes, der nur
rund zweieinhalb Jahre nach dem Tod der Mutter an den Folgen eines Autounfalls
starb, hat mit dem Trauerbuch, das eigentlich gar kein Buch sein sollte, etwas
geschaffen, das ihn posthum vom Olymp der Kulturtheorie ohne jeden Zweifel in
den der Literatur befördert hat.
|
Roland Barthes |
||
|
|
||||