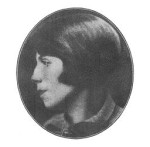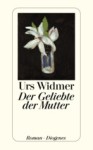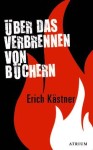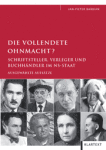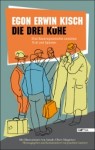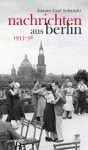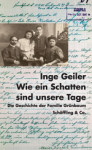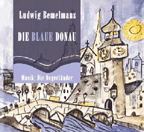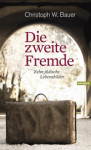VERB(R)ANNT
Dienstag, 6. Mai 2014BÜCHERVERBRENNUNG UND EXIL
„Jede Erinnerung ist eine Wiedergeburt.“, schrieb Bettina von Armin – auch abseits „runder“ Gedenkjahre.
In der Nacht des 10. Mai 1933 brennen im Deutschen Reich die Bücherscheiterhaufen. Sie sind das Fanal, das viele AutorInnen ins Exil und häufig auch in die Vergessenheit treibt. Eine Würdigung dreier dieser verfemten Autorinnen von Petra Öllinger.
Insgesamt finden im Laufe des Jahres 1933 über neunzig Bücherverbrennungen statt. Etwa 2500 SchriftstellerInnen und PublizistInnen verlassen das nationalsozialistische Deutschland. Grundlage für die Auswahl der zu verbrennenden Bücher bilden die „Schwarzen Listen“ des Bibliothekars Wolfgang Herrmann. Bereits in den ersten, später immer wieder erweiterten Fassungen, sind viele prominente Namen zu finden. Im Laufe der Zeit werden die Zusammenstellungen zu einem „Who is Who“ der deutschen und österreichischen Literatur und Wissenschaft. Wer nicht rechtzeitig flieht, sieht sich mit einem Maßnahmenkatalog konfrontiert, der vom Schreibverbot bis zum KZ und zur physischen Auslöschung durch die NationalsozialistInnen reicht.
Kurz nach dem „Anschluss“ ans „Altreich“ am Vorabend des 1. Mai 1938 findet am Residenzplatz in der Salzburger Altstadt die einzige offizielle nationalsozialistische Bücherverbrennung in Österreich, der damaligen Ostmark, statt. Dabei kann auf die vom Austrofaschismus geleistete Vorarbeit aufgebaut werden: Bereits 1934 wurde in Volks- und Arbeiterbüchereien die „unerwünschte“ Literatur ausgesondert, Anders als bei den Bücherverbrennungen im Deutschen Reich legen die Verantwortlichen in Salzburg den Schwerpunkt nicht nur auf die Vernichtung der Literatur linker, pazifistischer und jüdischer AutorInnen. Ihr Augenmerk gilt auch der Auslöschung des Schrifttums aus dem katholischen, austrofaschistischen und legitimistischen Bereich.
Viele der von Verfolgung und Exil betroffen AutorInnen sind bis heute aus dem Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden. Beispielhaft für jene Literatinnen, die Verfolgung und Emigration nicht überlebt haben oder einfach vergessen wurden, sollen hier die drei Autorinnen Maria Leitner, Lili Grün und Grete Weiskopf stehen.
Maria Leitner
Leitner wird 1889 in einer deutschsprachigen Familie in Varaždin geboren und wächst in Budapest auf. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Ungarischen Räterepublik emigriert sie über Wien nach Berlin. Ab 1925 durchquert Maria Leitner drei Jahre lang den amerikanischen Kontinent. Bei ihrer literarischen Arbeit verlässt sie sich nicht auf den Blick von außen. Sie sammelt vielmehr in den unterschiedlichsten beruflichen Tätigkeiten, beispielsweise als Dienstmädchen und Zigarettendreherin Erfahrungen, die in ihre Schriften einfließt. 1930 veröffentlicht sie den sozialkritischen Roman „Hotel Amerika“. Zwei Jahre später folgt unter dem Titel „Eine Frau reist durch die Welt“ eine Sammlung mit Sozialreportagen. Auf der „Schwarzen Liste“ der NationalsozialistInnen befindlich, muss sie 1933 untertauchen und kommt als Emigrantin über Prag nach Paris. In den Jahren danach kehrt sie vorübergehend inkognito nach Deutschland zurück und berichtet, wie sich das Land zum Krieg rüstet. 1940, nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Paris, wird sie von den französischen Behörden im Lager Camp de Gurs interniert. Ihr gelingt die Flucht nach Marseille, wo sie in extrem ärmlichen Verhältnissen im Untergrund lebt. Ihre Versuche, ein Visum für die Vereinigten Staaten zu erlangen, scheitern. Im Frühjahr 1942 wird sie ein letztes Mal, verzweifelt und krank, in Marseille gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Erst 2009/2010 werden behördliche Dokumente gefunden, die ihren Tod infolge völliger Erschöpfung auf den 14. März 1942 datieren.Elisabeth („Lili“) Grün
Bis zum überraschenden Tod ihrer Mutter 1915, sie ist zu diesem Zeitpunkt elf Jahre alt, erlebt Lili Grün eine glückliche und behütete Kindheit in Wien. In ihrem zweiten Roman „Loni in der Kleinstadt“ vermittelt sie den LeserInnen einen Einblick in die für sie schwierige Zeit danach. Ende der 1920er Jahre geht sie auf der Suche nach einer Fixanstellung am Theater nach Berlin. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sind auch im Deutschen Reich stark spürbar. Um überleben zu können, arbeitet sie in einer Konditorei als Verkäuferin und Küchenhilfe. Langsam stellen sich die ersten literarischen Erfolge ein. Gedichte und Kurzgeschichten werden im „Berliner Tageblatt“, im Berliner Magazin „Tempo“ und im „Prager Tagblatt“ abgedruckt. Im Roman „Herz über Bord“, erschienen 1933, verarbeitet sie ihre Berliner Erfahrungen. Noch im selben Jahr geht sie mit ihrem Lebensgefährten, dem Schriftsteller, Journalist und Kabarettautor Ernst Spitz, nach Prag, später nach Paris. Anfang 1935 zwingen sie ihr schlechter Gesundheitszustand und die ständigen Geldsorgen zur Rückkehr nach Wien. Ihr letzter Roman wird unter dem Titel „Junge Bürokraft übernimmt auch andere Arbeit“ zwischen Dezember 1936 und Januar 1937 in 37 Fortsetzungen im „Wiener Tag“ veröffentlicht. Spitz wird 1940 im KZ Buchenwald „auf der Flucht erschossen“. Verarmt und lungenkrank bietet sich für Lilly Grün keine Möglichkeit auf Emigration. Sie wird am 27. Mai 1942 deportiert und am 1. Juni 1942 im weißrussischen Vernichtungslager Maly Trostinec ermordet. Hilde Spiel wird über sie Jahrzehnte später schreiben: „… ein rührendes Mädchen, das mit seinem zarten Roman ‚Herz über Bord‘ zum ersten Mal in dem fatalen Jahr 1933 hervortrat. Ihre Lebensgeschichte bliebe im Dunkeln, und sie wäre vom Erdboden weggewischt, als hätte es sie nie gegeben, würde ihrer hier nicht Erwähnung getan.“
Grete Weiskopf
1905 in Salzburg als Margarete Bernheim geboren, verlässt sie früh ihr Elternhaus und arbeitet als Übersetzerin. Mitte der 1920er Jahre folgt sie ihrer Schwester nach Berlin. Den Lebensunterhalt verdient sie sich als Stenotypistin, Buchhändlerin und Journalistin. Im legendären Malik-Verlag ihres Schwagers Wieland Herzfelde – benannt nach einem Roman von Else Lasker-Schüler – veröffentlicht sie 1931 unter dem Pseudonym Alex Wedding ihren Debütroman „Ede und Unku“. Der Roman beruht auf den Erlebnissen des Sinti-Mädchens Erna Lauenburger und schildert die Freundschaft zweier Kinder im Berlin der Weimarer Republik. Eine Geschichte über Solidarität, die Infragestellung konservativ-autoritärer Familienverhältnisse und über Mädchen, die sich durchzusetzen verstehen. Erna Lauenberger, das Vorbild der Romanfigur, wird 1943 als „Zigeunermischling“ nach Auschwitz deportiert und ermordet. Von allen elf im Buch namentlich erwähnten Sinti-Kindern überlebt nur eines die Jahre bis 1945.
Grete Weiskopf betont in ihrem Schaffen die Verantwortung der AutorInnen für die nachfolgenden Generationen. „Angesichts unserer vom Kriege bedrohten Welt, angesichts der Todesgefahr, die über unseren Kindern schwebt, haben wir, die wir mit dem künstlerischen Wort Denken und Fühlen von Millionen beeinflussen können, eine besonders große Verantwortung. Es gilt, um eine Ordnung des Friedens und der Menschlichkeit zu kämpfen. In Wort und Tat. Auch mit humanistischen, künstlerisch wertvollen Kinderbüchern.“ Die Autorin ist 28, als ihr zwei Jahre zuvor erschienener Erstling im Zuge der Bücherverbrennungen, neben den Werken von mehr als hundert anderen AutorInnen in Flammen aufgeht. Da hat sie das Land bereits verlassen: Nach dem Reichstagsbrand Ende Februar 1933, flüchtet sie mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Franz Carl Weiskopf, nach Prag. Als die Deutsche Wehrmacht im März 1939 die Hauptstadt des Tschechoslowakischen Republik besetzt, führt sie die gemeinsame Flucht weiter nach Frankreich. Wenige Monate später, die beiden befinden sich anlässlich eines Schriftstellerkongresses in den USA, beginnt mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 der 2. Weltkrieg. An eine Heimkehr nach Europa ist vorerst nicht mehr zu denken. Nach dem Ende des Krieges kehrt das Ehepaar nach Prag zurück. Die Erkenntnis, dass es nach den Jahren des Faschismus unmöglich ist, als deutschsprachige Schriftstellerin in der Tschechoslowakei zu wirken, ist einer der Gründe, der sie 1953 nach Ost-Berlin führt. Bis zu ihrem Tod 1966 bleibt sie ihrem Metier treu und schreibt eine Vielzahl von Kinder- und Jugendbüchern.
Petra Öllinger ist Autorin und Psychologin und führt eine virtuelle Bibliothek u. a. zum Thema „Exilliteratur“:
Der Beitrag „verb(r)annt“ wurde im Mai 2014 in an.schläge – Das feministische Magazin erstveröffentlicht.
Literaturhinweise
Maria Leitner
- Leitner, Maria: Reportagen aus Amerika. Eine Frauenreise durch die Welt der Arbeit in den 1920er Jahren. Promedia Verlag, Wien. 256 Seiten. 24.- €
- Leitner, Maria: Mädchen mit drei Namen. Reportagen aus Deutschland und ein Berliner Roman 1928-1933. AvivA Verlag, Berlin. 220 Seiten. 15, 90 €
- Leitner, Maria: Hotel Amerika. Ein Reportage-Roman. Edition Mokka, Wien. 285 Seiten. 19.50 €
Leitner, Maria: Eine Frau reist durch die Welt. Severus Verlag, Hamburg. 200 Seiten. Paperback 24,50 Euro / gebunden 34,90 € - Julia Killet, Helga W. Schwarz (Hrsg.): Maria Leitner oder: Im Sturm der Zeit. Karl Dietz Verlag, Berlin 2013, 144 Seiten, 9,90 €
Lili Grün
- Grün, Lili: Alles ist Jazz. Hrsg. Anke Heimberg. AvivA Verlag, Berlin, 2009, 216 S., 18,- €
- Grün, Lilo: Alles ist Jazz, Hörbuch. Sprecherin Katharina Straßer. Mono Verlag, Wien, 2011, 12,90 €
- Grün, Lili: Zum Theater! Hrsg. Anke Heimberg. AvivA Verlag, Berlin, 2011, 215 Seiten, 18,00 €. Orig.-Ausg. 1935 u.d.T.: Loni in der Kleinstadt.
- Grün, Lili: Mädchenhimmel! Gedichte und Geschichten. Gesammelt, hrsg., kommentiert und mit einem Nachwort von Anke Heimberg. AvivA-Verlag, Berlin, 2014, 118 S., 18,00 €
Alex Wedding
Bildquelle: Elisabeth, ein Hitlermädchen – Erzählende Prosa, Reportagen und Berichte, Aufbau Berlin, 1985. Urheberin Schwarz, Helga. Creative Commons CC-BY-SA-3.0