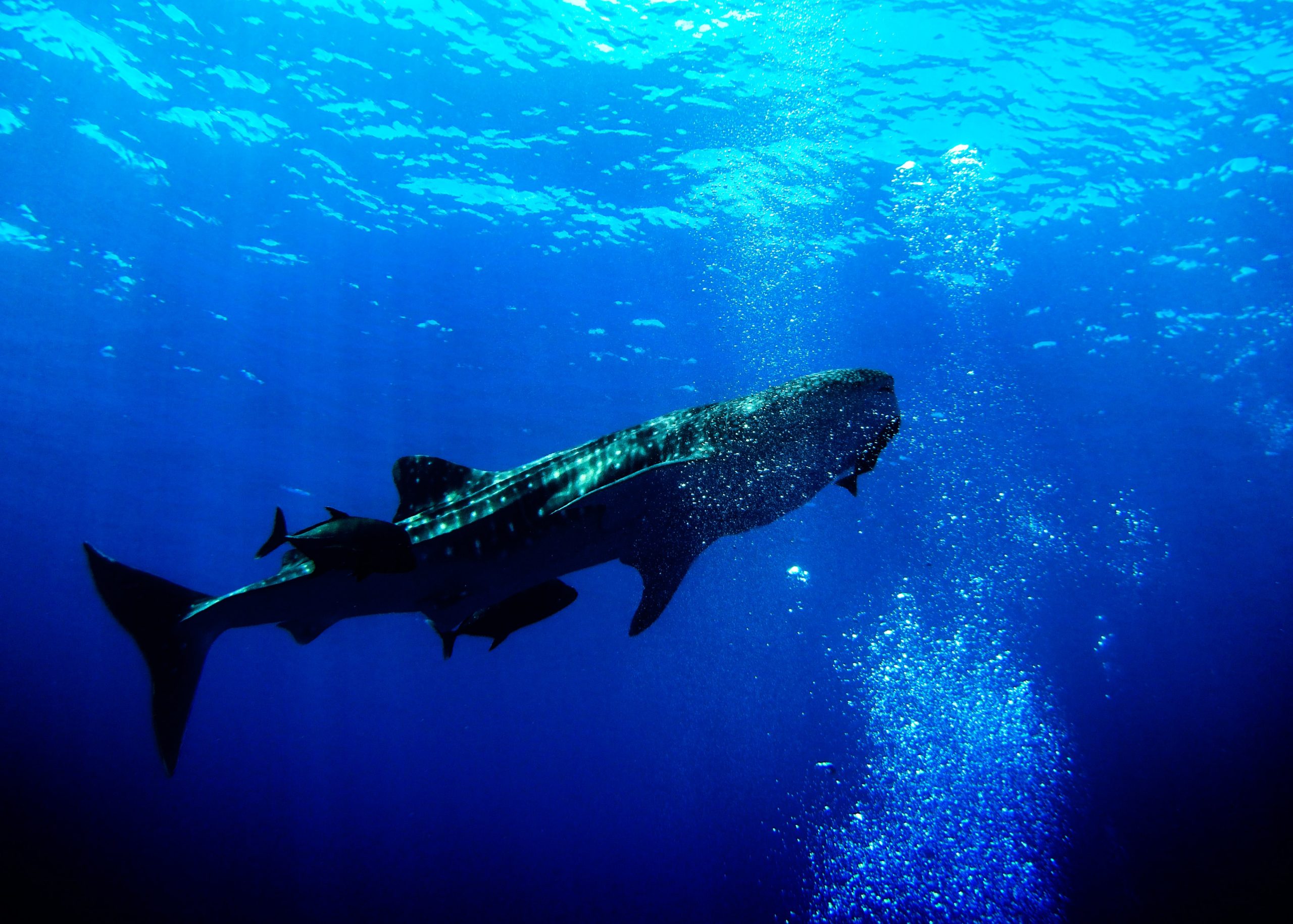von Felix Lempp
Und schreit das Publikum: Hurra! – das nützt euch nichts, denn ich bin da!
Georg Kreisler: Der Musikkritiker
Der Angriff auf den Kritiker
Auf den ersten Blick umgibt den gängigen Spiralblock eine gewisse anachronistische Aura. Als College-Block fand er sich in den Umhängetaschen von Generationen von Studierenden, bevor MacBooks in Fjällräven-Rucksäcken die Universitäten eroberten, und auch als Notizblock für Einkaufslisten wird er wohl im digitalen Zeitalter zunehmend abgelöst. Die meisten Schreibwilligen nutzen Smartphone oder Tablet, wer sich prinzipiell zu Tinte und Papier bekennt, tut das oft im höherpreisigen Segment auf handgeschöpftem Büttenpapier oder im Moleskin-Notizheft. Und doch war es ein Spiralblock, an dem sich im Jahr 2006 einer der ersten Theaterskandale des Jahrtausends entzündete. Was sich am Abend des 16. Februars in der Schmidtstraße 12, einer der Spielstätten des Schauspiels Frankfurt, ereignete, hat alles, was es zur Legendenbildung braucht: Einen mächtigen Kritiker, einen übergriffigen Schauspieler, die Premiere einer sehr freien Bearbeitung eines sehr unbekannten Stückes, eine Oberbürgermeisterin kurz vor den Kommunalwahlen – und eben nicht zuletzt: einen Spiralblock!
Was an diesem Abend wirklich geschah, darüber gibt es verschiedene und teils abweichende Aussagen der Beteiligten. Als kleinster gemeinsamer Nenner lässt sich folgender Tathergang rekonstruieren: Im Verlauf der Premiere von Eugene Ionescos Das große Massakerspiel. Oder Triumph des Todes weigerte sich Gerhard Stadelmaier, Theaterkritiker der FAZ und bekanntermaßen kein Freund textferner Stück-Dekonstruktionen, an der Publikumsbeteiligung mitzuwirken, die Sebastian Hartmann in seiner Inszenierung vorgesehen hatte. Dies bewegte den Schauspieler Thomas Lawinky dazu, Stadelmaier direkt anzusprechen und ihm nach kurzem rhetorischen Schlagabtausch seinen Spiralblock wegzunehmen. Er blätterte ihn durch, um darin Hinweise auf die Meinung des Kritikers zur Inszenierung zu finden, und gab ihm das Schreibgerät dann zurück. Stadelmaier, der dieses Vorgehen als Übergriff empfand, verließ unter Protest die Aufführung, während ihm Lawinky noch ein „Hau ab, du Arsch! Verpiß dich!“ nachgerufen haben soll. Über eine Beschädigung des Blocks wurde nichts bekannt.
Damit war aber die Angelegenheit keinesfalls erledigt. Die Spiralblockaffäre – unter dieser Bezeichnung gingen der Zwischenfall und seine Folgen in die Theaterhistorie ein – stand erst an ihrem Beginn. Noch in der Nacht über den Vorgang informiert, schrieb Petra Roth, die Oberbürgermeisterin Frankfurts, am Morgen des nächsten Tages einen Brief an die Intendantin des Schauspiels, Elisabeth Schweeger. Sie forderte sie angesichts des „unentschuldbaren Vorfall[s]“ auf, „das Vertragsverhältnis mit dem Schauspieler Thomas Lawinky sofort zu beenden“. Dieser kam seiner Entlassung durch Kündigung zuvor, sodass Schweeger letztlich eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen verkünden konnte.
Neben diesen kulturpolitischen Folgen hatte der Vorgang natürlich auch ein feuilletonistisches Nachspiel. Unter dem Titel „Angriff auf einen Kritiker“ veröffentlichte Gerhard Stadelmaier seine Sicht auf den Theaterabend. In diesem Artikel kommt nicht nur die Erschütterung des Kritikers über eine „Attacke auf meinen Körper und meine Freiheit, die nichts weniger als die Freiheit der Presse ist“, zum Ausdruck, sondern auch der Spiralblock zu seinem Recht: So sei Stadelmaier der „Kritikerblock brutal aus der Hand“ gerissen worden, bevor Lawinky den „schönen Spiralblock wie eine Trophäe“ präsentiert, ihn dann aber wieder zurückgegeben habe.
Es fällt schwer, die hier hervorbrechende Bestürzung über den entwendeten Block nicht als Entsetzen über den Verlust der Insignie des souveränen Kritikers zu deuten. Was sich also in der Affäre um Stadelmaiers Spiralblock auch manifestiert, sind Fragen zu Rolle und Stellenwert der Theaterkritik in einem Theatersystem, das besonders seit der Jahrtausendwende seine Pluralität, Formenvielfalt und Ablösung vom Dramentext nicht nur in der Praxis vorführt, sondern auch zunehmend theoretisch reflektiert. Bemerkenswert an der Spiralblockaffäre ist auch die von ihr ausgelöste öffentliche Debatte im Feuilleton und der Theateröffentlichkeit, in der die Frage mitschwang, ob die Institution des allmächtigen Großkritikers – der Verzicht auf das Gendern ist hier intendiert – noch zeitgemäß ist. Denn es gab keinesfalls nur Stimmen, die dem Kritikerfürsten beisprangen und angesichts von Lawinkys Verhalten von einem „so aggressiven Akt, daß mir der Atem stockte“, sprachen.
Selbst Kritikerkollegen wie Peter Michalzik äußerten ihr Unbehagen, dass „im Namen der Pressefreiheit [–] für die zu kämpfen die FAZ vorgibt – einem Theater vorgeschrieben [wird], was es zu tun hat. Jetzt entlassen also Kritiker via Oberbürgermeister die Schauspieler. Sehr schön. Meine Freiheit ist das nicht, liebe FAZ“. Und Claus Peymann ergriff die Gelegenheit, dem nun arbeitslos gewordenen Thomas Lawinky ‚Theaterasyl‘ und Job im Berliner Ensemble anzubieten. Das Theater leistete seinem Kritiker hier also durchaus Widerstand – ein Widerstand, der sich explizit nicht gegen den Inhalt der Rezension richtete (das wäre im gespannten Verhältnis zwischen Theaterpraxis und Theaterkritik ja nichts Neues), sondern gegen die Art, wie ein Kritiker seine Medienmacht gegen einen einzelnen Schauspieler in Stellung brachte.
Die Klage des Kritikers
Doch auch der Kritiker war mit seinem Theater ganz und gar nicht zufrieden! So veröffentlichte Gerhard Stadelmaier zehn Jahre später eine Polemik, die sich schon im Titel gegen ein „Regisseurstheater“ wendet, in dem Text und Tradition nichts, Zeitgeist und die Selbstherrlichkeit der Regisseur*innen jedoch alles bedeuteten.[1] Interessant für die Frage nach dem aktuellen Stellenwert und Platz der Theaterkritik ist dieser Text vor allem wegen dem dort skizzierten Verhältnis zwischen Zeitung, Kulturkritik und Leserschaft.
Die Beziehung des von Stadelmaier figurierten Kritikers zu seinen Leser*innen ist ambivalent: Einerseits sind sie die „kritischen Partner“, die durch eine Theaterkritik, „die den Verstand und die Phantasie des Lesers anregt, zum Widerspruch, zum Ganz-anders-Denken reizt“, überzeugt werden müssen (S. 39f.). Doch andererseits sollten diese Leser*innen das ‚Ganz-anders-Denken‘ und die kritische Partnerschaft auch nicht übertreiben, etwa indem sie selbst – nicht zum Spiralblock, aber dem digitalen Schreibgerät greifen. Feindbild sind besonders solche Leser*innen, die online und damit „im allgemeinen elektronischen Stammtisch-Sumpf des Jeder-darf-mal-Postens und Senf-dazu-Gebens“ aktiv werden, „wo im Schatten allgemeiner Anonymität jeder das, was ihm zu einem Ereignis oder einer Nachricht oder gar einem Artikel [!] durch die Rübe rauscht, als Kürzestpublikation ins Internet stellen kann“ (S. 39). Statt „als aleatorischer Publizist zu fuhrwerken“ (S, 52), so ist das wohl zu verstehen, sollen die Leser*innen den partnerschaftlichen Dialog mit dem Kritiker möglichst für sich führen – was für letzteren vielleicht auch den Vorteil hat, im Zweifel von diesem Dialog weitestgehend verschont zu bleiben.
Diese Sorgen bezüglich einer (online) schreibenden Leser*innenschaft können als Anzeichen einer generellen Aversion gegenüber der Pluralisierung des Über-Theater-Sprechens und Theater-Machens verstanden werden, die Stadelmaiers Polemik prägt. So greift der Kritiker auf Ebene der Theaterproduktion die einflussreiche ‚Talentschmiede‘ der Gießener Angewandten Theaterwissenschaft an und bezeichnet das Institut, aus dem in den letzten Jahrzehnten inzwischen etablierte und einflussreiche Theatermacher*innen wie René Pollesch, Gob Squad, Rimini Protokoll oder She She Pop hervorgegangen sind, als „Szenenverkopfungsfabrik“, in der „Drama und Schauspieler nichts mehr gelten“ (S. 72). Gegen einen „lieb- und bildungslose[n]“ (S. 123) ‚Stückezerschlager‘ setzt Stadelmaier das Idealbild eines Regisseurs als „Diener der Dichter“ (S. 110), das Publikum, das dieses folglich vom Text her gedachte und beurteilte Theater richtig begreifen möchte, braucht dazu „ein lesendes, nachlesendes und sich darin phantasierend vertiefendes Herz“ (S. 123).
Sehr deutlich spricht aus den Seiten von Regisseurstheater das Selbstverständnis eines einflussreichen Kritikerpapstes, der sich kompetent und befähigt fühlt, nicht nur über ‚richtiges‘ und ‚falsches‘ Theater zu entscheiden, sondern dieses ästhetische Urteil auch seinen Leser*innen zu vermitteln. Ebenso deutlich spricht hier aber auch ein Kritiker, der im Zeitungswesen groß geworden und für den Theaterkritik gleichbedeutend mit Zeitungsfeuilleton ist. Seine Kritik des ‚Zeitgeists 2016‘, seine Attacken gegen Blogger*innen, Twitter und das anonyme Internet wirken wie aus der Zeit gefallen, weil sie erkennbar in Widerspruch zur Lebensrealität der meisten Leser*innen stehen. Symptomatisch zeigt sich das, wenn Stadelmaier Theater und Zeitung als „die zwei bedeutenden Zeitgeistmaschinen […], die beide einen gewissen Bedeutungsschwund zwar hinzunehmen hatten und haben, aber immer auch noch ziemlich gesellschaftlich wirksam sind“, bezeichnet. (S. 36). Es geht an dieser Stelle nicht darum, Theater und Zeitung eine gesellschaftliche Wirkungsmacht grundsätzlich abzusprechen. Problematisch ist die hier skizzierte ideale kulturelle Modell-Öffentlichkeit von Theater und Zeitung im Jahr 2016, weil Stadelmaier über die Kommunikationsformen und gesellschaftlichen Wirkpotenziale des Internets in der Folge derart herablassend hinweggeht.
Es ist dabei zu vermuten, dass der Kritiker die pluralistischen Möglichkeiten zu Meinungsäußerung und -austausch, die das Internet bietet, keinesfalls übersieht oder auch nur unterschätzt. Viel eher scheint ein vielstimmiger und enthierarchisierter Dialog über Kunst und Kultur seinem Verständnis professioneller Theaterkritik grundlegend zu widersprechen. So gilt das, was Stadelmaier über das Theater festhält, auch für das Kritikerhandwerk: Wird es zum „Mitmach- und Mitspielgewerbe“ nach dem Motto „Keiner bleibt draußen“, verliert es seine Daseinsberechtigung. (S. 73)
In diesem Sinne ist es wegweisend, dass sich der Theaterskandal zehn Jahre vor Regisseurstheater gerade an einem Spiralblock entzündete, dem analogen Erkennungszeichen des Theaterkritikers also, das ihn aus der Menge des Publikums heraushebt und auf dem er den Prozess vorbereitet, der das performative Bühnengeschehen in die lineare Textlogik der Rezension überführt. An einem Schreibblock, der im Theatersaal als Kennzeichen professioneller Theaterkritiker*innen Autorität spendet, aber eben im digitalen Zeitalter gleichzeitig immer auch ein wenig aus der Zeit gefallen erscheint.
Der Kritiker als Bürger
Um ein Beispiel zu benennen, das er von seiner polemischen Kritik der gegenwärtigen Theaterlandschaft positiv absetzen kann, muss Gerhard Stadelmaier weit in die Vergangenheit gehen. Er findet es in der Mitte des 18. Jahrhunderts und damit zu der Zeit, in der sich nicht nur das heutige deutschsprachige Theatersystem, sondern mit dem vermehrten Aufkommen von gedruckten Periodika auch die deutschsprachige Theaterkritik formierte. Sozialhistorisch war diese Epoche vom ökonomischen und gesellschaftlichen Aufstieg des Bürgertums gekennzeichnet, das im Theater ein Versuchslabor fand, in dem es eigene Lebensentwürfe und Moralvorstellungen erproben und zumindest auf der Bühne auch durchsetzen konnte.
So wurde das Theater von Reformtheoretikern wie Johann Christoph Gottsched und Gotthold Ephraim Lessing für das Projekt einer bürgerlichen Aufklärung vereinnahmt und die von Friedrich Schiller gelobte „gute stehende Schaubühne“ als Sittenschule in den Dienst der Volkserziehung gestellt. Denn nicht nur das deutschsprachige Theater sollte im 18. Jahrhundert jenseits des Jahrmarktsbuden-Spektakels reisender Theatertruppen erneuert werden – auch das Publikum war zu einer aufmerksamen und gesitteten Rezeptionshaltung zu erziehen. Neben der Leistung der Schauspielenden findet sich deshalb in den Kritiken und programmatischen Essays der Zeit vor allem das Verhalten des Publikums während der Aufführung beurteilt: Die Formung des Theaters zur „einzige[n] Sittenschule für die Erwachsenen des Ersten und Mittelstandes“[2], als die es 1782 in der (durchaus zeittypisch-programmatisch benannten) Theaterzeitschrift Der dramatische Censor bezeichnet wurde, ist damit auch ein Anliegen der aufkommenden Theaterkritik.
Stadelmaier erkennt im Publikum des 18. Jahrhunderts jedoch weniger das Objekt ästhetischer Erziehungsmaßnahmen, sondern das „Glückskind eines glücklichen Zeitgeistes“ und einen „Partner des Kritikers“. Dadurch, dass letzterer sich die „Freiheit [nahm], in Kunstsachen seine Meinung zu sagen“, bereitete er auf dem Feld der Kultur letztlich die politische Willensbildung des Bürgertums vor: „Das Feuilleton wurde dergestalt zu einer Art Vorparlament“, (S. 55) der Kritiker zum Archetypus des Bürgers: „Im Kritiker trat der Bürger erst richtig in Erscheinung“. (S. 56) Das hier geschilderte Theater- und Feuilletonsystem im 18. Jahrhundert war damit seiner theoretischen Fundierung nach ein System des Theaterspielens und -kritisierens von Bürger*innen für Bürger*innen, das andere Bevölkerungsteile geradezu konzeptionell ausschloss. So empfiehlt auch der Dramatische Censor den deutschen Theatern, „mehr Zuschauer, besonders aus dem Bürgerstande, – nur auf diese Klasse kann sich ein stehendes Nationaltheater gründen – an sich zu ziehen“[3].
Diese Beschreibung des Theaters im 18. Jahrhundert entspricht jedoch eher bürgerlich-theaterreformatorischen Wunschvorstellungen der Zeit als der Praxis. Die deutschsprachigen Theater wurden bis weit ins 19. Jahrhundert hinein nahezu ausschließlich von den Fürsten protegiert, finanziert und nicht selten zensiert, was ein allzu freies Denken, Schreiben und Spielen erschwerte. Doch auch das Publikum war keineswegs gewillt, sich von Theater und Kritik zum besseren Menschen erziehen zu lassen: Es waren nicht so sehr die heute im aufklärerischen Theaterkanon fixierten Stücke, die den Geschmack der Zuschauer*innen zwischen 1750 und 1850 trafen und deshalb die Bühnen beherrschten. Der erfolgreiche Schauspieler und zeitweilige Theaterdirektor Friedrich Ludwig Schmidt – ein Praktiker, der es wissen muss –, erinnert sich beispielsweise in seinen Memoiren: „Außer dem Dichternamen ‚Schiller‘ bewirkte bei uns noch derjenige von ‚Goethe‘ und ‚Lessing‘ u n f e h l b a r ein leeres Haus“. – Dass diese Namen noch immer so viel bekannter als die von Charlotte Birch-Pfeiffer oder August Wilhelm Iffland sind, wäre eigene Reflexionen wert.
Für jetzt aber zurück zu dem Theater und der Theaterkritik, die Gerhard Stadelmaier in Regiesseurstheater als positives Gegenbild zum Zeitgeisttheater und der entprofessionalisierten Kritik des neuen Jahrtausends zeichnet. Dieses Gegenbild ist vor allem von zwei Merkmalen bestimmt: Zum einen von einem Theater, das stets vom Text her gedacht wird und die Inszenierung folglich als Umsetzung des Dramas begreift. Zum anderen von der Einbettung dieses Theaters in eine bildungsbürgerliche kulturelle Identitätspolitik, die mit der Bühne den Platz gefunden hat, eigene Lebensentwürfe zu propagieren und sich so vom Adel genauso wie von den unteren Bevölkerungsschichten abzugrenzen.
Das deutsche Stadttheatersystem wie auch die Theaterkritik wurden damit aus dem Geist eines Bürgertums geboren, für das gesamtgesellschaftliche Kohäsion nicht im Fokus der eigenen kulturpolitischen Bemühungen stand, da es zunächst selbst seinen wirtschaftlichen, kulturellen und in der Folge auch zunehmend politischen Platz in der Gesellschaft finden musste. Beim Blick auf dieses gemeinsame Erbe erscheint es kaum als Zufall, dass die Probleme, vor die sich das Stadttheatersystem aktuell gestellt sieht, in vielerlei Hinsicht die der Theaterkritik sind. Für die Theater lassen sich viele dieser Herausforderungen auf die Frage zuspitzen, wie die teuren Institutionen verhindern können, mit dem Kontakt zur Lebenswelt der diversen (Stadt-)Gesellschaft diese auch als Publikum zu verlieren. Wie die Theater auf entsprechende Problemstellungen reagieren, darüber wurde – von Stadtteilprojekten bis hin zum vergünstigten Eintrittspreis – viel geschrieben. Wie aber reagiert die Theaterkritik?
Der kritische Dialog
Die Frage nach Anpassungs- und Erneuerungstendenzen der Theaterkritik führt noch ein letztes Mal zurück zur Spiralblockaffäre. Denn ihre für das deutschsprachige Theaterfeuilleton vermutlich bedeutendste mittelbare Folge sollte sich erst ein Jahr später zeigen, als 2007 das Branchenportal nachtkritik.de antrat, den deutschsprachigen Zeitungen zu zeigen, wie Theaterkritik im digitalen Umfeld funktionieren kann. Die Journalistin Esther Slevogt, die das Portal gemeinsam mit Petra Kohse, Nikolaus Merck, Dirk Pilz und Konrad von Homeyer gründete, beschrieb in einem Interview mit dctp die Spiralblockaffäre als unmittelbaren Auslöser für ihre Bemühungen um eine neue Form von Theaterkritik: „Da war für mich ein Punkt erreicht, an dem ich dachte, man muss die Einbahnstraße Theaterkritik für den Gegenverkehr freigeben.“
Der Plan von nachtkritik.de war also die Pluralisierung des kritischen Diskurses über das Theater, die Ersetzung des einen Kritikers durch den kritischen Dialog. Die typischerweise am Morgen nach der Premiere erscheinende Kritik soll also gerade nicht als abschließendes Verdikt über eine Inszenierung verstanden werden, sondern im Gegenteil als „Beginn eines künstlerischen Gesprächs über eine Arbeit“. In der Strukturlogik des Internets kann deshalb jede Kritik und jeder Essay, der auf dem Portal publiziert wird, von den Leser*innen kommentiert werden, die Rückbindung an das Zeitungsfeuilleton bleibt durch eine Presseschau gewahrt, die am Ende jeder Kritik beständig erweitert wird. Diese Kritiken selbst, darauf legt die Redaktion wert, sind jedoch Texte, die nicht „wild […] gebloggt“, sondern von bezahlten Autor*innen geschrieben und von einer Fachredaktion redigiert werden. Somit ist die textuelle Verfasstheit der Gattung Theaterkritik nicht angetastet, aber durch die Möglichkeit zu Repliken und (Gegen-)Kritiken der Leser*innen diskursiv anders gerahmt.
Über zehn Jahre nach der Gründung ist inzwischen klar, dass das Branchenportal so erfolgreich wie einflussreich ist. Längst finden sich dort nicht mehr nur Kritiken, sondern unter vielem anderen auch Essays zu aktuellen Entwicklungen, Buchbesprechungen und verschiedene Themendossiers. Die Redaktion zeigt immer wieder die Vorteile auf, die eine technisch wie konzeptionell wendige digitale Plattform gegenüber den Schlachtschiffen des Zeitungsfeuilletons hat. So sammelte nachtkritik.de schon ab Beginn der coronabedingten Theaterschließungen systematisch Online-Angebote der Theater und initiierte spezifische Streaming-Events inklusive begleitendem Chat mit den Regisseur*innen. Aus einem Kritik-Portal wurde eine reichweitenstarke Netz-Heimat für Theater in all seinen Facetten. Dass Kritiker*innen, die ihre Texte vorwiegend im Internet veröffentlichen, inzwischen ganz selbstverständlich Pressekarten in den Theatern erhalten und in großen Theaterjurys sitzen, verdanken sie nicht zuletzt dieser digitalen Pionierarbeit.
Aber die Geschichte von nachtkritik.de zeigt auch, dass der plurale und diverse Theater-Diskurs im Netz krisenanfälliger ist als die vielleicht immer kleiner werdende, aber eben doch noch nicht ganz gestrichene Feuilletonsparte in den Redaktionen. Wenn wie während der Pandemie Werbebanner wegbrechen, sind mit viel Herzblut, aber ohne große finanzielle Reserven und Absicherungen geführte digitale Portale schnell existenziell bedroht.
Theaterkritik im Netz kann also die Zeitungskritik – die gerade natürlich ihre eigenen Probleme hat – nicht ersetzen, aber sehr wohl ergänzen. Doch gerade deshalb sollte sie sich auf ihre medienspezifischen Stärken noch grundsätzlicher besinnen und Pluralität nicht nur als Einbettung der Kritik in den Diskurs einer Netzöffentlichkeit denken, sondern auch formale Konsequenzen ziehen. Warum beispielsweise derart an der textuellen Verfasstheit der Gattung Theaterkritik festhalten, statt die mediale Vielfalt des Internets auch für eine neue Art des Kritisierens von Theater nutzbar zu machen? Erste Schritte auf diesem Weg zeigt beispielsweise Berit Glanz’ Rezension eines Theaterabends in Notizheft-Tweets. Diese wurden zwar nicht alle live während der Vorstellung getwittert, aber eben doch nachträglich ohne größere textuelle Überarbeitung in Tweet-Form auf nachtkritik.de veröffentlicht.
Orientieren könnten sich derartige Bemühungen weiterhin an der Literaturkritik: Längst werden hier Rezensionen zu neuen Romanen nicht mehr nur textuell auf Blogs publiziert, sondern auch auf anderen sozialen Plattformen tummeln sich Lesebegeisterte, die gleichzeitig literatur- und medienaffin sind. Wie klug und reichweitenstark eine medial diverse Präsentation von Literatur sein kann, beweist zum Beispiel die Redakteurin und Moderatorin Miriam Zeh auf ihrem instagram-Kanal, wo sie „Feuilleton, nur fancy“ betreibt. Ihre Videoclips verbinden Film, Bild und Text zu Besprechungen, die natürlich knapper ausfallen als Zeitungsrezensionen – dafür aber auch eine ganz andere Rezipient*innenengruppe erreichen. Auch auf youtube nutzen Buchhändler*innen und andere Enthusiast*innen als Booktuber teils mit Follower*innenzahlen im fünfstelligen Bereich die Videoplattform für ihre Besprechungen und Features. Versuche, dieses Medium auch für die Theaterkritik zu erschließen, wie sie beispielsweise die Theater-Pilger unternehmen, sind dagegen – noch! – Ausnahmen.
Bei der Bestimmung des aktuellen Ortes der Theaterkritik geht es also keinesfalls um einen reinen Umzug vom Spiralblock in den Blog. Vielmehr steht die Gattung vor der Aufgabe, sich nicht nur hinsichtlich einer größeren Dialogfähigkeit, sondern auch in ihren medialen Mitteln und Strukturen zu verändern: Sie muss gerade die digitalen Orte erobern, an denen die ‚aleatorischen Publizist*innen fuhrwerken‘, die Stadelmaier ein Dorn im Auge sind, und den „allgemeinen elektronischen Stammtisch-Sumpf des Jeder-darf-mal-Postens und Senf-dazu-Gebens“ (S. 39) produktiv erschließen, vor dem der Feuilletonist so nachdrücklich warnt.
Es ist an der Zeit, den Spiralblock nicht nur als Insignie des allmächtigen Kritikers, sondern auch als Zeichen für die grundsätzliche textuelle Verfasstheit der Kritik zu verabschieden. Das heißt nicht, dass es keinen Platz mehr für die geschliffenen Verrisse oder Apotheosen des Zeitungsfeuilletons geben soll. Es heißt aber, dass das Kritisieren und Diskutieren von Theater als gesellschaftlich relevante Kunst überall dort stattfinden muss, wo Gesellschaft diskutierend zusammenkommt. Wie das Theater braucht auch die Theaterkritik also viele Orte – und Formen.
[1] Gerhard Stadelmaier: Regisseurstheater. Auf den Bühnen des Zeitgeists, Springe 2016. Alle Zitatnachweise in der Folge direkt in Klammern.
[2] Anonymus: „An das Parterre“, in: Der dramatische Censor Christmonat (1782), H. 3, S. 97-121, hier: S. 100.
[3] Anonymus: „An das Parterre. (Fortsetzung)“, in: Der dramatische Censor Januarius (1783), H. 4, S. 145-158, hier: S. 157.
Photo by Steve Johnson on Unsplash