Was ist modern?
 Beleuchtete Nische
Beleuchtete Nische
In der lyrikzeitung kam der Hinweis auf einen neuen Beitrag von Peer Trilcke zur Literaturdebatte auf litlog.de unter dem Titel „Buh! Eine Bewegung?“:
„Betrachtet man die zurückliegende Debatte also als ›Realismusdebatte‹, dann erweist sie sich als ebenso traditionsreich wie traditionell: Sie operiert mit einem prädigitalen Realismusbegriff und sie beruht auf einem engen, letztlich elitären Literaturbegriff. Wirklich gegenwärtig, wirklich auf der Höhe der Zeit war die Debatte irgendwie nicht.
In dieser Diagnose deutet sich bereits an, worin ich das Symptomatische der Debatte sehe. Man könnte sagen: Die Debatte ist ein Symptom dafür, dass jene Teile des deutschen Literaturbetriebs, die diese Debatte führten, bisher im Grunde nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind. Konzeptionell und operativ verharren sie in einer Welt, die nicht wesentlich anders ist als vor, sagen wir, vierzig Jahren. …“
Clevere Argumentation: Die etablierten Literaturopas und -omas haben keine Ahnung vom Heute und sie fordern etwas, das es heute nicht mehr gibt. Die neue Literatur kann eine Art Realismus, wie sie das rückständige Betriebspersonal auf den Kaffeefahrtplätzen anfragt, gar nicht mehr leisten, weil es diese prädigitale Realität nicht mehr gibt.
Leider kenne ich mich in der Prosawelt nicht gut genug aus, um abschätzen zu können, inwieweit Trilckes Einschätzung richtig ist (daß es mehr Realitäten gibt als Literaturen, ja daß die Gegenwartsliteratur tatsächlich nur minimale Ausschnitte – und eben sehr speziell gewählte Ausschnitte – aufzeigt und sehr spezielle Leserschaften bedient, ist mir dennoch klar). Für die Lyriknische stelle ich mir davon ausgehend aber die Frage:
Was ist modern?
Weltbesiegen durch Weltersetzen – so könnte man grob die Erleichterungsstrategie der Moderne umreißen. Dazu gehört nicht nur die virtuelle Überhöhlung, in der man durch die Welt spazieren kann, sondern auch die Selbstbefüllung, die eine Befüllung mit dem Selbst ist. Mach dein Gusto zu deinem Projekt. Mit einem Lautsprecher im Ohr lauschen wir nach unserem Menschsein, das facebook vor Augen teilen wir unser Hüllenouting und schreiben uns in nischenwarme Sphärenkataloge ein. Mit der Extrablattmentalität unserer Textspiele kitzeln wir Schlagzeilen in die Langeweile von lyrischen Spezialgrammatiken und bedienen uns in den Megaarchiven dekonstruierbarer Vergangenheiten. Es gibt Spielangebote en masse. Wir beschäftigen uns. Wir haben mit der Welt nichts mehr zu schaffen, sondern befinden uns im Transit von einer menschengemachten Gefülltheit zur nächsten. Unsere Erfindungspotenz steuert uns traumwandlerisch | pfadfinderisch hinein ins Paradies anstrengungsloser Existenz und wir vertrauen auf das Klimatisierungsgeschick der Technokraten, auf daß der Betrieb allen Geräts dem Menschen das Leben angenehm macht (und der Welt den Garaus). So ungefär ist es Fakt.
Der Mensch versucht seit Urzeiten aus den Dringlichkeiten der ihn zum Inhalt machenden Welt zu entkommen in Umgebungen, deren Inhalt er selbst bestimmt und die ihn schwerelos enthalten. Die Moderne sagt ihm, er sei dank ihrer fast am Ziel. Wenn er das Dunkel der Nacht, die Kälte des Winters, die lange Weile der Dinge, die Entferntheit des Glücks und das Nagen des Hungers nicht mehr spürt, sei er endlich frei. Nimm das Pathos aus der Welt, meint ein postmoderner Chorus. Ohne Belastungen eine eigene Welt leben zu können, nicht mehr gegen die kalten Lüfte einer ins Schaukeln exponierenden Daseinsbehauptung anbibbern zu müssen, sondern im Gegenteil: die Welt abhaken zu können als Lieferant von Chic und Bequemlichkeit, das ist das große Heilsversprechen der Jetztzeit.
Was das kostet, inwieweit man sich dann ersatzweise kettet an die Dringlichkeiten jener Mechanismen, die benötigt werden, um dieses Versprechen einzulösen, davon redet sie nicht. Die Jetztzeit macht den Menschen zwar frei von den Dringlichkeiten der eigentlichen Welt, aber sie bindet ihn dafür an sich und zwingt ihn in ein modifiziertes Lastentierdasein: er, der intelligente Esel, muß jetzt neue, menschengemachte Lasten tragen. Autonomie pflichtet den Autonomen an die Instrumente der Bemächtigung, die ihn freisetzten - und so sind wir in Wahrheit nur scheinfrei, weil vernetzt, in den Strukturen der eigenen Herrschaftsverwirklichungen gefangen. Streicht man uns unsere Errungenschaften, sind wir sehr schnell wieder nur ein mögliches, in die Welt geborenes Wesen, das seinen Raum sucht.
Die Jetztzeit sagt: Du hast deinen Raum bereits, du kannst ihn gestalten, wie du es willst. Du bist der Bestimmer über dein Leben, du bist frei. Solange du im postmodernen Pseudoraum Individualitätsträume ausagierst, bist du risikofirm unter den Gewinnern. Das Überstülptsein hat die Wärme einer Glucke. Und das ist der Ort, wo heute Literatur entsteht. Das ist gemeint, wenn kritische Blicke in der Literatur von heute Bodenverlust und Planetariumsaufenthalte entdecken, Sternbildaufführungen aus Individualhimmeln. Und das gibt es sicher. Es gibt die Expertenpraxis, die ihre spracherotische Wirkung aus dem Handwerklichen bezieht und mit Erzeugungstechniken Akzente setzt, genauso wie den heroischen Schreiber, dem die Literatur alles und sein Dasein Literatur ist, den im Schreiben Ersatzlebenden, den freiwillig als Knecht des Wortes in die Stube eingehimmelten Hungerkünstler. Und es gibt den ichlebigen Prediger des inhaltism genauso wie den ichlosen Vorbeter der Sinnlosigkeit, der ausgerechnet sucht, was er angeblich verneint und vernichtet. Ich würde von einer wirklich zeitgemäßen Literatur erwarten, daß sie viel offener und weniger positionskämpferisch diskutiert und in erster Linie diagnostisch und selbstkritisch.
Denn: Sprache hat wieder etwas zu sagen. Das sollten wir nicht vergessen. Das Zeitalter der Dekonstruktion ist vorbei. Der Teilchenbeschleuniger ist ein Instrument von vorgestern. Dem ganzen Zerlegen und Ausbreiten des Zerlegten muß ein neues Sinnfinden folgen. Was machen wir mit den Teilen, die wir im Bestand der Welt gefunden haben? Zusammenräumen und Wegschmeißen, Aufkehren und Schluß. Oder sinnvolle Wege der Synthese finden, des neu Zusammendenkens und -fügens. Es geht längst nicht mehr um das Verneinen von Inhalt und Finden neuer Form – es geht um das Füllen des Raums mit new inhaltism. Dabei ließe sich ein Wort wie Verantwortung wahrnehmen.
Ein Teil unserer kulturellen Avantgarde versteckt sich in der Dekonstruktion und im Diskurs statt in der Konstruktion (und es gibt, nebenher gesagt, auch noch ausreichend axiomatischen Beton, der sich aufhämmern ließe, nur sieht man den ohne Aufräumen nicht).
Ein anderer Teil hat schon den Schritt des Neumachens gewagt. Es geht wieder ums Können. Nicht ums Zerstören können (schaut her, wie mutig ich Traditionen und Tabus breche!), sondern ums Erzeugen können. Das Zerlegen, Zerreißen und Zerhauen der Altzeugnisse lebt von einer destruktiven Gewalt, die das Ruinöse als Chance sucht. Die Sehnsucht nach Zertrümmern ist die Sehnsucht neuen Raum zu gewinnen und letzten Endes sich selbst zu befreien von den Umlagerungen und Verklärungen der vormaligen priesterlichen Inhalts(er)finder. Aber Neumachen ist ein komplett anderes Handwerk.
Kurz: die erfolgreiche Aufklärung war der Scheibenwischer im automobilen Exkurs. Dabei haben wir sehen gelernt, daß uns ein Gefährt durch die Welt bringt und wollten wissen, wie es das tut. Wir haben es auseinander genommen und seltsame Komplexität gefunden, wo wir Iche vermuteten. Und jetzt wäre es Zeit (mit der Kenntnis der Karre) das Wagnis des Neustarts einzugehen, andre Strecken zu fahren und alte Strecken in eigenem Tempo. Aber man ist noch im alten analytischen Diskurs gefangen und dreht sich im Kreis, als würde man sich in einem Kabel-und Teilegewirr verlieren (müssen!). Der Diskurs wurstelt sich von A nach B und C nach D und weiß so einiges, aber eben nicht, wo er hinsoll außer in die Runde. Und mancher akademischen Gemeinde ist das gerade recht. Reden bis Nichts mehr nachkommt. Das nährt die Redenden prächtig und alle anderen werden vertröstet aufs Warten auf die Bescherung. Nötig haben wir (Ideen für) neuen Tacheles und die Synthese.
Auch das ist berechtigte Kritik an der zeitgenössischen Literatur – sie hat oft keine Traute zu neuem ehrlichen Inhalt, sondern hängt romantisch in den alten dekonstruktiven Verzweiflungsfiguren herum, oft genug auch in abgedrehter Expertenpraxis oder schmucker Harmlosigkeit fest.
FM, 09.05.2014


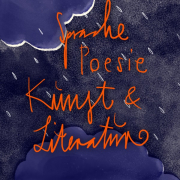

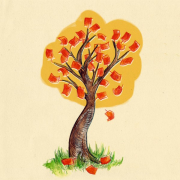




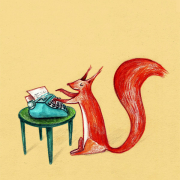
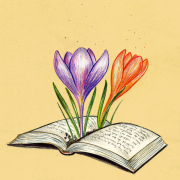

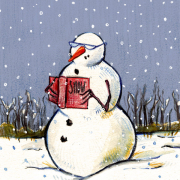
Neuen Kommentar schreiben