Ramsch
 Cover der N° 168
Cover der N° 168
Wespennest N° 168 ist ab morgen, den 13.05. im Buchhandel erhältlich: Thema: Ramsch
Etwas als Ramsch zu bezeichnen ist kein Kompliment, so viel ist sicher. Zu Ramsch wird einerseits, was aus der Zeit gefallen ist und somit ein klar beschreibbares Verhältnis zur Endlichkeit hat. Andererseits ist Ramsch auch etwas, das an Individualität verliert und in Haufen auftritt. Zeit und Masse sind somit die beiden für die Wertminderung ausschlaggebenden Faktoren. (zum Editorial)
Davon ist auch die schriftstellerische Produktion nicht ausgenommen. Für die Ewigkeit gedacht, landet sie doch nicht selten bei den Remittenden. Dieses Schicksal holt – mehr oder weniger rasch – alle Autoren ein. Über die Vergeblichkeitssorge und das Ewigkeitswollen eines Autors schreibt Peter Strasser. Die melancholische Selbstreflexion verbindet ihn mit dem Sammler: Auch er möchte das Einzelne aus der Masse retten, das Weggeworfene aus der Vergänglichkeit. Vom Leiden und den Leidenschaften des Sammlers erzählt Walter Famler in einem Gespräch mit Andrea Roedig. Dem Verhältis vom Einzelnen zur (traurigen) Masse widmet sich Georg Seeßlen in seinem Essay über Massen-Phantasmagorien im Film.
Milena Solomun betreibt Feldforschung und versucht sich gemeinsam mit einem finnischen Punk im Containern und Wiederverwerten dessen, was andere weggeworfen haben. Das Finnische zeigt allein auf sprachlicher Ebene die unterschiedlichen Aspekte von Ramsch: So unterscheidet man Rihkama, also „Kram, dessen Notwendigkeit sehr fragwürdig ist“ von Roina, „allerlei Ramsch, den man zum Beispiel auf dem Dachboden aufbewahrt“. Dass die Grenzen zwischen Ramsch und Müll, Wertstoff und Schrott fließend sind, zeigt auch Marc Engelhardt. Er spürt Europas überflüssige Waren in Afrika auf – ob Kleidung oder Elektronikgeräte – und steht schnell vor der Frage, ob europäischer Export zweitklassiger Ware nach Afrika nicht eine Parallele zur Kolonisierung von einst sei, da sie den Aufbau eigener Industrie verhindert und zugleich den „Strom des Begehrens“ fixiert.
Die Autorinnen und Autoren dieser und weiterer Beiträge des Schwerpunkts suchen Ramsch zudem auf in Discountern, in Leiharbeitsfirmen und in Ratingagenturen, beleuchten Ramsch also als vielseitiges Phänomen, als logische Folge und paradoxen Ausdruck einer auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsordnung.
Außerdem in diesem Heft: Nielsen hält in einem furiosen Prosatagebuch aus dem Herbst 2014 eine Fahrt durch das Kriegsgebiet im Osten der Ukraine fest und den anschließenden Besuch auf den Bühnen einer deutsch-österreichischen Kulturforums- und Botschaftswelt. Als Literaturprogramm beschenkt eine Historikertagung in Kiew ihr Publikum mit Ernst Jüngers In Stahlgewittern auf Ukrainisch. Der Schriftsteller und Publizist Marko Martin beschäftigt sich in seiner Reportage über Südafrika mit Monumenten der Macht. Deren architektonische Charakteristika führen ihn nicht nur zu einer Auseinandersetzung mit der (Kolonial)Geschichte Südafrikas, sondern erinnern ihn auch an Machtdemonstrationen des DDR-Regimes. Das Wespennest-Porträt ist diesmal Gordon Ball gewidmet: Ein Auszug aus seinem 2011 erschienenen Band East Hill Farm: Seasons with Allen Ginsberg ermöglicht Einblicke in das Leben in der Kommune. In einem Interview erzählt Ball außerdem vom Geist der Sechzigerjahre, seinem Leben nach Verlassen der East Hill Farm und dem Politischen in der Kunst.
Weiters enthält das Heft Lyrik und Prosa von Michael Hammerschmid und Barbara Schwarcz, Benoît Gréan, Monika Schnyder, Udo Kawasser und André Schinkel sowie einen ausführlichen Buchbesprechungsteil unter der redaktionellen Verantwortung von Thomas Eder.

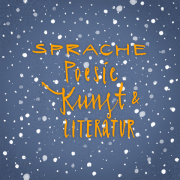
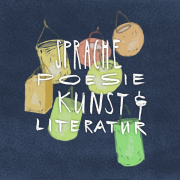
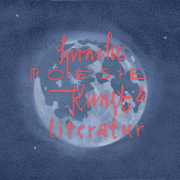
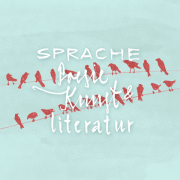
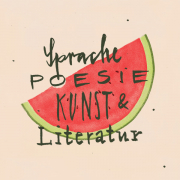
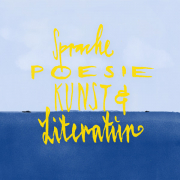
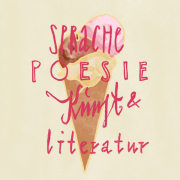

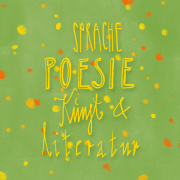
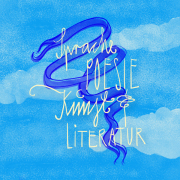
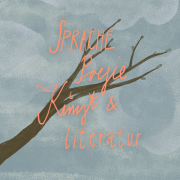
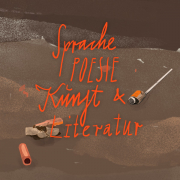
Neuen Kommentar schreiben