Paradoxa in nuce
 Still aus dem Film „In girum imus nocte et consumimur igni (Wir irren des Nachts im Kreis umher und werden vom Feuer verzehrt)“ (1978) von Guy Debord; Kamera: André Mrugalski. 35mm, s/w, 99 min.
Still aus dem Film „In girum imus nocte et consumimur igni (Wir irren des Nachts im Kreis umher und werden vom Feuer verzehrt)“ (1978) von Guy Debord; Kamera: André Mrugalski. 35mm, s/w, 99 min.
Vom 29. Januar bis zum 11. Februar 2016 im Österreichischen Filmmuseum:
„Demnächst in diesem Kino: DIE GESELLSCHAFT DES SPEKTAKELS. Und danach überall sonst: IHRE ZERSTÖRUNG.“ Die Unbedingtheit, die aus Guy Debords Kino-Trailer für seinen Film La Société du spectacle spricht, mutet fast wie ein Witz an – und ist auch einer, nicht erst heute (in der noch viel extremeren Gesellschaft des Spektakels Jahrgang 2015), sondern schon damals, 1973. Dieser Witz ergibt seinen schneidenden Sinn aber erst dann, wenn man ihn – so wie das gesamte schneidende Schaffen von Guy Debord (1931–1994) – nicht wie üblich als Muskel-Entspannung nach der Pose der Unbedingtheit begreift, sondern als deren ernsteste Zuspitzung. Es ist der härteste Galgenhumor, der in der Kunst, im Kino und in der Gesellschaftstheorie des 20. Jahrhunderts zu finden ist.
Zugleich steckt in Debords luzider Härte der Vorschein eines anderen Lebens, und sei es nur durch das emphatische Wachhalten jener (biografischen) Erfahrungen von Freiheit und Revolte, die er in den Filmen immer wieder beschwört. Er hat dieses andere Leben beschützt, indem er sich weigerte, „das Spiel zu spielen“. Er stellte lieber neue Spielregeln auf. Er wurde nicht zu einem der üblichen öffentlichen Intellektuellen (Hofnarren), die das Spektakel als „kritische Geister“ beleben, sondern machte sich nahezu unsichtbar. Schon 1959 heißt es in seinem zweiten Film: „Ein Film über diese Generation kann nur ein Film über das Fehlen ihrer Werke sein.“ Debord war damals keine 30, und „diese Generation“ ist die internationale Gruppe der Situationisten, in deren Mitte er sich bewegte.
Heute scheint es fast, dass sich die Prophezeiung von 1959 vor allem für Debords Filme erfüllt hat. Sein posthumer Ruhm als einer der zentralen Autoren revolutionärer Kulturkritik und radikaler Kunstpraxis bedeutet nicht, dass sein kinematografisches Œuvre zum Kanon gezählt würde. Seine drei Langfilme und drei Kurzfilme, entstanden zwischen 1952 und 1978, sind kaum bekannt (auch aufgrund des vom Autor selbst verfügten Aufführungsverbots nach 1984), obwohl darin sein Denken wie auch seine Paradoxa in nuce dargelegt sind.
Sechs essayistische, sprachgewaltige, zwischen Fotografie, Bewegtbild und Stimme, zwischen Wut und Melancholie changierende Kinomonumente „gegen das Kino“. Werke, die den politisch-kulturellen Konsens der Medien- und Konsumgesellschaft frontal angreifen und dafür das Massenmedium ihrer Ära wählen – allerdings in Schwarzweiß. Filme, die zugleich „strategisch“ und „maßlos“ sind: strategisch nicht nur, wenn sie Clausewitz, Johnny Guitar, Karl Marx, Die Kinder des Olymp und Baltasar Gracián zitieren, maßlos nicht nur in ihrem Abzielen aufs große Ganze. Und Filme, die diesen ganzheitlichen Angriff durchwegs auf der Grundlage einer singulären, persönlichen Erfahrung führen. Das macht sie teilbar, mitteilbar, benutzbar – gerade weil sich kaum jemand mehr vorstellen mag, wie ein Leben, ein Alltag jenseits des Spektakels aussehen könnte.

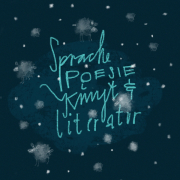

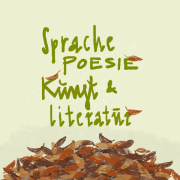
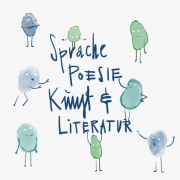
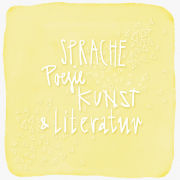
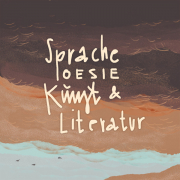
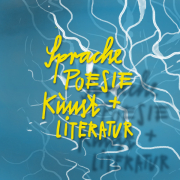
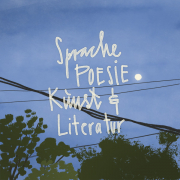
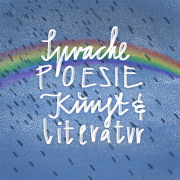
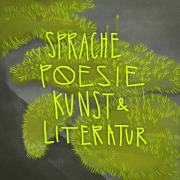
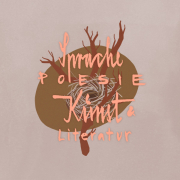
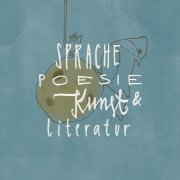
Neuen Kommentar schreiben