 Mit Vollgas unterwegs in Sachen Bücher und Autos
Mit Vollgas unterwegs in Sachen Bücher und Autos
– Ein Verlagsporträt von Senta Wagner.
Es gibt Häuser und es gibt Bücher. Aber nur ein Haus der schönen Bücher. Mit diesem Attribut schmückt sich der in Wien ansässige Septime Verlag, der 2008 von Jürgen Schütz gegründet wurde. Und über das Schöne der Bücher wird zu reden sein. Das Gespräch findet jedoch nicht in jenem Haus statt, denn Schütz führt seinen Buchverlag vom Laptop aus, sondern im Raucherabteil eines Kaffeehauses. Bis heute, der Frühjahrsvorschau 2014, ist das Buchprogramm beachtlich angewachsen auf etwa zwanzig lieferbare Titel. Die lagerten im Burgenland im Haus der Mutter: Da haben wir es also doch, das Haus der schönen Bücher.
Perspektivenwechsel
Ganz am Anfang kam ihm vielleicht der Zufall zu Hilfe. Jürgen Schütz habe gute Literatur machen wollen und so wurde aus der ursprünglich geplanten Gründung eines Literaturmagazins kurzerhand die eines Verlags, der 2009 einen starken Auftakt wagt. Die literarischen Interessen des Mitte vierzigjährigen Septime Verlegers gehen weit über die Meere nach Lateinamerika. Julio Cortázar und andere dort beheimatete Fixsterne der Literatur habe er schon immer verehrt. Das Ergebnis: Schütz publiziert die erste Anthologie seiner Taschenbuchreihe Perspektivenwechsel mit einer turmhohen Auflage aus Anlass des 25. Todestags von Cortázar. Darin versammelt sind „zehn Erzählungen von zehn großen Autoren zum Thema Lateinamerika“. Der Grundgedanke der geplanten Serie ist kein neuer: „Große Literatur dem Leser in kleinen Häppchen präsentieren.“ Tatsächlich befinden sich in dem Band deutsche Erstübersetzungen der Phantomas-Novelle von Cortázar und der Erzählung „Labyrinth“ des Chilenen Roberto Bolaño. Der habe als Geheimtipp gegolten, der Medienhype um den Roman „2666“ sollte erst noch einsetzen. Trotzdem, der Erfolg bleibt aus. Ein Hardcover hätte er machen sollen, kein billiges Softcover, sagt er heute zu seiner ersten Verlagspanne. Weitere Fehler sollten folgen. Trotzdem sei die Arbeit an einer Anthologie eine der schönsten, wenngleich aufwendigsten und teuersten. In den Jahren 2010 und 2012 folgen zwei weitere Bände, der geplante vierte Band im Herbst 2013 wird auf Eis gelegt. Wenn nicht der Todestag, dann eben der hundertste Geburtstag: Der erste Reihenband mit dem Text von Cortázar wird 2014 erneut als zu entdeckender Schlager angepriesen.
 Lateinamerikanische Trouvaillen
Lateinamerikanische Trouvaillen
Literatur aus Lateinamerika prägt bis heute das Verlagsprofil von Septime. Die Autoren kommen aus Argentinien, Chile, Kuba und Mexiko. 2010 erscheinen Erzählungen des Exilkubaners Guillermo Cabrera Infante und der einzige Roman des Mexikaners Juan José Arreola, beide Anfang 2000 verstorben. Auch diese Bücher liegen in deutscher Erstübersetzung vor. Arreola stehe im lateinamerikanischen Kanon neben Cortázar, schwärmt Schütz bei der Beschreibung seines Romans „Der Jahrmarkt“, der seit seiner Erstpublikation 1963 nicht übersetzt worden sei. Zu weiteren Entdeckungen, von Septime ins Deutsche gebracht, gehört die preisgekrönte chilenische Schriftstellerin Nona Fernández, die 2014 ebendort mit ihrem zweiten Buch erscheint, sowie der erfolgreiche argentinische Autor Carlos Gamerro mit seinem Roman „Das offene Geheimnis“ (2013). Zu diesem Zeitpunkt verfügt der Verlag bereits über einen beachtlichen Pool an Damen und Herren Übersetzern.
Dem Verleger gelingen also lauter solche Trouvaillen, die zwar auf dem deutschen Markt und von den dortigen Medien wahrgenommen würden, kaum aber auf dem österreichischen, was sich auch an den Umsätzen zeige. Keine Stapel mit Septime-Büchern beim hiesigen Buchhandel, dessen Zurückhaltung für einen Kleinverlag das Wirtschaften nicht einfach macht. Schütz bleibt energiegeladen, nach dem Motto: jetzt erst recht. Er sehe Septime auch nicht als österreichischen, sondern als deutschsprachigen Verlag, setzt er einen drauf. Auf die Frage, wo er sich in der österreichischen Verlagsszene sehe, lautet die Antwort: „Unser Portfolio ist das beste in Österreich.“ Zu seinen Vorbildern zählten der Unionsverlag sowie die Verlage Liebeskind und Kunstmann. Nur Freunde hat er mit obigen Aussagen sicher nicht.
 Wer bei uns ist, bleibt bei uns
Wer bei uns ist, bleibt bei uns
Mit dem Jahr 2011 beginnt der Verlag, auch auf den jungen deutschsprachigen Nachwuchs zu setzen, wie Valerie Fritsch und Tobias Sommer, mit dem Wunsch, sich einen Stamm an Hausautoren aufzubauen: „Wer bei uns ist, bleibt bei uns.“ Mit den toten Autoren könne man schließlich keine Veranstaltungen mehr machen. 2013 debütieren daher gleich drei viel versprechende Autoren im Romanfach: die Österreicher Jürgen Bauer und Isabella Feimer sowie der gebürtige Südtiroler Christoph Flarer. Bei Feimer klingelt vielleicht was, sie war 2012 für den Bachmannpreis nominiert. Mit ihnen wolle Schütz seinen Verlag für Literatur groß machen: einem Mix aus Debütanten und Newcomern sowie internationalen Autoren. Zu Letzteren zählen etwa auch der Japaner Ryū Murakami, der mit „Das Casting“ unter den diesjährigen Finalisten des Hotlistpreises landete. Der ist dann doch mit seinem sehenswerten Cover in einer Vielzahl von Buchläden zu entdecken. Stolz bestätigt Schütz, dass er die sorgsame Herstellung und Umschlaggestaltung seiner Bücher selbst besorge.
Im gleichen Jahr, 2013, geht es weiter mit Preisen und Nominierungen, in Summe sechs. Die Segnungen betreffen gleichermaßen Übersetzer des Verlags, den Verleger selbst und die Autorinnen Fritsch und Feimer. Es ist aber auch das Jahr, in dem sich der Septime Verlag kräftig übernimmt. Ein Bestseller hätte genügt, um die Finanzen auszugleichen, erzählt Schütz nüchtern. Jeder kleine Verlag weiß, wie schwer das ist. Hier fehlt es grundsätzlich am großen Budget für Pomp wie Marketing und Werbung. Andererseits gibt es bei Septime Vorschüsse! Und dennoch ist der Verleger happy: Mit dem norwegischen Dichter Jan Kjærstadt gewinnt er seinen lebenden Lieblingsautor für Septime. Die Übersetzung des 650-Seiten-Wälzers „Ich bin die Walker Brüder“ durch Bernhard Strobel war die teuerste überhaupt in der Verlagsgeschichte, dazu war die Förderung zu gering und die Auflage zu hoch. Am schlimmsten: Das Buch wird nicht wahrgenommen, Schütz ist fassungslos. Kjærstadt zähle zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Norwegens, der bereits bei den Verlagen Rotbuch, Eichborn und zuletzt bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht wurde. Zwei weitere Romane sollen 2014 und 2016 erscheinen, in beiden Fällen wohl dünnleibigere.
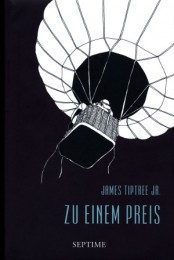 Großprojekt James Tiptree Jr.
Großprojekt James Tiptree Jr.
Wachsenden Erfolg verbucht der unabhängige Verlag mit einem weiteren Zufallstreffer, der inzwischen zu einem Riesending gewuchert ist. 2011 werden die Rechte am Gesamtwerk der US-amerikanischen Schriftstellerin James Tiptree Jr. erworben, Ecke Science-Fiction. Dies bedeutet die Herausgabe sämtlicher Erzählungen in Neuübersetzung, angelegt auf sieben Bände, sowie zweier Romane. Die Bände erscheinen seitdem in rascher Folge, das fünfte Buch bereits im Sommer 2014. Den Druck mache die Leserschaft, eine wahre Fangemeinde, wie anzunehmen ist. Zwei Bände sind bereits in der zweiten Auflage erhältlich. Wenn Kritikerlob von Denis Scheck (druckfrisch) kommt, kann mal schnell eine Auflage über Nacht ausverkauft sein. Dann herrschen im Hause Septime Freude und Erleichterung. So soll 2015 auch noch eine Jubiläumsausgabe mit Essays und Gedichten zum hundertsten Geburtstag der Autorin beigesteuert werden. „Weltweit die einzige“, betont Schütz, der das Unternehmen Tiptree als sein „Lebenswerk“ betrachtet. Bei den Übersetzungen werde sprachlich nichts mehr geschönt, es gebe zudem ein Lektorat und Korrektorat für alle Bände – mit anderen Worten: Septime gilt ab sofort als „Spezialist“ für das Werk Tiptrees. An solchen Qualitäten werden kleine Verlage gemessen, weiß Schütz.
Sieben
In der Septime steckt die sieben – die Zahl mit der universellsten Symbolik in Kultur und Religion. Aber auch die Zahl des Glückes, das der Verlag von Beginn an brauchte. So entstand der Name Septime Verlag. Glück hat noch einen anderen Namen: Sabrina Gmeiner. Seit rund zwei Jahren kümmert sie sich neben ihrem Vollzeitberuf um die Öffentlichkeitsarbeit und die Lizenzen. Programmchef sei Schütz, treffe aber keine Entscheidung ohne Gmeiner. Nun allerdings lässt sich die Sonderstellung der sieben auch auf das Image des Verlegers Jürgen Schütz übertragen: Er gilt in der Buchbranche als Sonderling. Schütz spricht von anfänglicher „Ausgrenzung“. Er ist der, „über den ganze Buchmessen reden“. Wortreich kann er von vielen negativen Erfahrungen berichten. Und das alles nur, weil er kein Studierter sei, sondern aus der Autobranche komme. Jetzt wissen es alle. Dennoch, so sagt er, nimmt die Wertschätzung seines Verlags zu. Nach seinen schönen Büchern will er beurteilt werden, nicht nach seiner Person, betont er. Ausführlich geht es weiter: Den Weg zur Literatur habe er einzig und allein über die eigenen Lektüreerlebnisse gefunden. Früh beginnt er zu lesen und liest sich bald durch die gesamte Weltliteratur. Schütz, ein wirtschaftlich denkender Kopf, muss einen Riecher für Literatur haben.
In der Autobranche arbeitet er auch heute noch, seit ein paar Jahren höchst erfolgreich im After-Sales-Bereich. Ohne diesen Deal und ohne Verkäufe von Fahrzeugen aus seiner Oldtimersammlung gäbe es seine Literatur nicht. Auch wenn immer wieder von „Vollgas geben“ die Rede ist, seine zwei Leben trenne er: Brotberuf und Leidenschaft im Zweischichtbetrieb, und zwar sieben Tage die Woche, „rund um die Uhr“. In beiden Jobs wolle er der Beste sein, alles für alle tun. Für andere Dinge bleibt dem Workaholic da keine Zeit. Es ist Samstag – Jürgen Schütz ist nicht mit dem Auto in Österreich unterwegs, sondern sitzt im Raucherabteil zum Gespräch. Es ist Verlagstime, gleicht trifft er Sabrina Gmeiner.
Buchempfehlung
„Der afghanische Koch“ von Isabella Feimer. Die junge Autorin aus Wien veröffentlicht ihren Debütroman, siehe oben, 2013 bei Septime. Inzwischen hat sie für diesen ihren ersten Anerkennungspreis (Kulturpreis des Landes NÖ) erhalten. Als freie Theaterregisseurin und Stückeschreiberin ist sie schon um einige Jahre länger erfolgreich mit Sprache beschäftigt.
Das ist ihrer gut gearbeiteten, ebenso einfühlsamen wie energischen Prosa anzumerken. Sie stellt ihr folgendes Zitat voran: „Er in Liebe still, / ich in stiller Liebe laut, / diesem Uns folgend.“ In diesem Uns steckt nicht nur die liebende Selbstbehauptung eines jungen Paares, sondern auch jedes einzelnen. Ein starker kultureller Kontrast läuft wie eine Trennlinie zwischen den beiden Hauptfiguren der Icherzählung. Das Motiv der Fremdheit ist prägend für die Geschichte, an ihrer Überwindung wird geschrieben. Rahman ist Heimatloser: Seine Flucht vor dem Terrorregime der Taliban in Afghanistan brachte ihn, gerade mal zwanzig, nach Wien. Sie ist ein „Kind des Glücks“, aufgewachsen in den wohlstandsbehüteten 80ern des „goldenen Westens“. Längst sind beider Leben entzaubert, sie sind im Hier und Jetzt einer prekären Gegenwart von Mietwohnungen angekommen. Er ist Koch statt Arzt in Kabul, sie eine Exkellnerin ohne Job, im Hintergrund das stete Rauschen des Fernsehers. Es wird viel geraucht und getrunken. Im Krieg bringen die TV-Filme in den Kellerverstecken das Vergessen, erfährt sie von ihm.
Feimer erzählt eine Liebesgeschichte, die zärtlich pulsiert und fortbesteht, sich ihrer selbst vergewissert, gerade indem sie zu Papier gebracht wird: „Jede geschriebene Geschichte ist immer nur ein Bruchteil derselben, man kann kein ganzes Leben skizzieren …“ In ein Notizbuch notiert die Icherzählerin Rahmans Erinnerungen an sein früheres Leben. Einen großen Teil nimmt dabei seine dramatisch verschlungene Flucht nach Europa, sein nacktes Überleben ein. Mühelos verknüpft die Autorin dabei mehrere Erzählstränge und unterschiedliche „Erfahrungswelten“: ihre aktuelle gemeinsame Geschichte mit seinen „Blitzlichtern“ der Vergangenheit, bis mit einem Mal ihr eigenes „Bilderalbum der Vergangenheit“ seine Seiten aufschlägt. Die Lesenden fesselt sie mit jedem Absatz. Feimers Beschreibungsfreude, ihr Können vom Fühlen, Schmecken, Riechen zu schreiben, sind bemerkenswert. Ihre Sprache ist tänzelnd, in den szenisch dichten Passagen hängen die nur durch Kommas gereihten Dialoge wie atemlos aneinander. Wenige Punkte setzen den Sätzen und Satzfetzen ein Ende. Der in den Erzählpassagen angeschlagene ruhige Ton setzt auch auf formaler Ebene einen Kontrast.
Ein Flüchtling kommt, wenn überhaupt, nie heile an, innerlich wie äußerlich nicht, die eigenen Pläne sind nie mehr die gleichen, „die Träume zurückgelassen“. Er ist ein Opfer: „Einmal Flüchtling, immer Fremder“, sagt er. So ein Leben ist geprägt von Gewalt, Angst, Heimweh, Sehnsüchten, kleinen diebischen Freuden, Straftaten, aber auch von den Düften und Farben eines einst schillernden Landes, das es nicht mehr gibt. Der Leser ist dankbar für solche Bilder eines fremden Landes. Afghanistan bedeutet Krieg. Rahman hat sich trotz allem seine „Lebenslust“ bewahrt. Das macht aus dem Roman kein Klagebuch, sondern ein Buch des Mutes zum gegenseitigen Verstehen über Kulturräume hinweg. Nicht, dass wir das nicht wüssten. Isabella Feimer bestens recherchiertes Debüt „Der afghanische Koch“ bringt es auf besonders schöne Weise zum Ausdruck.
Senta Wagner
Isabella Feimer: Der afghanische Koch. Wien: Septime Verlag 2013. 214 Seiten. Zur Homepage des Septime Verlags.












