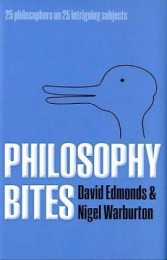 Fragen Sie Ihren Arzt oder Philosophen
Fragen Sie Ihren Arzt oder Philosophen
– Ratgeber gibt es genug, dennoch haben die vermeintlichen Experten die meisten entscheidenden Entwicklungen, Krisen und Katastrophen verschlafen, falsch beurteilt oder deren Bewältigung vermasselt: das europäische Finanzchaos nebst Eurokrise, die Nahost-Revolutionen, das Debakel des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan, die immensen Defizite eines föderalistisch organisierten chaotischen Schul- und Bildungssystems u.v.a.m. Vielleicht kann nun der geballte Philosophie-Boom diese Misere beheben und einen klaren Kurs im nebulösen Hier und Jetzt anzeigen? Zwei neue Philosophie-Magazine und etliche krypto-metaphysisch angehauchte Bände wollen nicht mehr abgehoben dem Hegelschen Weltgeist hinterherschweben, sondern in die profanen Niederungen des Alltags hineinleuchten, um auf drängende Fragen richtige Antworten zu finden – mit philosophischem Tiefgang, versteht sich. Von Peter Münder
In dem wunderbaren Band „Philosophy Bites“, 2010 vom BBC-Reporter David Edmonds und dem Philosophiedozenten der Open University Nigel Warburton herausgegeben, werden etliche Themen, die bisher kaum für erkenntnistheoretisch relevant galten, so frisch und lässig ohne ideologische Scheuklappen mit insgesamt 25 Philosophen diskutiert, dass man sich verblüfft die Augen reibt: In einem Kapitel werden etwa die Kriterien für die Beurteilung eines guten Weines angesprochen: Geht es dabei nur um subjektive Vorlieben, die der Weinkenner in den Wein hineinprojiziert? Wie will man bei diesem Geschmacksproblem überhaupt zu einem objektiven Urteil gelangen? Und ist dies eigentlich ein Problem, das sich ebenso gut für eine philosophische Erörterung eignet wie das halb volle Glas Wasser, über das Sartre einmal in einem Pariser Café lang und breit theoretisierte? In anderen Kapiteln diskutiert man über den Zeitbegriff, das Böse, die Bedeutung des Lebens, über Sport und Unterhaltung, über Freundschaft und natürlich auch – mit dem bekannten Tierschützer und Philosophen Peter Singer – über den Unterschied zwischen einer „Person“ und einem „menschlichen Wesen“. Der wissbegierige, insistierende Edmonds und die scharfsinnigen Repliken seiner Gesprächspartner gestalten diese in bester platonischer Tradition geführten Diskussionen als spannende philosophische Exkursionen. (Hörenswerte Podcasts von Edmonds und Warburton finde Sie übrigens hier.)
Was einige dieser Luftschiffer des Geistes allerdings aus dem Konzept brachte, war die nicht angekündigte, spontan geäußerte simple Frage des Interviewers: „Was ist überhaupt Philosophie?“ Nur wenige hatten eine knackige Antwort wie „Denken über das Denken“ parat, manche erzählten einfach Witze, die das Thema irgendwie beleuchten sollten, andere waren so sprach- und ratlos, dass sie einfach nur laut lachten, aber keine Antwort riskieren wollten. In zwei kurzen Sätzen wollten sie sich weder als Jung-Hegelianer noch als Ratgeber für alle Lebenslagen outen.
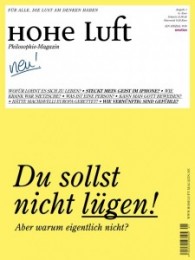 Simultanvorstellung zweier Magazine
Simultanvorstellung zweier Magazine
Irgendwo zwischen Hegel und praktischem Ratgeber orientieren sich die beiden neuen, gerade erschienenen Philosophie-Magazine „Hohe Luft“ und „Philosophie Magazin“. Während das Hamburger Blatt, das sich nach seinem Firmensitz in der Hoheluftchaussee benennt, auf knallgelbem Titelblatt postuliert „Du sollst nicht lügen!“ und gleich nachhakt „Aber warum eigentlich nicht?“, fragt das Berliner Magazin auf seinem Titel, illustriert mit zwei Kinderbeinchen in überdimensionierten Schuhen: „Warum haben wir Kinder?“
Es geht also nicht, wie Hoheluft-Chefredakteur Thomas Vasek in seinem Editorial betont, um „abseitige Theorien, sondern um die Welt, in der wir alle leben – und auch um uns selbst. Wer sind wir? Wie sollen wir leben?“ Klingt zwar irgendwie nach dem ratlosen Richard-David-Precht-Stoßseufzer „Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?“ Offenbar hat nun die Stunde der Alltagsphilosophen geschlagen. Aber was soll’s – etwas Pragmatismus kann in dieser neuen Philosophie-Kampagne sicher nicht schaden, vor allem, wenn es um den Spaß am Denken gehen soll. Der stellt sich bei der „Hohen-Luft“-Lektüre allerdings nur gelegentlich ein: Wenn etwa Herfried Münkler in seinem Beitrag darüber spekuliert, wie „der erste Politiker“ Niccolo Machiavelli heute Europa noch retten könnte, und sich nebenher kritisch über die Philosophie als „Fluchtort vor der schlechten politischen Wirklichkeit“ äußert. Sein Machiavelli-Verständnis zielt auch ab auf eine Synthese der Philosophie mit den Wirklichkeitswissenschaften Soziologie und Politik.
Im wohl besten und originellsten „Hohe-Luft“-Beitrag plädiert der Wiener Philosoph Robert Pfäller („Wofür lohnt es sich zu leben?“) für einen neuen Hedonismus und gegen eine dumpf-asketische, politisch-korrekte Verbiestertheit, die zur Bevormundung genussfreudiger, lebensbejahender Zeitgenossen tendiert. Anregend für eine vertiefende „Zarathustra“-Lektüre ist die Ortsbesichtigung in Sils-Maria auf den Spuren Nietzsches („Wo die Ewigkeit wohnt“), die illustriert, wie stimulierend das malerische Nest im Oberengadin auf den an diversen Leiden laborierenden teutschen Übermensch-Vordenker wirkte, der hier ja große Teile seines „Zarathustra“ schrieb. „Hohe Luft“ möchte aber auch die emotional besetzte Denker-Ecke (oder die Homöopathen- und Esoteriker-Fraktion?) berücksichtigen und setzt sich daher mit so bedeutenden Fragen wie „Können Tränen denken?“ auseinander oder geht dem Stellenwert von Farben („Alles so schön bunt hier!“) nach.
 Das mag ja für die Batik-Omas ganz putzig sein, ich verabschiede mich jedoch von dieser betulichen Spielwiese und blättere weiter beim Konkurrenzblatt „Philosophie Magazin“, einem Ableger des vor fünf Jahren vom Pariser Verleger Fabrice Gerschel gegründeten französischen Heftes. Gerschel wollte ursprünglich eine Kooperation mit dem Hamburger Emotion-Verlag eingehen, wo jetzt „Hohe Luft“ erscheint, doch die Sondierungsgespräche verliefen erfolglos, was nun zur überraschenden Simultanvorstellung der beiden Magazine führte.
Das mag ja für die Batik-Omas ganz putzig sein, ich verabschiede mich jedoch von dieser betulichen Spielwiese und blättere weiter beim Konkurrenzblatt „Philosophie Magazin“, einem Ableger des vor fünf Jahren vom Pariser Verleger Fabrice Gerschel gegründeten französischen Heftes. Gerschel wollte ursprünglich eine Kooperation mit dem Hamburger Emotion-Verlag eingehen, wo jetzt „Hohe Luft“ erscheint, doch die Sondierungsgespräche verliefen erfolglos, was nun zur überraschenden Simultanvorstellung der beiden Magazine führte.
Im „Philosophie Magazin“ hat man ein spannendes, über Skype geführtes Gespräch zwischen dem noch in England prozessierenden Wikileaks-Gründer Julian Assange und dem in Australien lebenden Peter Singer veröffentlicht, in dem das gefällige Kratzen an der Mainstream-Oberfläche vernachlässigt wird: Man versucht, den Kern der Debatte über die Grenzen der Informationsfreiheit zu erfassen. Das Überraschende an dem Dialog der beiden Australier ist die selbstkritische Position von Assange, der sich ja nach den brisanten Enthüllungen von 251.000 amerikanischen Botschaftsdepeschen inklusive skandalöser Geheimdienstdetails wie ein rechthaberischer Enthüllungsfundamentalist gerierte und offenbar keine Limits hinsichtlich der grassierenden Veröffentlichungsmanie akzeptieren wollte. Jetzt bekennt er jedoch: „Ich bin kein großer Freund der Transparenz … Das Internet ist zwar ein Wunder wegen seiner Veröffentlichungsmöglichkeiten, aber es ist auch das ausgeklügelste Massenüberwachungssystem, mit dem wir es je zu tun gehabt haben – was Bücher natürlich nie gewesen sind.“ Laut Assanges Darstellung wären die arabischen Protestbewegungen ohne Wikileaks gar nicht oder nur verhalten ausgelöst worden: Denn erst mit dem Proteststurm nach den Wikileaks-Enthüllungen, die eine Kooperation der USA, Frankreich und Großbritannien mit dem Mubarak-Regime und anderen Nahost-Diktatoren belegten, habe die „Arabellion“ von Tunis und Kairo auf andere Länder übergegriffen, meint Julian Assange.
 Rückblick – Überblick – Weitblick
Rückblick – Überblick – Weitblick
Das breite Spektrum, das die Philosophie als Meta-Wissenschaft, als sozusagen interdisziplinäre analytische Oberinterpretin, abdecken soll, spiegelt sich in den aktuellen Debatten wider und deutet vielleicht auch ihre Überforderung als Heil bringendes Vademekum für alle Lebenslagen an, frei nach dem Motto: „Wenn’s in den grauen Zellen beißt, hilft Medizin, die Philosophie heißt.“ Sie ist die Ultima Ratio beim Analysieren von Problemstellungen anderer Wissenschaften, muss aber vermeiden, die Erwartungshaltung pragmatischer Heimwerker oder introvertierter Selbsthilfegruppen zu bedienen. Wenn also Vittorio Hösle, der ehemalige „Boris Becker der Philosophie“ (promoviert mit 22, habilitiert mit 26, Philosophieprofessor mit 28 Jahren, jetzt Prof an der Notre Dame University, Indiana/USA und Beiratsmitglied des Komitees für eine demokratische UNO), in seinem 1992 veröffentlichten Buch „Praktische Philosophie in der modernen Welt“ nicht nur auf „Größe und Grenzen von Kants praktischer Philosophie“ einging, sondern sich auch mit der Dritten Welt als philosophischem Problem befasste und Überlegungen „Zur Metaphysik der ökologischen Krise“ anstellte, dann zeigt sich darin auch die fast unbegrenzte Flexibilität philosophischen Denkens: Kaum ein erkenntnistheoretisch fruchtbarer Problembereich wird ausgeblendet; zudem plädierte Hösle damals schon im Kapitel „Warum ist die Technik ein philosophisches Schlüsselproblem geworden?“ für eine größere Akzeptanz der besonderen Affinität von Technik und Philosophie. Da sich im Phänomen Technik, so Hösle, „ganz verschiedene Aspekte auf eigenwillige Weise verknoten“, sei die Philosophie besonders gefordert, weil dieses komplexe Phänomen mit einem spezialistischen Zugang nur unzureichend zu erfassen sei.
 Wir sehen also: Die Beanspruchung der Philosophie als Meta-Disziplin – seit Plato in den bestechenden Sokrates-Dialogen dokumentiert – ist zwar nichts Neues, aber in einer immer komplexer werdenden Welt werden auch die Anforderungen an sie wesentlich anspruchsvoller. Was zuletzt auch Axel Honneth in seinem Band „Das Recht der Freiheit“ illustrierte: Mit Hegel als Kompass steuert er durch das Krisenlabyrinth unserer Tage, um die aktuellen Defizite zu beleuchten – vom aufgeregten Medienrummel bis zur Zuspitzung sozialer Konflikte und dem verbissenen Kampf um individuelle Anerkennung.
Wir sehen also: Die Beanspruchung der Philosophie als Meta-Disziplin – seit Plato in den bestechenden Sokrates-Dialogen dokumentiert – ist zwar nichts Neues, aber in einer immer komplexer werdenden Welt werden auch die Anforderungen an sie wesentlich anspruchsvoller. Was zuletzt auch Axel Honneth in seinem Band „Das Recht der Freiheit“ illustrierte: Mit Hegel als Kompass steuert er durch das Krisenlabyrinth unserer Tage, um die aktuellen Defizite zu beleuchten – vom aufgeregten Medienrummel bis zur Zuspitzung sozialer Konflikte und dem verbissenen Kampf um individuelle Anerkennung.
Magazin für Querdenker
Keine Frage, die kontroversen Diskussionen in philosophisch-soziologischen Grauzonen werden unübersichtlicher und komplexer, die Debattenkultur daher immer spannender. Aber wo gibt es Orientierungspunkte, Medien, die solche Diskussionen als Forum begleiten? Deswegen noch (trotz Überlänge dieses Beitrags!) mein Geheimtipp: Wer wirklich in analytische Tiefen abtauchen will und sich nicht mit all den hanebüchenen, politisch korrekten, angeblich so offensichtlichen Erkenntnissen zu Klimawandel und Energiewende, zur Eurokrise und dem Brüsseler Regulierungswahn abspeisen lassen möchte, der sollte unbedingt das von Alexander Horn in Frankfurt herausgegebene Magazin für Querdenker in aufregenden Grenzbereichen „Novo Argumente“ lesen: Substanzielle Beiträge räumen mit vielen liebgewordenen Vorurteilen auf und sondieren mit Vorliebe im Terrain zwischen Soziologie, Politikwissenschaften und Philosophie.
 Da wird ebenso engagiert über das Erwachsensein diskutiert wie über leistungsfixierte „Tigereltern“, über die Entwicklung in Syrien, den Klimawandel, die Eurokrise und den allseits grassierenden Regulierungswahn. Angesichts der gerade eingeführten dänischen Fettsteuer, die dicke Dänen zu „gesunder“ Ernährung zwingen soll, ist diese kritische Thematisierung einer zunehmenden Bevormundung des Alltagsverhaltens von Bürgern (rauchen, trinken, Energie sparen, Auto fahren!) längst überfällig. Man fragt sich ja schon, ob wir von den Brüsseler Kontroll-Oligarchen nicht mit einem Orwellschen Big-Brother-System beglückt werden sollten. Denn in den EU-Schubladen liegen natürlich schon weitere Umerziehungsentwürfe. Über Pizza- und Pommes-Verbote in Schulkantinen wird bereits diskutiert, vielleicht wird Schokolade ja hierzulande im Supermarkt demnächst nur nach gesundheitsamtlicher Registrierung als „kaloriensüchtiger Junkie“ an Kunden abgegeben?
Da wird ebenso engagiert über das Erwachsensein diskutiert wie über leistungsfixierte „Tigereltern“, über die Entwicklung in Syrien, den Klimawandel, die Eurokrise und den allseits grassierenden Regulierungswahn. Angesichts der gerade eingeführten dänischen Fettsteuer, die dicke Dänen zu „gesunder“ Ernährung zwingen soll, ist diese kritische Thematisierung einer zunehmenden Bevormundung des Alltagsverhaltens von Bürgern (rauchen, trinken, Energie sparen, Auto fahren!) längst überfällig. Man fragt sich ja schon, ob wir von den Brüsseler Kontroll-Oligarchen nicht mit einem Orwellschen Big-Brother-System beglückt werden sollten. Denn in den EU-Schubladen liegen natürlich schon weitere Umerziehungsentwürfe. Über Pizza- und Pommes-Verbote in Schulkantinen wird bereits diskutiert, vielleicht wird Schokolade ja hierzulande im Supermarkt demnächst nur nach gesundheitsamtlicher Registrierung als „kaloriensüchtiger Junkie“ an Kunden abgegeben?
Höchste Zeit auch, dass nun endlich mit präzisen Fakten und kritischen Studien der Verdummungsstrategie von Klima-Aposteln beim IPCC (International Protocol of Climate Change) und dem PIK (Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung) Paroli geboten wird!
Wie können Politiker und Umweltexperten sich schon seit Jahren auf langfristige Prognosen des Weltklimarats verlassen, wenn die entsprechenden präzisen Messmethoden und Modellversuche dafür gar nicht existieren oder völlig unzureichend sind? Sind diese auf Panikprognosen und Politikerakzeptanz fixierten Klima-Weisen nicht die größten Erzeuger von heißer Luft? Sie düsen um die Welt – jetzt erst wieder zum Klimagipfel in Durban – schwadronieren über persönliche CO2-Konten und den beängstigenden Klimawandel und können keine ihrer Panikthesen exakt belegen. Egal, ob wir die kältesten Winter seit Jahrzehnten oder die regnerischsten Sommer haben, alles soll den bedrohlichen, vom Homo sapiens verursachten Temperaturanstieg beweisen – Hauptsache, das eigene Vorurteil wird bestätigt. Sonnenfleckenaktivitäten, die offenbar entscheidend zu klimatischen Veränderungen führen, bleiben bei diesen Spekulationen unberücksichtigt.
Bedenklich und äußerst fragwürdig wird diese bornierte Haltung, wenn Politiker Bewertungen des IPCC und des PIK unkritisch übernehmen, wie Günter Keil in seinem brillanten „Novo-Argumente“-Aufsatz meint: „Wann emanzipiert sich die Politik von den Angstmachern? Die Computermodelle, die das IPCC benutzt und von denen das PIK lebt, beschreiben nicht das chaotische, zeitlich unbegrenzte Klimasystem. Sie können keine zuverlässigen Vorhersagen erzeugen und sollten deshalb nicht für die Formulierung von Regierungspolitik verwendet werden. Ob und wie sehr wir künftig frieren müssen, entscheidet nach wie vor die launische Sonne.“
Tja, sie ist schon ein weites Feld, diese Philosophiedebatte, aber selten war sie so spannend und auf aktuelle, brennende Themen fokussiert wie heute.
Peter Münder
David Edmonds/Nigel Warburton (Hrsg.): Philosophy Bites. 25 philosophers on 25 intriguing subjects. Oxford Univ. Press 2010. 244 Seiten. 9.99 Pfund. Podcasts der Philosophen finden Sie hier.
Hohe Luft, Heft 1, 98 Seiten. 8,00 Euro (erscheint alle zwei Monate). Mehr hier.
Philosophie Magazin, Heft 1, 98 Seiten. 5,90 Euro (erscheint monatlich). Mehr hier.
Vittorio Hösle: Praktische Philosophie in der modernen Welt. München: C. H. Beck 1992. 215 Seiten. 8,90 Euro.
Axel Honneth: Das Recht der Freiheit. Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit. Berlin Suhrkamp Verlag 2011. 628 Seiten. 34,90 Euro.
Novo Argumente, Nr. 112, 338 Seiten. 19,80 Euro (im Buchformat, erscheint zweimal im Jahr). Herausgegeben von Alexander Horn. Schwerpunktthemen: Eurokrise, Energiewende, Klimawandel, Islamangst, Regulierungswahn, Überbevölkerung, Arabischer Aufbruch. Mehr hier.











