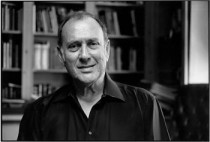Pinters politisches Erweckungserlebnis in der Türkei
Pinters politisches Erweckungserlebnis in der Türkei
– Wie wurde aus dem unpolitischen britischen Schöngeist Harold Pinter ein radikaler Kritiker des US-Imperialismus und brutaler Diktaturen? Sein fundamentales Erweckungserlebnis hatte der 2005 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnete Dramatiker während eines Türkei-Besuchs 1985, den er zusammen mit Arthur Miller im Auftrag des britischen PEN-Clubs unternahm, um die Lage inhaftierter Autoren in der Türkei zu untersuchen. Ein Rückblick auf türkische Verhältnisse aus gegebenem aktuellem Anlass. Von Peter Münder.
Neunundzwanzig Stücke seien genug, hatte Harold Pinter (1930–2008) im Frühjahr 2005 in einem BBC-Interview konstatiert und in seiner Nobelpreisrede vom Dezember 2005 erklärt: „Die Zeit der Scherze ist vorbei“ – jetzt schreibe er keine Stücke mehr, denn für schöngeistige Spitzfindigkeiten und Spielereien seien die Zeiten zu ernst, die kriegerischen Aktivitäten des US-Imperialismus im Irak und in Afghanistan zu brutal und menschenverachtend. Während der US-Invasion im Irak, als Tony Blair und George W. Bush die britisch-amerikanische special relationship bejubelten, hatte Pinter immer wieder gefordert, diese beiden Kriegstreiber müssten sofort vor einem internationalen Kriegstribunal angeklagt werden. Und als der US-Dramatiker David Mamet („Oleanna“) erklärte, mit Wut im Bauch könne er nicht schreiben, erwiderte Pinter sofort, er könne eigentlich nur noch mit einer „eiskalten“ Wut im Bauch schreiben.
Keine Frage: Pinter hatte sich seit seinen ersten Stücken („Das Zimmer“, 1957 „Die Geburtstagsfeier“, 1958 „Der Hausmeister“, 1960) stark radikalisiert. In „Bergsprache“, 1987 und „Party Time“, 1991 hatte er die Lage der Kurden in der Türkei und die brutale Willkür eines politischen Systems thematisiert, das von der Naivität und der hedonistischen Party-Mentalität einer selbstzufriedenen Mittelschicht profitiert. Auch in seiner poetischen „Reflexion über den Golfkrieg“ von 1991 („Amerikanischer Fußball“, in: „Krieg“ 2003, übers. von E. Plessen/P. Zadek) sondert er voller Zorn Kaskaden unflätigster Flüche und Invektiven ab: „Wir haben ihnen die Scheiße zurück in den Arsch geblasen und zu ihren Scheißohren heraus … Sie sind in ihrer eigenen Scheiße erstickt … Wir haben gewonnen“ usw. Und in seiner Turiner Preisrede anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde bezeichnete er 2002 die US-Administration als „blutrünstiges wildes Tier“, gleichzeitig kritisierte er Premier Tony Blair und dessen „verachtenswerte und beschämende Unterwürfigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten“. Keine Frage: Die Zeit milder Unverbindlichkeiten und blumiger Banalitäten war für Pinter endgültig passé.
Wer erlebt hatte, mit welcher Verve Pinter 1970 bei seiner Hamburger Dankesrede für die Verleihung des Shakespeare-Preises der Töpfer-Stiftung vehement gegen politisch engagierte Schriftsteller polemisierte („Ich bin nur ein Handwerker, der daran interessiert ist, dass abends der Theater-Vorhang pünktlich aufgeht“), die er kurzerhand als Seifenkistenredner abkanzelte, der rieb sich nun, angesichts dieses extremen politischen Radikalisierungsprozesses die Augen: Wie konnte sich dieser Sprachartist und Schöngeist, dieser subtile Liebhaber komplexer Ambivalenzen des Eindeutigen, so grundlegend verändern und sich plötzlich auf das Fabrizieren von Agitprop-Phrasen kaprizieren? Wo war der brillante Wort-Jongleur geblieben, der in eindrucksvoller Manier wie weiland Anton Tschechow sublimste Subtext-Konnotationen und verworrene Beziehungsgeflechte andeuten konnte?
Extreme Wandlung
Diese Wandlung war auf seinen im Auftrag des britischen PEN-Clubs mit Arthur Miller durchgeführten fünftägigen Türkei-Besuch im März 1985 ausgelöst worden – es war Pinters politisches Erweckungserlebnis. Das Autoren-Duo wurde von Orhan Pamuk begleitet und führte Gespräche mit circa hundert verfolgten türkischen Autoren und Intellektuellen und stellte dabei fest, dass fast alle während der Zeit der türkischen Militärdiktatur gefoltert worden waren. Autoren wie der Dramatiker Ali Taygun u. a. waren noch inhaftiert – Pinter und Miller erhielten für sie keine Besuchsgenehmigung und waren absolut schockiert: Folter, Gefängnisstrafen und Verfolgung von Regimekritikern waren offenbar ganz alltäglich. Miller und Pinter verfassten eine Protestresolution, die in der Türkei von 2330 Intellektuellen unterzeichnet wurde, sie veranstalteten Pressekonferenzen, deren vernichtende Berichte über die türkische Militärdiktatur und zur Lage verfolgter und gefolterter kritischer Künstler und Gewerkschafter auch von Amnesty International übernommen wurden.
Legendär wurde das aggressive Streitgespräch, das Pinter mit dem damaligen US-Botschafter in Ankara Robert Strauss-Hupé, einem glühenden Reagan-Verehrer, während eines festlichen Dinners mit 30 Gästen, darunter Politiker, Journalisten und einige Dissidenten, angezettelt hatte. Arthur Miller, Ehrengast bei diesem Bankett, hatte in einer kämpferischen Rede das amerikanische Demokratie-Verständnis scharf kritisiert: „Warum läuft dies immer auf die US-Unterstützung autokratischer und diktatorischer Systeme hinaus“?, hatte Miller gefragt. Und auch die Folterpraktiken des Regimes und die Verfolgung liberaler Demokraten angesprochen.
Später hatte der enragierte Botschafter dann Pinter in eine Diskussion verwickelt, in der er die Praktiken der faschistoiden türkischen Militärdiktatur mit der Nachbarschaft des brutalen sowjetischen Systems rechtfertigen wollte. Als Pinter der Kragen platzte und er den US-Diplomaten fragte: „Wie würde es Ihnen denn gefallen, wenn Ihr Penis an Elektroden angeschlossen würde und man Ihnen Stromstöße verpasste“? war der Eklat groß und Pinter wurde aus der Botschaft geworfen, was Arthur Miller nicht einfach so hinnehmen wollte: Er solidarisierte sich mit seinem britischen Freund und Kollegen und verließ diesen Schauplatz ebenfalls.
Für Pinter war Millers solidarische Unterstützung eine große Genugtuung – in einem Rückblick auf ihre Türkei-Erfahrung schrieb er später: „Mit Arthur Miller vom amerikanischen Botschafter in Ankara rausgeworfen zu werden – das war einer der Höhepunkte meines Lebens.“ Und Miller meinte begeistert: „Wir beide waren das perfekte Team – Harold konnte leicht streiten und explodieren, während ich eher zur ruhigen Implosion neigte. Wir waren von dieser Konstellation her das perfekte FBI- oder Polizei-Verhörteam: Gibt es da nicht auch immer den brutalen Typen, der die Daumenschrauben anzieht und als Begleiter den versöhnlichen Softie, der den Gutmütigen und Verständnisvollen mimt?“
Raus aus dem Dämmerzustand
Die brutale Niederschlagung der Demonstranten am Taksim-Platz, die Verfolgung liberaler Journalisten und Künstler – ungefähr neunzig sind zurzeit in der Türkei inhaftiert – durch das Erdogan-Regime, diese Exzesse scheinen in diesen Tagen direkt an die unselige Phase der Militärdiktatur in den 1980er Jahren anzuknüpfen. Die autosuggestive, größenwahnsinnige Idee einer Wiederbelebung des großen osmanischen Reiches scheint in den Köpfen der strammen türkischen autokratischen Hardliner immer größere Dimensionen anzunehmen und zur paralysierenden Feindbild-Imagination zu führen, wenn es zur Konfrontation mit kontroversen Ansichten und abweichenden Meinungen kommt.
Bei Pinter führte die Radikalisierung durch türkische Erfahrungen zur literarischen Auseinandersetzung mit zugespitzten politischen Thesen, die schließlich durch die amerikanische bellizistische Außenpolitik noch weiter ins extreme radikale Spektrum gedrängt wurde. Die kurzen anti-amerikanischen Agitprop-Sketche („The New World Order“ u.a.) haben weder irgendein Aufklärungspotential noch wirken sie unterhaltend. Umso intensiver und drastischer bestätigen sie die griffigen Vorurteile über plumpe Amis, dreiste Macho-Typen und aggressive Weltherrschaftsambitionen.
Was Pinter aber dennoch mit seinen radikalen Empörungs-Slogans schaffte, war ziemlich einzigartig: Das gutbürgerliche britische Feuilleton nahm plötzlich ebenso wie die verschlafene, selbstzufriedene britische Mittelschicht doch die beunruhigenden Ereignisse in der Türkei wahr und erwachte schließlich phasenweise aus ihrem lethargischen, jedes Tal der Tränen klaglos hinnehmenden Dämmerzustand.
Peter Münder
Harold Pinter: Death etc. Grove Press New York 2005. 125 Seiten (enthält Mountain Language, Ashes to Ashes, One for the Road, Debattenbeiträge zum Irak-Krieg und kurze Agitprop-Sketche).
Harold Pinter: Krieg. Übersetzt von Elisabeth Plessen und Peter Zadek. Verlag 2001 2003. 24 Seiten.
Peter Münder hat über Harold Pinter promoviert und eine bei Rowohlt erschienene Monographie veröffentlicht: PM: Harold Pinter. Reinbek: rororo 2006. 160 Seiten. 8,50 Euro.
Sehr umfangreiche Informationen finden Sie auf der Seite: HaraldPinter.org
Foto: Martin Rosenbaum, Nobelprize.org