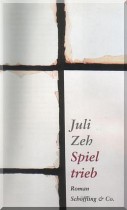 „Die Welt ist längst aus den Fugen geraten“
„Die Welt ist längst aus den Fugen geraten“
Mit ihrem neuen Roman „Spieltrieb“ ist der erst dreißigjährigen Juli Zeh nach fast einhelliger Meinung der Kritik ein großer Wurf gelungen. Sie beschreibt in ihrem nach „Adler und Engel“ zweiten Roman, wie zwei junge Schüler, die an nichts mehr glauben, ein perfides Spiel mit ihrem Lehrer treiben, das in die Katastrophe zu münden droht.
Das Gespräch führte Karsten Herrmann
Zur Zeit schreibt die Voll-Juristin und Hundeliebhaberin an ihrer Promotion zum Völkerrecht sowie an einem „Konversationslexikon für Haushunde“. Am Montag, den 29. November, liest Juli Zeh um 20.30 Uhr auf Einladung der Buchhandlung zur Heide im Blue Note aus ihrem neuen Roman.
Karsten Herrmann: Der literarische Herbst ist von jüngeren deutschen Autorinnen wie Antje Ravic-Strubel, Terezia Mora und auch Ihnen geprägt. Wo liegt Ihrer Ansicht nach das Erfolgsgeheimnis?
Juli Zeh: Der Bücherherbst war ebenso sehr von Thomas Brussig und Sven Regener geprägt, würde ich sagen. Der Eindruck, es gäbe mehr weibliche als männliche (Jung-) Autoren, beruht wohl eher auf einem Wahrnehmungsfehler. Über alle Epochen hinweg hat es immer viel mehr männliche als weibliche Autoren gegeben – und dieses Verhältnis beginnt sich nun tatsächlich anzugleichen. Darin besteht die Sensation, die zu hohem Medieninteresse gegenüber schreibenden Frauen führt. Ich glaube nicht an weibliche und männliche Schreibstile. Zur Zeit lese ich sehr viele unfertige Manuskripte junger Autoren, und ich würde mir in kaum einem Fall zutrauen, blind zu entscheiden, ob der Text von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurde.
Ihr neuer Roman „Spieltrieb“ beschreibt eine erschreckende Gegenwart, in der das Spiel an die Stelle von Recht und Moral getreten ist. Droht die Welt damit – gerade auch für Sie alsJuristin – aus den Fugen zu geraten?
Die Welt ist längst an vielen Ecken und Enden aus den Fugen geraten. Wir sind einer durchaus ungeliebten Weltordnung überraschend verlustig gegangen, ohne dass eine neue Vision zur Verfügung stand. Die uns vertraute Staatsform, die parlamentarische Demokratie, arbeitet seit Jahren sukzessive an ihrer eigenen Abschaffung zugunsten eines europäischen bzw. globalen Modells, das sich noch kein Mensch vorstellen kann. Unser moralisches Wertesystem, das christlich gestützt ist, hat seine Glaubwürdigkeitsgrundlagen verloren, ohne dass etwas an diese Stelle getreten wäre. Derart tiefschürfende Veränderungen haben natürlich auch Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit und Durchsetzbarkeit unserer Rechtsideen. Man darf aber nicht vergessen, dass Epochenwenden dieser Art alle paar Jahrzehnte vorkommen. Wir sind weder die ersten noch die letzten Menschen in der Geschichte.
Ist Schreiben angesichts dieser enormen Veränderungen für Sie eher eine existentielle Selbstvergewisserung oder eher eine kritische Bestandsaufnahme mit ironischer Distanz?
Beides. Wobei die existentielle Selbstvergewisserung an erster Stelle steht.
Ihre junge Protagonistin Ada ist eine intellektuelle Überfliegerin und Einzelgängerin, die Welt und Selbst solange seziert, bis nichts mehr übrig ist. Gibt es eine gewisse Verwandtschaft zwischen Ihnen und Ada?
Heute nicht mehr so arg. Aber es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich Ada durchaus ähnlich war – wenn auch selbstverständlich nicht bis zu den Ausmaßen des literarisch überhöhten Extrems.
Wie kann dem von Ihn beschriebenen „Schrecken des Nichts“, dem Fehlen von Sinn und Zweck in unserer Welt begegnet werden? Ist es die Liebe, die in ihrem neuen Roman als zarter Hoffnungsschimmer aufleuchtet?
Ja, so ist der Schluss des Romans in gewissem Sinne gemeint. In meinem Buch ist es eine Liebe, die von keinen äußeren Konventionen mehr bestimmt wird, da sie sich zwischen einem Lehrer und einer minderjährigen Schülerin entwickelt und dazu noch aus einer Erpressung hervorgeht – ein einziger Tabubruch, und trotzdem ein Hoffnungsschimmer. Allerdings kann eine solche Liebe höchstens das Einzelwesen vor dem „Nichts“ retten. Sie funktioniert nicht als Retterin größerer Systeme – denn sie ist keine christliche Liebe mehr, die sich auf „den Nächsten“ und damit auf den Menschen an sich bezieht, sondern eine private Liebe, die den eigenen Partner, die Kinder, Bruder oder Schwester – oder eben eine Schülerin meint. Welche Ideen aber unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten zusammenhalten werden, hat sich noch nicht herausgestellt, und darauf gibt auch mein Roman keine Antwort.
Das Interview führte Karsten Herrmann











