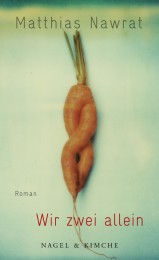 Mücken und Molybdän
Mücken und Molybdän
– Am 7. Februar ist es wieder so weit: Präsentiert u. a. von CULTurMAG, beginnt mit HAM.LIT 2013 der literarische Frühling. In der mittlerweile vierten „langen Nacht junger deutschsprachiger Literatur und Musik“ lesen im Hamburger Club „Uebel & Gefährlich“ 15 Autorinnen und Autoren spannende Literatur. Vom Roman über Lyrik und Erzählung bis zu experimenteller Prosa gibt der Abend einen Einblick in die junge deutsche Literaturszene. Zwischen den Lesungen und danach gibt es jeweils ein Konzert. Mit dabei ist auch Matthias Nawrat (21:30 Uhr, Terrace Hill), der im vergangenen Jahr mit dem Roman „Wir zwei allein“ debütierte. Eine Begegnung mit Matthias Nawrat. Von Gisela Trahms
Im verschneiten Berlin ist das Café neben dem ehrwürdigen „Babylon“-Kino ein anheimelnder Ort. Überlebensgroß lächelt Ernst Lubitsch von der Wand, durch die Fensterfront kann man dem Licht beim Verschwinden zusehen. Matthias Nawrat, sehr groß, sehr schlank, lächelt eher verhalten, als ich sein 2012 erschienenes Debüt „Wir zwei allein“ auf den Tisch lege. Zwei Jahre hat er an dieser Liebesgeschichte gearbeitet, viele Lesungen absolviert – jetzt ist der Roman „weit weg“ und abgetan.
Dennoch reden wir natürlich ein bisschen darüber, weil es ein sehr eigenwilliges Buch ist. Es spielt nicht im hippen Berlin, sondern in der Provinz, in Freiburg. Der weitgehend namenlose Erzähler hat sein Studium abgebrochen und beliefert als Fahrer eines Gemüsegroßhandels die Gaststätten des Schwarzwalds mit Kohl und Salat. Er will keine Karriere machen, im Gegenteil. Er will sich so still verhalten, so unscheinbar werden, so unerinnert, als hätte es ihn nie gegeben. Vorher aber liebt er die rätselhafte Theres, und zwar heftig. Spannung und Fallhöhe der Geschichte entstehen durch die Intensität dieser Sehnsucht. Und kaum droht sie sich zu erfüllen, wird ein Dritter sichtbar, als handle es sich um das Werther-Muster. Das Ende verheißt einen schwankenden Stillstand: Werther sorgt für Lotte, Albert wird begehrt.
Nicht die Psychologie der Figuren treibt den Roman voran, sondern die Sprache der Liebe. Die abgebrochenen Sätze, die Seufzer, das Unausgesprochene hinter den Dialogen, die Andeutungen und manischen Grübelexerzitien. Virtuos demonstriert Nawrat, welche Schwingungen allein den Namen der Liebsten in unterschiedlichen Kontexten begleiten, wie viel Verlangen, wie viel Abweisung ein Ach, Theres ausdrücken kann. Und da die Personen sich nicht preisgeben, vielmehr abgehoben bis zur Bizarrerie durchs nur scheinbar banale Leben gleiten, ist ihre Verortung in den exakt beschriebenen Lokalitäten umso nötiger und wirkungsvoller.
Der Mückenschwarm
Unter dem Titel „Der Mückenschwarm. Poetologische Fragmente, am Kern vorbei“ (siehe hier) hat Nawrat skizziert, wie er schreibt. Er beginnt mit dem Schreiben ohne Ziel, dem Fixieren dessen, was kommt. Die Sprache gleicht einem unendlichen Mückenschwarm, der Schreibende streckt die Hand aus und fängt ein paar Wörter. „Schreiben als offene Haltung“, als „Forschung“, deren Ziel die Schönheit einer neuen, leuchtenden Wortkombination ist. Die Figuren, Motive und Konstruktionen der Erzählung entwickeln sich erst im Prozess, die stimmige Version wird später aus dem üppigen Material destilliert. Die ungewöhnliche Schlussthese: „Sicher hat jeder Text etwas mit meinen realen Erfahrungen zu tun. Aber keine Spur der realen Erfahrung darf am Ende in einem Text enthalten sein.“
Matthias Nawrat wurde 1979 in Polen geboren, seine Familie übersiedelte kurz vor der Wende nach Deutschland. Er wuchs in Bamberg auf, studierte Biologie in Heidelberg und Freiburg, literarisches Schreiben im schweizerischen Biel, lebte in lauter schmucken, traditionsgeprägten Städten. Berlin mit seinen Brachen und Brüchen erlebt er als Ankunft auf der „angenehm hässlichen“ Seite der Wirklichkeit. Unbedingt nötig für sein Schreiben findet er die Großstadt jedoch nicht. Leicht kann er sich vorstellen, aufs Land zu ziehen. Und die literarische Szene der Hauptstadt? Ja, gewiss. Anregend, auch als Erfahrung der Konkurrenz. Aber er drängt sich da nicht vor. Wichtiger sind jene Freunde, auf deren Urteil er vertraut.
Früh hat Nawrat zu schreiben begonnen. Nach Einflüssen befragt, nennt er Nabokov, Tschechow, Hemingway, Carver, aber auch Max Frisch und dessen Notatetechnik. Als Vierzehnjähriger wollte er mit einem Freund einen Horror-Roman schreiben. Sein beim Bachmann-Wettbewerb gelesener Text „Unternehmer“ kombiniert ein einerseits apokalyptisches, andererseits dörfliches und drittens erträumtes Szenario. Wieder sind es die kollidierenden Wortfelder, die den Reiz erzeugen: Molybdän und Utzingen, Magnetspulenherzen und Schaffarm in Neuseeland. Zwischen Heimat, Schrott und Traum bewegt sich diese Geschichte, die Nawrat jetzt zu seinem zweiten Roman erweitert. Er wird härter, kantiger ausfallen als der erste.
Um ein sehr andersartiges Projekt zu realisieren, würde er gern für eine Weile nach Polen zurückkehren, da die Geschichte dort spielt: ein Schelmenroman über drei Generationen im Stil der tschechischen Tradition (Hrabal, Ota Pavel). Ein zarter und melancholischer Vorläufer von grazilem 50er-Jahre-Charme erschien unter dem Titel „Pan Tadek“ im Magazin poet Nr 12 des Leipziger Poetenladens.
Nach den üblichen Maßstäben also geht es voran. Vier Preise, darunter den Klagenfurter Kelag-Preis, hat Nawrat bereits gewonnen. Mit wachem Blick registriert er, was ihn umgibt, wozu auch die Teilnahme am Betrieb gehört, die Bewerbungen, Lesungen, Interviews. Mit lockerem Ernst stellt er sich dar, noch ist die Autorenfigur keine Panzerung. Aber ersichtlich gehört sie zu dem, was am Kern vorbeigeht. Was zählt, ist das Schreiben.
Gisela Trahms
CULTurMAG nimmt am Amazon-Partnerprogramm teil:
Matthias Nawrat: Wir zwei allein. Nagel & Kimche 2012. 192 Seiten. 17,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Zur Homepage von Nawrat geht es hier. Poträtfoto: © Lorena Simmel/HAM.LIT.












