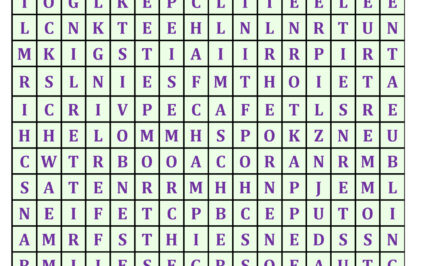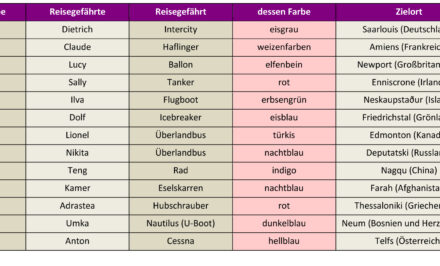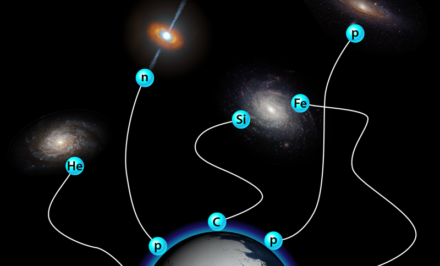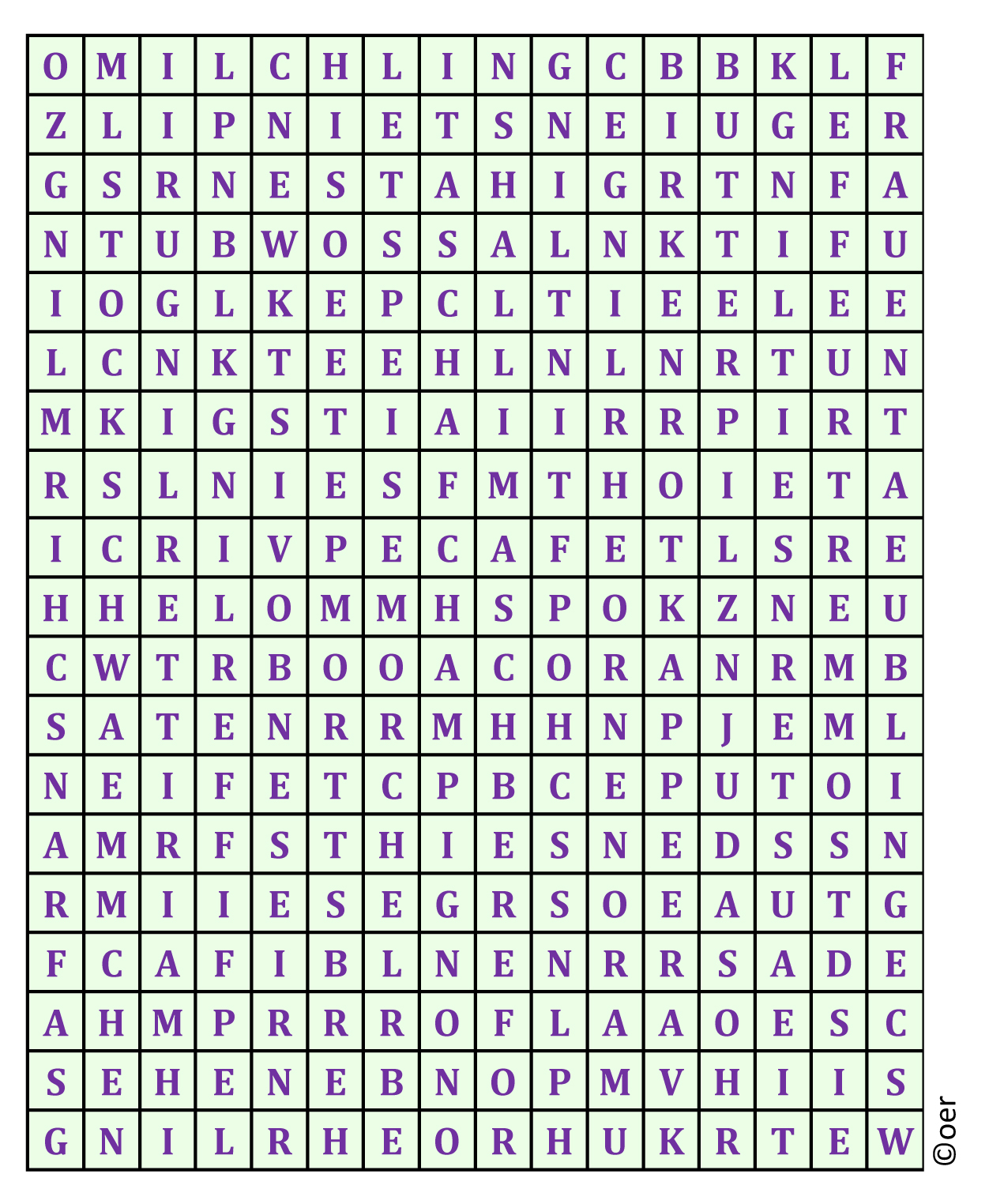Lotterleben
Lotterleben
Wer zu Hause arbeitet, kann jeden Morgen ausschlafen. Und überhaupt den ganzen Tag tun und lassen, was er will. Streng genommen arbeitet ein Freiberufler eigentlich gar nicht. Isabel Bogdan führt ein Lotterleben.
Natürlich schlafe ich aus. Ich schlafe sogar so fest, dass ich es gar nicht höre, wenn der Wecker des Gatten klingelt, ich höre es nicht, wenn er aufsteht, sich anzieht und so weiter, ich schlafe. Ich wache erst dann auf, wenn er mich weckt, um sich zu verabschieden, weil er nämlich pünktlich um halb acht los muss, einer geregelten Arbeit nachgehen. Dann sage ich Tschüss, drehe mich um und schlafe weiter.
Bis ich von allein wieder aufwache. Ich schlurfe in die Küche, hole mir einen Becher Kaffee, den der Mann zwei Stunden vorher freundlicherweise in die Thermoskanne gefüllt hat, und setze mich damit an den Rechner. Lese die ersten Mails, lese ein paar Blogs, gucke nach, was bei Facebook so los ist, beantworte ein paar Mails, fange dann aber bestimmt gleich an zu arbeiten, aber erst mal hole ich mir noch einen Kaffee. Es gibt weitere Blogs zu lesen, Perlentaucher, bei Facebook hat auch schon wieder jemand was gepostet, ich schiebe ein paar Zettel auf dem Schreibtisch hin und her, und übrigens ist es irgendwie plötzlich schon zwölf, ich könnte mir mal Frühstück machen. Überhaupt wäre es auch nett, nicht mehr im Schlafanzug zu sein, wenn der Mann nach Hause kommt, und so bin ich am frühen Nachmittag immerhin geduscht und angezogen, und die To-do-Liste ist auf dem neusten Stand. Na ja, und so weiter.
Es ist hauptsächlich eine Frage des Drucks. Wenn ich mit einem neuen Buch anfange, mache ich erst mal gar nichts. Irgendwann lege ich langsam los, werde im Laufe der Zeit immer schneller – nicht, weil ich besser „drin“ wäre, sondern weil der Druck steigt – und kurz vor dem Abgabetermin kette ich mich am Schreibtisch fest und mache nichts anderes mehr. Gesund ist das nicht. Erst hat man dauernd ein schlechtes Gewissen, weil man immer noch nicht angefangen hat oder immer noch nicht weitergekommen ist, und dann legt man los und macht sich den Rücken kaputt.
Natürlich mache ich mir, bevor ich anfange, einen Plan. Daran halte ich mich aber schon am ersten Tag nicht, und am zweiten nicht, und nicht am dritten. Zwei Wochen später mache ich einen neuen Plan, an den ich mich … genau.
Die klugen Ratschläge kenne ich auch. „Zur Arbeit gehen“ soll man – das heißt, man steht auf, zieht sich an und geht eine Runde um den Block, um symbolisch zur Arbeit zu gehen, und dann setzt man sich hin und arbeitet. Und wäscht nicht zwischendurch Wäsche. Bei mir hat es nicht mal funktioniert, als ich tatsächlich eine Zeitlang einen Büroplatz gemietet hatte. Im Büro hatte ich ja auch Internet. „Internet ausmachen“ ist natürlich ein guter Ratschlag, ich habe sogar ein kleines Programm, das mich für eine von mir selbst festgelegte Zeitspanne nicht ins Netz lässt. Hilft manchmal. Allerdings muss ich natürlich dauernd recherchieren, ohne Internet kann ich praktisch gar nicht arbeiten. Ehrlich! Es nutzt auch nichts, von Twitter loszukommen, weil man dann bei Facebook herumlungert. Es nutzt nichts, die Kartenspiele auf dem Computer zu löschen, weil man dann halt bunte Kügelchen abschießt. Wer ein Aufschieber ist, wird immer etwas finden.
All die schönen Vorteile des Freiberuflertums sind gleichzeitig die Nachteile. Sich immer wieder selbst zu motivieren, sich zusammenzureißen, zu arbeiten, obwohl man noch schnell die Fenster putzen könnte oder noch ein Stündchen schlafen, das Dokument auf- und das Internet zuzumachen, obwohl einem kein Chef über die Schulter guckt, all das ist verdammt harte Arbeit. Und das ist mein Ernst. Angestellte verstehen das oft nicht, aber die meisten Freiberufler können ein Lied davon singen.
Der fatalste Fehler allerdings ist, es zuzugeben. Denn offenbar ist es sowieso schon schwer zu begreifen, dass zu Hause arbeiten auch arbeiten ist. Die protestantische Ethik sitzt tief, scheint’s, und wer nicht um acht irgendwo sein muss, um einem Chef zu dienen, der arbeitet nicht. Da muss man sich dann schon mal Sätze anhören, die mit „solange du Hausfrau bist“ anfangen. Oder solche, in denen die Formulierung „ein bisschen was dazuverdienen“ vorkommt. Und wenn man sagt, man hätte keine Zeit, man müsse arbeiten, kommt bestenfalls ein „Wieso, hast du wieder geschlampt?“.
Liebes Umfeld, „zu Hause arbeiten“ ist nicht „nicht arbeiten“. Und „sich die Zeit frei einteilen können“ ist nicht „immer Zeit haben“. Das ist ein Missverständnis, und es nervt. Und man selbst nervt sich auch, also ich mich jedenfalls, wenn ich erst nicht zu Potte komme und dann wieder die Nächte kurz werden und ich Einladungen absagen muss. Solche Sprüche wie oben fehlen einem dann gerade noch.
„Weißt du was, du musst eine Diät machen. Brigittediät!“, sagt eine Kollegin. Ich gucke an mir runter und denke, na ja, so nötig ist es jetzt auch nicht, da sagt sie: „Nein, nein, nicht wegen deiner Figur. Aber wenn man eine Diät macht, hat man dreimal am Tag einen Termin. Das gibt dem Tag Struktur. Ich mache immer Brigittediät, wenn ich wieder anfange zu verlottern. Dann schafft man vormittags schon was weg, weil man weiß, dass man um zwölf anfangen muss zu kochen. Und nachmittags genauso.“
Klingt schlau, einerseits. Andererseits ist das natürlich so ähnlich wie mit den Plänen. Pläne funktionieren aber nur bei Leuten, bei denen Pläne funktionieren. Einmal jaulte ich und fragte, ob ich nicht endlich erwachsen werden und meine Zeitplanung in den Griff kriegen könnte. Da sagte eine Kollegin, Erwachsenwerden habe doch nichts damit zu tun, dass man seine Zeitplanung im Griff hat, sondern damit, dass man endlich akzeptiert, dass man eben so arbeitet. Im ersten Moment fand ich das lustig. Dann fand ich, sie hat recht, und seitdem bemühe ich mich zu akzeptieren, dass ich eben so arbeite.
Das System funktioniert ja auch. Dass mir hier keine Missverständnisse aufkommen: Ich habe noch immer pünktlich abgegeben. Wenn ich einen Termin habe, funktioniere ich. Ohne Termin keine Chance. Ich brauche die Last Minute Panic.
Aber manchmal denke ich dann doch, ich sollte es weiterhin versuchen, das mit dem strukturierteren Arbeiten. Für das vorletzte Buch hatte ich natürlich einen Termin, und zwar einen so knappen, dass ich mir einen Plan gemacht habe. Als er fertig war, habe ich nach Luft geschnappt, denn der war ganz schön ehrgeizig. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben an den Plan gehalten, von Anfang an, bis fast zum Ende. Weil ich musste, weil der Druck hoch genug war, oder weil keine Ahnung. Mehrfach hatte ich das Tagespensum bereits abends um acht oder neun geschafft, dann hatte ich Feierabend. Feierabend! Großartiges Konzept, es fühlt sich super an, das Tagwerk getan und dann frei zu haben. Vollkommen neues Lebensgefühl. Kurz vor Schluss, zwei oder drei Arbeitstage vor Abgabe, kam ein neuer Auftrag, sehr eilig. Den Roman, sagte die Lektorin, könne ich dafür erst mal beiseiteschieben, der hätte „alle Zeit der Welt“, der Erscheinungstermin sei nämlich auf nächstes Frühjahr verschoben.
Der Eilauftrag ist längst erledigt (pünktlich). Danach hatte ich kurz Pause, dann kamen die Korrekturen, die sind auch erledigt. Zwischendurch Kleinigkeiten, nicht wirklich viel zu tun. Der Roman liegt da immer noch. Seit Wochen. Ich bräuchte noch zwei Tage. Es ist schönes Wetter, ich gehe ein Eis essen, der Roman hat ja alle Zeit der Welt.
Isabel Bogdan
Isabel Bogdan übersetzt seit 10 Jahren Literatur aus dem Englischen (u.a. Jonathan Safran Foer, Miranda July, ZZ Packer, Tamar Yellin, Andrew Taylor, Sophie Kinsella, Alice Sebold, Janet Evanovich). Sie lebt und arbeitet in Hamburg.