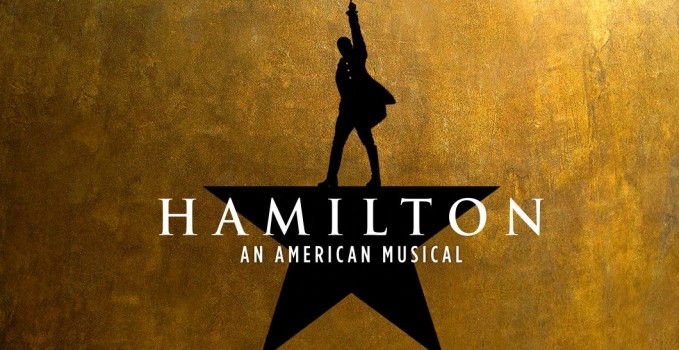Hamilton Is Hot
Nie war er so wertvoll wie heute, selten gab es einen solchen Promi-Hype wie in diesen Tagen um Alexander Hamilton. Er war kein Popstar, kein Baseballspieler, sondern einer der amerikanischen Gründerväter, Adjutant von George Washington, Artillerie-Offizier, Finanzexperte und Kolumnist, der 1804 im Duell von seinem Erzrivalen Aaron Burr erschossen wurde. Auf der Zehndollarnote prangt sein Porträt, mehrere Biographien beschäftigen sich mit ihm, auch das New Yorker Mega-Musical Hamilton bejubelt sein Leben im hymnischen Rapsound. Für viele Amerikaner ist er der Mann der Stunde. Von Peter Münder
Über „The hottest tickets in town“ freuen sich in diesen Tagen New Yorker Theaterbesucher, die noch Karten für das „Bio-Musical“ Hamilton ergattern konnten. Einige zahlten dafür sogar 1500 Dollar pro Ticket. Dabeisein ist alles, schließlich sind alle Vorstellungen Monate im Voraus ausverkauft, auch Präsident Obama hatte sich begeistert über die Rapper-Version der Hamilton-Biographie geäußert. Die Jubelkritiken über das „Musical der Dekade“ sind dermaßen euphorisch und elektrisierend, dass man sich verblüfft die Augen reibt: „Ich musste die ganze Zeit weinen und empfehle Hamilton als Lebenselixier und Stimmungsaufheller“, schrieb die Kritikerin der New York Times.
Rap-Beats und knackige Texte
Keine Frage: Der Aufstieg und Fall eines unehelichen Außenseiters aus der Karibik, der Adjutant von George Washington, Schatzkanzler und Gründer der New York Post wurde, Verfassungsexperte, Rechtsanwalt, Publizist und Bankengründer war, ist die klassische American-Dream-Story. „Wer braucht noch aufputschende Energizer, wenn er vom Hamilton-Adrenalinschub erfasst wird?“, fragte die New York Times. Der Rap-Beat, der knackige Text, der zwar gar nichts analysiert, sondern nur biographische Episoden und ihre Dramatik kurz anreißt, begeistern das Publikum und mobilisieren ihre nationalistischen Urinstinkte, die in den letzten Jahren zu verkümmern drohten. Als „The story of America“ wird das Musical von Lin Manuel Miranda (Musik, Libretto, Regie) inzwischen von den meisten US-Medien tituliert. Der verblüffende heldenhafte Aufstieg des AH wird so auf den Punkt gebracht:
How does a bastard, orphan son of a whore and a Scotsman
dropped in the middle of a Forgotten Spot in the Caribbean
by providence impoverished, in squalor
grow up to be a hero and a scholar?
 Dass die historische Ausnahmeerscheinung Hamilton (1755-1804) über 200 Jahre nach seinem tödlichen Duell mit dem egomanisch-opportunistischen Schaumschläger Aaron Burr als leuchtendes Vorbild verherrlicht und zum Mann der Stunde wird, liegt natürlich auch am Niedergang der amerikanischen politischen Kultur, am erbärmlichen Zirkus, den ein Verdummungs-Clown wie Donald Trump betreibt, sowie am hilflosen Agieren der US-Regierung, die auf allen Krisen-Schauplätzen der Welt versagt und völlig überfordert ist.
Dass die historische Ausnahmeerscheinung Hamilton (1755-1804) über 200 Jahre nach seinem tödlichen Duell mit dem egomanisch-opportunistischen Schaumschläger Aaron Burr als leuchtendes Vorbild verherrlicht und zum Mann der Stunde wird, liegt natürlich auch am Niedergang der amerikanischen politischen Kultur, am erbärmlichen Zirkus, den ein Verdummungs-Clown wie Donald Trump betreibt, sowie am hilflosen Agieren der US-Regierung, die auf allen Krisen-Schauplätzen der Welt versagt und völlig überfordert ist.
Während Hamiltons Widersacher Aaron Burr seine Fahne stets nach dem Wind hielt, der ihm Zustimmung oder entscheidende Mehrheiten entgegenwehte, stand Hamilton immer zu seinen Ansichten, auch wenn sie unpopulär waren. Einen solchen Mann mit Rückgrat, der sich zudem noch als unehelicher Sohn aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet hatte – das hatte es in den USA lange nicht mehr gegeben.
Er setzte in den Gründerjahren um 1787 zuverlässige Steuergesetze durch, um einen überschaubaren Haushalt zu haben, er beschäftigte sich in den „Federalist Papers“ eingehend mit allen Aspekten einer Verfassung, die auch föderalistische Nuancen und Eigenwilligkeiten berücksichtigen sollte.
Eine Ausnahmeerscheinung
Der von reichen Mäzenen geförderte Hamilton, der am New Yorker King‘s College (heute Columbia University) studieren konnte, in eine der reichsten New Yorker Dynastien einheiratete und mit seinen turbulenten Liebesaffären für Aufsehen sorgte, war aber als rasanter Aufsteiger auch immer Vertreter einer starken Zentralregierung und eines machtbewussten Establishments geblieben.
Während der New Yorker Gouverneurswahlen hatte sich Hamilton nicht nur in diversen Reden und Briefen, sondern auch in Zeitungsartikeln derartig abfällig und hämisch über seinen Rivalen Burr geäußert, dass dieser mehrmals Entschuldigungen einforderte und Hamilton schließlich zu einem Duell mit Pistolen herausforderte, das dann im Morgengrauen des 1. Juli 1804 am Hudson River stattfand. Die Legende besagt, dass Hamilton seinen Gegner verschonen und absichtlich verfehlen wollte, während Aaron Burr kaltblütig auf Hamiltons Herz zielte und ihn so schwer verletzte, dass der am nächsten Tag starb. Wie auch immer – Hamilton ist in diesen Tagen, trotz der kontroversen Diskussionen um die Entfernung seines Porträts (um Platz für eine Frauenfigur zu machen) von der Zehndollarnote, für Millionen von Amerikanern die leuchtende Inkarnation des ewig jungen, dynamischen Pioniers, der mit anderen Visionären einen mächtigen Staat aufbauen konnte. Im Rap-Jargon des Hamilton-Musicals hört sich das so an:
Hey yo, I´m just like my country – I´m young, scrappy and hungry and I´m not throwing away my shot.
Ob die Erinnerung an Hamilton helfen soll, die gegenwärtige eher deprimierende politische Situation der USA zu kompensieren und aufzuhellen, ist eine andere Frage. Und angesichts der historisch gesehen immer schon etwas ruppig anmutenden amerikanischen Duell-Kultur fragt man sich ja auch, wie man das ausgerastete Rumpelstilzchen Trump in diesem politischen Koordinatensystem einordnen soll. Jedenfalls ist das Hamilton-Phänomen ein schrilles, faszinierendes Medien-Ereignis, das wohl auch den Medien-Guru Marshall McLuhan verwundert und irritiert hätte.
Peter Münder
Das Hamilton-Musical läuft noch etliche Monate am New Yorker Richard Rogers-Theatre
Liter.: Richard Brookhiser: Alexander Hamilton, American. Simon & Schuster 1999 240 Seiten.
John Sedgwick: War of Two: Alexander Hamilton, Aaron Burr and the duel that stunned the nation. Berkeley 2015, 455 S.
Ron Chernow: Alexander Hamilton (2004)
Fotocredits:
Alexander Hamilton, Public Domain, Quelle: Wikipedia
Hamilton-Crew mit Präsident Obama (c) Pete Souza, Quelle: Wikipedia
Lin-Manuel Miranda (c) John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Quelle: Wikipedia