 Impala
Impala
Ulrike Brügger
Das lyrische Ich
Vorgestellt von Gisela Trahms
Das lyrische Ich
‚Boulevard der Schatten‘ könnte das Gedicht
genauso gut heißen.
Was bleibt, ist die Erinnerung an verbrannte
Sterne. Ich bewege die Fersen wie eine Antilope
in ihrer Heimat, dem Büro. (Der Kaffee?
Schmeckte ausgezeichnet, auch Ihr roter Penis!
Der Erfolg eines Unternehmens hängt ja ganz
entscheidend von den Frisuren seiner Mitarbeiter
ab und ihrer jeweiligen Behinderung).
Rings um dieses Tableau verweht Asche,
die Nächte sind nicht mehr von den Tagen
zu unterscheiden, ein dunkler Zeitkumulus,
in dem ich treibe. Ich, das Impala, das so
gerne Kaffee trinkt. Alles fragt sich jetzt
natürlich, wer Sie wohl sind und wo.
Das Gedicht kann sehr gut in einer Gespensterwelt
existieren. Es könnte auch „Die flackernde Kerze
der Lust“ heißen. Wir beide, das Gedicht und ich,
bilden eine Nische für Leute wie Sie.
Was für ein sperriger Titel (außer für Lyriker)! Aber welch eine leuchtend rote Überraschung in der Mitte der ersten Strophe! Und überhaupt, diese sich über fünf Zeilen erstreckende Klammer – ist da nicht Verschiedenes durcheinander geraten?!
Das lyrische Ich dieses Gedichts ist weiblich. Und es wohnt in dem der Frau gemäßen Raum, dem Büro, wo es Kaffee kocht, für die Männer, klar, und für sich selbst wohl auch ein Tässchen. So die Erwartung. Aber hier scheint es umgekehrt zu sein, die Frau wird gefragt, ob ihr der Kaffee schmecke, also wurde er ihr wohl serviert. Und offenbar wurde ihr auch ein Penis angeboten, dessen Geschmack zu rühmen sie nun Gelegenheit hat als handle es sich um ein Sandwich.
Genauso absurd geht es weiter mit Standardsätzen aus dem Wirtschaftsleben, tausendfach reproduziert bei Betriebsversammlungen und Bewerbungsgesprächen, nur dass hier plötzlich nicht die Fähigkeiten, sondern die Frisuren, nicht die Talente, sondern die Behinderungen der Mitarbeiter über den Erfolg des Unternehmens entscheiden. Die Firmen-Phraseologie kippt ins Lächerliche. Und die Rollenverteilung von Mann und Frau wird so witzig durcheinander geschüttelt, dass Erheiterung und Verblüffung sich die Waage halten. Lässig wird das Schockpotential des Wortes ‚Penis‘ als Köder ausgelegt (darauf fliegst du natürlich, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère!), um den Leser auf den Schleudersitz zu locken.
Vorangegangen ist diesem spöttischen Chaos ein ganz andersartiger, düsterer Satz: „Was bleibt, ist die Erinnerung an verbrannte / Sterne.“ Dieses Motiv des erloschenen Feuers nimmt die zweite Strophe auf und stellt damit das quirlige Bild in einen schwarzen Rahmen. Ganz allein treibt das anmutige Impala, eigentlich ein Tier des Lichts und der schwerelosen Sprünge, durch den dunklen „Zeitkumulus“. So lustig ist es eben alles nicht, weder im Büro noch außerhalb.
Beschlossen wird die Strophe von einer Volte in den Metadiskurs, der unsere Fragen vorwegnimmt: Wer ist denn bitte der Angeredete, wo findet der irrwitzige Monolog (oder Dialog?) statt, den die Klammer wiedergibt? Oder handelt es sich ‚bloß’ um die stumme Phantasie einer unterdrückten Büroangestellten, die ihrem Chef gern demonstrieren würde, wie sehr sie ihn verachtet?
Keine Antwort.
Vielmehr wird mit diesem etwas schadenfroh klingenden Hinweis auf die Neugier des Lesers („Alles fragt sich jetzt natürlich“) der Rätselsatz fortgeführt, mit dem das Gedicht beginnt. Das lyrische Ich, also die Sprecherin, scheint auf dem ‚Boulevard der Schatten‘ zuhause zu sein, sie situiert sich nur bedingt in der Realität. Zwar bezeichnet sie das Büro als „Heimat“, da es ihr zum Broterwerb dient, aber das Ich, das dort arbeitet, ist eben nicht das lyrische, sonder ein abgespaltenes – seine Sprache ist nicht frei, es muss sich Tabus und Hierarchien unterwerfen. Nur in der Parallelwelt der Gedichte kann es äußern, was es will und die Verhältnisse auf den Kopf stellen.
Die Lyrik also als „Gespensterwelt“, die für die realen Machtverhältnisse folgenlos bleibt. Mit dem Titelvorschlag „Die flackernde Kerze der Lust“ ironisiert das Ich sich selbst und den Mann gleich mit – das ist ja Groschenroman…
Aber das größte Rätsel wartet im letzten Satz. Wieso bilden das Ich und das Gedicht eine Nische für das angeredete „Sie“? Müsste es nicht eher heißen: Ich und das Gedicht bilden einen vor Typen wie Ihnen geschützten Raum, Sie erreichen uns nicht, trotz Ihres Geschwafels? Aber so ist es offenbar nicht gemeint.
Kippen wir also den Text in eine andere Lesart: Vielleicht ist es eher das, was wir ‚Wirklichkeit‘ nennen, was sich als hohle „Gespensterwelt“ voller „Schatten“ entpuppt. Und weil eine Menge Leute das untergründig spüren, brauchen sie Nischen, wo ihnen eine andere Wirklichkeit begegnet und ein lyrisches Ich mit anderer Sprache: wahr und geheimnisvoll und freimütig. Im Gedicht.
Gisela Trahms
Gedichte mit kritischer Neugier und Genuss zu lesen – das ist das Ziel der Reihe Neuer Wort Schatz II, die jede Woche einen zeitgenössischen Text vorstellt. Zusammengestellt wird sie von GISELA TRAHMS und DANIEL GRAF.
Zu Neuer Wort Schatz II (19): Sabina Naef
Zu Neuer Wort Schatz II (17): Jan Skudlarek
Zur ersten Staffel von NWS geht‘s hier
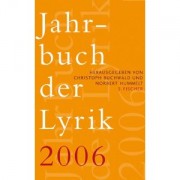 Jahrbuch der Lyrik 2006, hg. von Christoph Buchwald und Norbert Hummelt.
Jahrbuch der Lyrik 2006, hg. von Christoph Buchwald und Norbert Hummelt.
S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2005. 208 Seiten. 18,00 Euro.











